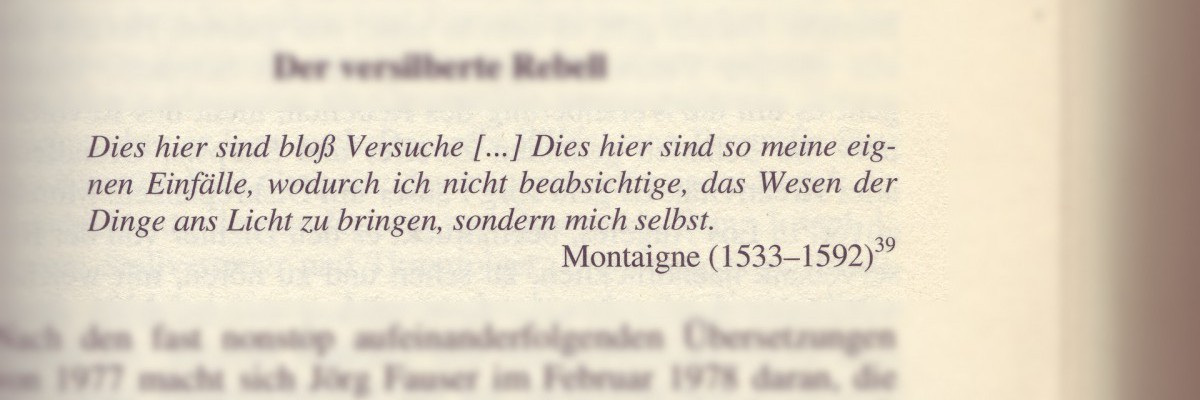Wir gingen zusammen zur Schule, von der achten bis zur zwölften Klasse. Damals, an der Küste, nachdem der eine Staat verschwunden war und der aktuelle eben auch die Schule neu organisieren musste. Was bedeutete, dass ich nicht wie geplant bis zur zehnten Klasse auf der alten POS bleiben konnte. Jedenfalls nicht, wenn man vorhatte, etwas aus sich (bzw. dem Kind) zu machen: Denn hier würden demnächst nur noch Realschüler die Zeit totschlagen, wer mehr wollte, musste auf ein Gymnasium. So war das jetzt, dafür gab es aber immerhin keine langweiligen Pioniernachmittage und Freundschaftsratssitzungen mehr.
In meiner Stadt wurden drei Gymnasien eingerichtet. Zwei davon kamen für mich in Frage, das dritte lag zu weit weg von der Altstadt, in der ich wohnte, draussen in einem der Plattenbauviertel. Aber ich wollte ja sowieso auf die altehrwürdige Backstein-Eliteschule kurz vor der Stadtmauer und somit nur fünf Minuten Fussweg entfernt – wenn schon, denn schon. Die Sache hatte nur einen Haken: Die Schulen versuchten, sich ein Profil zu geben – und die von mir auserwählte wollte nun unbedingt ein musisches Gymnasium sein. Für die klassisch-deutsche humanistische Lehranstalt gab es wohl einfach noch nicht genügend Latein- und Griechischlehrer, schätze ich mal. Man muss ja mit dem Menschenmaterial arbeiten, was da ist, ein Jahr nach dem Systemwechsel. Deshalb hatten wir auch bis zur zwölften Klasse Russischunterricht.
Jedenfalls konnte ich meine musischen Fähigkeiten realistisch genug einschätzen (nicht vorhanden), um zu wissen, dass meine Karten nicht die besten waren. Zum Glück hatte aber meine Musiklehrerin einen Narren an mir gefressen – ich wurde in dieser Schule eingeschult, war aber zwischendurch lange Zeit woanders und erst vor einem Jahr wieder zurückgekehrt, worüber sie sich unerklärlicherweise sehr freute. In diesem kompletten Jahr konnte ich meine Musik-Legasthenie dank vorgegaukeltem Stimmbruch ganz passabel verschleiern, wenn es hart wurde half mir mein spielmannszuggestählter Banknachbar dabei, irgendwelche Takte vorzuklopfen oder ähnliches. So kam ich zu meiner Empfehlung, ebenso wie mein heimlicher Helfer. Insgesamt gingen aus unserer 27-Köpfe-Klasse vier aufs Gymnasium.
Was ich bei meinen ganzen praktischen Überlegungen zur Entferrnung zwischen Wohnort und Lernort, dem Ruf, der Architektur und so weiter nicht bedacht hatte, war der Lehrplan. Damit hatte ich mich null auseinandergesetzt, schliesslich war ich jung und es waren Sommerferien. Aufgrund des euphorischen Schreibens meiner ehemaligen (und- wie sich herausstellen sollte – zukünftigen) Musiklehrerin fand ich mich am ersten Schultag in der musisch ausgerichteten Klasse wieder – denn das war es auch schon mit dem Profil: pro Jahrgang eine Spezialklasse. Zusammen mit zwei anderen Jungs und 25 Mädchen. So weit, so gut (und beängstigend auch irgendwie). Als die Klassenlehrerin dann allerdings den Stundenplan erklärte und es dort dank der musischen Spezialisierung nur so von Kunst- und Musikstunden wimmelte, wurde ich etwas panisch. Eine glückliche Fügung liess kurz darauf den Kopf einer anderen Klassenlehrerin im Türspalt erscheinen, mit der Frage, ob vielleicht noch jemand in eine normale Klasse wechseln möchte, sie hätte noch drei freie Plätze. Ich meldete mich sofort, mein alter Banknachbar zog mit, obwohl seine Fähigkeiten hier gut aufgehoben gewesen wären. Der einzig übriggebliebene Junge in der 8 a(m) – wobei das m jetzt unter der Hand für Mädchen stand – wurde in den nächsten Jahren regelmäßig verprügelt, irgendwann war er nicht mehr da.
An diesem Tag war ich also für eine knappe Unterrichtststunde in der gleichen Klasse wie A. Kennenlernen sollten wir uns allerdings erst zwei Jahre später. Dazwischen lag eine komplizierte Zeit, diverse Jugendkulturen kämpften auch auf dem gymnasialen Pausenhof um die Lufthoheit, und zu dieser Zeit in dieser Region war es um das Überleben der Punks, zu denen A. von Anfang an zählte, nicht gut bestellt, manchmal wortwörtlich. Von ihr abgesehen stellte sich die Klasse, aus der ich mich retten konnte, als perfekte Vorstufe des späteren Germanistik-Seminars heraus: Höhere, meist blonde Töchter mit Pferdeschwanz, Bratschenkoffer und der Nase ganz weit oben. A. trug ihr Haar damals grün, wenn ich mich recht erinnere.
Unser nächstes Zusammentreffen, das erste wahrnehmende, wenn auch noch nicht zur Initiation taugend, ereignete sich dann bei einem meiner ersten Ausflüge in den lokalen Underground. Direkt neben dem historischen Altstadttor, unweit der Schule, traf sich die alternative Szene der Stadt. Es waren nicht viele, der Raum auch nicht größer als ein Wohnzimmer. Aber es reichte, um billiges Bier zu trinken, laute Musik zu hören, vom einzigen Interim-Abo weit und breit zu profitieren und das erste Dope zu rauchen. Nachdem ich diesen Laden entdeckt hatte, und A. natürlich mittendrin, zum Mobiliar gehörend, wurde er mein Aufenthaltsort in den Schulpausen der nächsten Jahre.
Einer meiner besten Freunde, eigentlich noch viel zu sehr mit der eigenen Pubertät beschäftigt, ließ sich kurz darauf mit A ein. Sie hätte es nicht nötig gehabt, und er war der Sache nicht gewachsen, aber sie verstanden sich danach noch über Jahre sehr gut. Trotz der Peinlichkeiten, die damals unweigerlich passiert sein müssen.
Bei einer klassenübergreifenden Bildungsreise in die Bundeshauptstadt am Rhein stellten wir fest, dass ich der einzige war, der halbwegs vernünftige Joints drehen konnte und sie die einzige, die etwas zu Rauchen dabei hatte. Doch nicht nur das schweißte uns zusammen.
Keine Frage, sie sah auch damals schon toll aus: Gross – grösser als ich, was keine grosse Kunst ist. Kastanienkulleraugen mit einem gewaltigen Schalk hinter dem Vorhang, eine markante Nase und perfekte Lippen. Aber die unbestritten vorhandene erotische Spannung überliessen wir unserem Unterbewusstsein; wir redeten lieber über Gott und die Welt und Nietzsche, womit sich ersterer dann erledigt hatte. Sie war schliesslich mit meinem besten Freund zusammen, später dann mit einem kleinen Punk aus Bremen. Und auch ich hatte irgendwann mein Highschool Sweetheart gefunden.
Wir bauten etwas auf, dem der Begriff Freundschaft schlecht aufzudrücken ist. Wir steckten beide in Teenager-Beziehungen. Wir wollten zusammen keine sexuellen Herausforderungen annehmen, sondern geistige. Es war eigentlich von unserem ersten langen Gespräch an immer so, dass wir uns Wochen und Monate nicht über den Weg liefen, oder wenn, dann aneinander vorbei, um dann zum richtigen Zeitpunkt aufeinander zu treffen, an dem alles ist, als wäre nichts gewesen.
So ging das wohl etwa ein Jahr: Hier und dort traf man sich, fuhr zusammen zu Konzerten, an den Strand oder in die Indiedisco im Nachbarort. Dann kam die Oberstufe und damit zwei entscheidende Änderungen, auch was A. und mich betraf: Dank des Kurssystems hatten wir jetzt wieder zusammen Unterricht. Und wir bekamen einen Austauschschüler aus Washington, DC. Der zufällig am gleichen Tag Geburtstag hatte wie ich. Die magischen Momente begannen.
Ich weiss nicht mehr genau, wie und wann sich unser Dreierbund gründete. Wahrscheinlich war es an dem Abend, als wir uns zusammen den Doors-Film anschauten. Im sogenannten Kino-Klub, weil es kein Kino mehr gab in unserer Stadt.
Wir waren die jüngsten Mitglieder dieses Klubs, fühlten uns aber sehr wohl dort: Die Atmosphäre, gerade bei dem flackernden Projektorenlicht, war in den Räumen des mittelalterlichen Kontorhauses einfach einzigartig, vor allem wenn dazu eine Buñuel-Reihe lief, oder eben der Doors-Film.
Wir waren alle drei restlos begeistert von dem Film, liefen auf die Straße und genossen den Regen des ausklingenden Sommers. Als er uns nicht mehr genügte, weil er sich langsam verabschiedete, legten wir uns auf die umgischtete Mole und erwarteten zusammen den Sonnenaufgang. Wir redeten und rauchten und tranken und schwiegen die ganze Nacht durch.
Wir zeigten C. die Stadt, vor allem die dunklen Ecken. Wir zeigten ihm das Land und den Strand, voller unglaublich schöner Ecken. Und natürlich Berlin. Von dort ging auch der Flieger, der ihn nach einem Jahr wieder zurück nach Hause brachte. Er hasste den Abschied, deswegen wollte er ihn vermeiden. Klammheimlich hatte er sich aus dem Staub gemacht. A. rief mich aufgeregt an, wir müssten unbedingt nach Berlin. Wir liessen mit voller Unterstützung unserer Eltern die Schule sausen und versuchten, in brennendem Eifer, mehr Details über C.s Verbleib in Erfahrung zu bringen und eine Transportmöglichkeit nach Berlin zu organisieren. Von einer Unterkunft ganz zu Schweigen. In Ostberlin war das Telefonnetz immer noch sehr löchrig.
Der Flug sollte in zwei Tagen gehen und C. wohnte solange angeblich in einer Jugendherberge. Was aussichtslos klingt und uns auch so vorkam, ist doch gar nichts im Vergleich zu heute, wo es hunderte Hostels in Berlin gibt: Das Deutsche Jugendherbergswerk betrieb damals maximal fünf Filialen in der ehemaligen und zukünftigen Hauptstadt. Zur Not würden wir die eben alle nacheinander abklappern. Das Schicksal schien uns schliesslich wohl gesonnen: Wir hatten noch zwei volle Tage Zeit, und der grosse Bruder besagten Freundes, der mit seinen Kunsthochschulfreunden gerade zur Sommerfrische hier war, wollte am nächsten Morgen mit der ganzen Truppe zurück nach Berlin fahren, in dem orangebunt angemalten Toyotaklapperbus, der uns schon bei diversen Roskildefahrten gute Dienste geleistet hatte. Da waren noch zwei Plätze frei, genauso wie in seiner Wohnung in Prenzlauer Berg. Das war doch schon mal ein guter Anfang!
Es war eine der vergnüglichsten Autofahrten, die ich je erlebte. A. und ich waren aufgeregt und aufgedreht, ihre sonst so abgeklärte Fassade hatte sie zu Hause gelassen. Die Kunststudenten kümmerten sich rührend um uns, so dass wir schon nach einer halben Stunde komplett zugekifft waren. Jemand kam auf die grandiose Idee, vor der Autobahn doch noch mal schnell in die Ostsee zu springen. Sie war kalt, wir waren nackt und die Villen in Heiligendamm waren noch grau und verfallen. Etwas ausgenüchtert ging es weiter, und je näher wir Berlin kamen, desto grösser wurde die Ernüchterung: Was, wenn die Jugendherbergsdrachen uns keine Auskunft geben würden? Wo sollten wir anfangen zu suchen?
Als wir die Stadtgrenze passierten, vorbei an dem Bär, war schon längst Ruhe eingekehrt im Bus, der Kunststudentenspass machte müde. A. saß neben mir und hatte ihren Kopf an meinen gelehnt, wir teilten uns einen Kopfhörer und schauten zusammen aus dem Fenster in die Stadt, in die wir von Westen her kommend einfuhren. Seit gut einer halben Stunde schwiegen auch wir, gemeinsam, und hörten das Mixtape, das C. uns dagelassen hatte. Die erste Seite der schwarzen 90er-BASF-Kassette war so gut wie zu Ende, Fleas Gitarre läutete den letzten Song ein. Es sollte für eine Weile unser Song werden. Beim ersten Refrain standen wir an einer grossen Ampelkreuzung gleich hinter der Autobahn, es war Rot und direkt neben uns sass C. verträumt auf einer kleinen Mauer. Wenn das kein verdammtes Zeichen war, in einer Dreieinhalb-Millionen-Stadt!
Nachdem er sich wortreich entschuldigt und erklärt hatte mussten wir ihm versprechen, ihn wenigstens nicht zum Flughafen zu bringen. Dann genossen wir die letzten verbliebenen Stunden in vollen Zügen, nahmen alles mit, was die Gegend zwischen Senefelder Platz und Hackeschem Markt uns damals bieten konnte, und das war mehr, als wir vertrugen. Wir waren noch nicht mal ganz volljährig, genau genommen, und C. musste back home dann ja sogar noch drei Jahre mit dem Trinken warten, offiziell. Am Ende dieser langen Nacht war uns dreien klar, dass diese Trennung unsere Verbindung nicht kappen können würde und dass wir, wenn irgendwie möglich, alle nach Berlin gehörten.
Wo ich dann ja auch zwei Jahre später landete. Zwischendurch hatte ich C. besucht, was für uns beide überraschend und plötzlich kam, aber eine andere Geschichte ist. Nach Berlin würde er es jedenfalls in absehbarer Zeit nicht schaffen. A. dagegen war sich dessen nicht so sicher.
Auch wenn wir schon alleine durch die räumliche Trennung eher in einer Off-Phase waren, sahen wir uns doch ab und zu hier und da. Inzwischen war sie mit einem kleinen, sehr sympathischen schwedischen Punk zusammen, den sie im Hafen auf seiner Jolle aufgesammelt und mit nach Hause genommen hatte. Kurz bevor das zweite Semester anfing, bekam ich einen Anruf von ihr: Rate mal! Schallte mir ihre Stimme entgegen, ganz aufgedreht.
Sie hätte sich dann doch dazu durchgerungen, hat sich an der TU eingeschrieben und – das Beste überhaupt – eine Wohnung gleich um die Ecke, in der Rykestrasse. Dort und bei mir in der Christburger hatten wir zwei schöne Sommer und einen kalten Winter, bevor sich unsere Wege auch in Berlin langsam auseinander bewegten. Ich hatte mir den Politkram aufgehalst – und dann war da ja auch noch eine neue Frau an meiner Seite aufgetaucht. Die A. und mich allerdings auch wieder auf eine absurde Art verband: Sie kannten sich nämlich vom Sehen, von vor fünf Jahren circa, als A. mit dem Bremer Punk den westdeutschen Norden unsicher machte. Als die beiden das herausfanden, hatte ich erst mal stundenlang nichts zu sagen, und auch sonst kamen wir eigentlich alle gut miteinander klar. Wir beschlossen sogar, auf unsere alten Tage (wir waren damals noch nicht einmal Mitte 20) noch mal auf ein Festival zu fahren, so wie früher – also bis vor zwei Jahren – mit Roskilde. Zu dritt machten wir uns im kleinen blauen Fiesta auf den Weg nach Bocklemünd.
Da wir auf der Fahrt circa. elf Stunden zusammen in der Hitze verbrachten, leider meist stehend und somit ohne jeglichen kühlenden Fahrtwind, gingen wir auf dem Festival dann erst mal getrennte Wege, bevor wir uns bei den wirklich guten Konzerten und am Abschlussabend dann sowieso wieder in den Armen lagen: Selbst bei Danzig, Rancid und Monster Magnet, bei Portishead und PJ Harvey sowieso.
Ganz undramatisch eigentlich, das mit den Wegen, auch als wir wieder zurück in Berlin waren. Ausserdem kreuzten sie sich ja auch wieder: A. landete irgendwie recht schnell im Schwarzenberg-Umfeld, Berlin Mitte. Dort gab es durchaus nette Leute, auch ein paar Berührungspunkte. Doch mein Mitte war woanders. An der Uni, in den selbstverwalteten Läden mit weniger Künstlern und mehr Spinnern. Wenn man das so sagen kann. Einer von diesen Leuten war so nett zu ihr, dass sie mich eines Tages anrief und meinte, sie hätte eine grosse Bitte.
Es hatte wieder mit einer Autofahrt zu tun. Der sympathische schwedische Punk war immer noch aktuell, was sich unbedingt ändern sollte. Sein Besuch stand buchstäblich vor der Tür, seine Band war gerade dabei, ihre Polentournee zu beenden, dann wollte er nach Berlin kommen. Doch dort, hinter dieser Tür, lebte A. inzwischen mit einem anderen aufstrebenden Musiker und Puppenspieler mehr oder weniger zusammen. Also mussten wir unbedingt – an diesem Abend noch – ins tiefste polnische Hinterland, ich glaube es war Łódź, um dem armen, sympathischen schwedischen Punk die Situation zu erklären. Dummerweise hatten wir beide am nächsten Tag relativ früh wieder in Berlin irgendwelchen Verpflichtungen nachzukommen.
Nach einer unspektakulären Hinfahrt und einer alternativen Stadtführung durch die örtlichen Punks (Schau, hier haben wir die Hakenkreuze übermalt. Und hier. Und da drüber haben wir letzte Woche ordentlich auf die Fresse bekommen. Und in dem Haus dort hinten ist letztens [Polnischer Punkername] verreckt.) ging es dann am Abend im Jugendklub hoch her. Das Publikum war unglaublich jung, unglaublich begeistert, unglaublich aggressiv und unglaublich trinkfest. Wenn sie etwas gar nicht duldeten, dann, dass man nicht mittrank. Dass wir kein Interesse an ihren Schnüffeltüten hatten war die eine Sache, aber Wodka durfte hier keiner ablehnen.
Nach einigen Stunden und zwei Tumulten – einer wegen des Gerüchts eines bevorstehenden Naziüberfalls, der zweite, als A. dem Schweden erklärte, wie die Lage ist, und er zornig darauf bestand, trotzdem wie vereinbart (nicht mit mir, im Übrigen) noch in dieser Nacht mit nach Berlin zu kommen – saßen wir dann schliesslich stumm, wütend, fertig, ausgelaugt, durchgeschwitzt und betrunken zu dritt im Auto. Irgendwo hinter uns musste demnächst die Sonne aufgehen und wir hielten an der nächsten Raststätte, um Kaffee zu besorgen.
Bei der Gelegenheit sammelten wir einen verloren herumstehenden Polen ein, der nicht nur wie bestellt und nicht abgeholt aussah, sondern auch vorgab, es zu sein: Am nächsten Rastplatz würde sein LKW stehen und ein Kollege hätte ihn versetzt. Mir war ein weiterer Passagier ganz recht, die Stimmung im Auto war sowieso nicht die beste. Doch noch bevor wir den Parkplatz erreichten, wurden wir aus dem Verkehr gezogen. Vorher blitzte es kurz und der Pole meinte nur: Nicht gut.
Die Situation war brenzlig, vor allem, da wir zusammen gerade noch 30 Mark hatten, der Rest war im Tank verschwunden. Und sie wurde noch brenzliger, nachdem ich in das Alkoholtestgerät der polnischen Polizei pusten durfte. Da sich unsere Vergehen inzwischen auf grob 200 DM beliefen und wir auch ansonsten einen suspekten Eindruck machten – Es war halb sechs morgens mitten im polnischen Nirgendwo, A. war noch nicht in Berlin gemeldet, ich schon, dazu noch ein polnischer Trucker und ein fertiger schwedischer Punkmusiker, der steif und fest behauptet, gerade von einem Konzert zu kommen, aber weder eine Band noch Instrumente dabei hat – wurde bewogen, uns auf irgendeine Wache zu bringen, genauer zu überprüfen und zumindest den Fiesta als Pfand zu beschlagnahmen.
Bis Berlin waren es noch 200 Kilometer und A. musste um 9 Uhr in dem Mittecafé sein. Wir waren verzweifelt. Zum Glück verzweifelten daran dann die polnischen Polizisten, und ausserdem half uns das inzwischen auch bei polnischen Polizisten verbreitete kapitalistische Weltbild aus der Bredouille: Das ganze Prozedere und Hin und Her hatte sich schon gut eine halbe Stunde hingezogen, als den beiden Beamten auffiel, dass sie in dieser Zeit durch die geschickt platzierte Radarfalle genau die von uns geforderten 200 DM eingenommen hatten, durch zahlungskräftigere Opfer als uns. Da augenscheinlich bei uns wirklich nichts zu holen war ausser einer Menge Umstände und Scherereien, besann sich der Chef der beiden und gab mir meine Papiere mit den Worten Polnische Polizei gute Polizei zurück. Der LKW-Fahrer konnte es auch nicht fassen, er meinte, für ihn hätte das locker ein halbes bis ein Jahr Fahrverbot gegeben. Um halb neun kamen wir völlig erschöpft in Berlin an.
Diese Fahrt sollte unser letztes grosses gemeinsames Abenteuer gewesen sein. Die verschiedenen Welten, in denen wir uns inzwischen bewegten, trafen einfach zu selten aufeinander, selbst wenn wir die Welten wechselten. Ich verabschiedete mich vom Politbetrieb, zog nach Kreuzberg und versuchte mich in so etwas wie Familiengründung. A. lud uns noch ab und zu zu Auftritten des Puppenspielers ein, erst im Wohnzimmer, dann auf immer grösseren Bühnen. Auch er war ein wirklich netter und ziemlich schüchterner Kerl. Sie hatte da ein gutes Händchen und auch ein gewisses Muster entwickelt, inzwischen.
Die magischen Momente waren noch nicht ganz vorbei. Als wir uns nach einer längeren Pause wieder trafen, stellte sich heraus, dass A. auch nach Kreuzberg gezogen war, drei Häuser neben meine damalige Stammkneipe. Und wir hatten beide bei der gleichen verdammten Naturkatastrophe jeweils neugewonnene Freunde verloren. Ein paar mal trafen wir uns noch, A. hatte die Mitte-Szene und den Puppenspieler inzwischen verlassen und sich in Kreuzberg mit kontroversen kanadischen Expat-Musikern (das Muster!) eingelassen. Ich fing an, nach Westen zu pendeln. Und dann kam irgendwie der Sand, in dem alles verlaufen ist.
***
Wie ich nun darauf komme, wo das doch schon so lange her ist, fragt man sich vielleicht, falls überhaupt jemand bis hier her durchgehalten hat und sich noch was fragen kann. Das ist ganz einfach: Das Internet ist schuld. Klar, wer sonst?!
Eigentlich wollte ich diesen Text auch Berlin Mitte hat mir meine Freundin geklaut nennen, ganz internetadäquat zwar, aber eben nicht ganz wahr. In dessen unendlichen Weiten stolperte ich nämlich über einen zehn Jahre alten Film, der mich in ebendiesen alten Erinnerungen schwelgen liess und mir bisher komplett durch die Lappen gegangen war. Unerklärlich eigentlich, umso mehr zog er mich jetzt in seinen Bann. Es geht ungefähr um die Berlin-Mitte-Szene, in die A. abtauchte, und zwar genau zu der Zeit, als ich sie langsam aus den Augen verlor. Als es diese Szene auch schon nicht mehr gab und sie nur noch nostalgisch betrachtet wird. Keine Ahnung, wie ich diesen Film bei der Berlinale übersehen konnte.
Und jetzt, gut zehn Jahre später, zeigt er mir dreierlei: Dieses Mitte war wirklich verdammt vielfältig damals in den 90ern, und ich war viel öfter dort als ich eigentlich dachte (und jetzt schon ganz lange nicht mehr, seit dem Baizumzug spätestens). Zum Zeitpunkt der Interviews gab es dann einen Abgesang (von einigen), den man im nächsten Sommer (vor drei Jahren/mindestens aber schon gestern) gut zu Kreuzkölln halten könnte. Wobei es interessanterweise 2003 teilweise komplett nach Untergang und Langeweile klang, da schien die weltweit angesagteste Stadt noch nicht nur selten am Horizont durch, da wurde von London, New York und Paris meist noch ehrfürchtig gesprochen. Wer weiss, welche Zukunft es ist, die wir beim derzeitigen Abgesang noch nicht erkennen können. Und Drittens: Schade.
PS. Viertens: Ken Jebsen vor zehn Jahren. Damals schon scheisse, wie mir wieder bewusst wurde. Aber noch nicht so erschreckend durchgeknallt wie heute – oder etwa Xavier Naidoo, schon vor fünfzehn Jahren.
So kam es also, ich schaute mir diesen Film an, die Erinnerungen kamen hoch und ich dachte so bei mir: Eigentlich wäre meine Freundschaft mit A. eine eigene Geschichte wert, vielleicht sogar ein Buch. Und dann dachte ich: Wo ich so darüber nachdenke, warum nicht gleich damit anfangen? Wenigstens in groben Zügen, ein paar Skizzen, bevor ich es vergesse (ich habe schon viel zu viel vergessen, wie mir dabei auffiel). Und genau dafür ist dieses Blogding doch da (so, damit hat sich der Ein Jahr und etwas über 100 Beiträge-Artikel auch erübrigt).
Let it Rock! Von Frank Künster, 1h16min, 2003.
[vimeo http://vimeo.com/104087404]