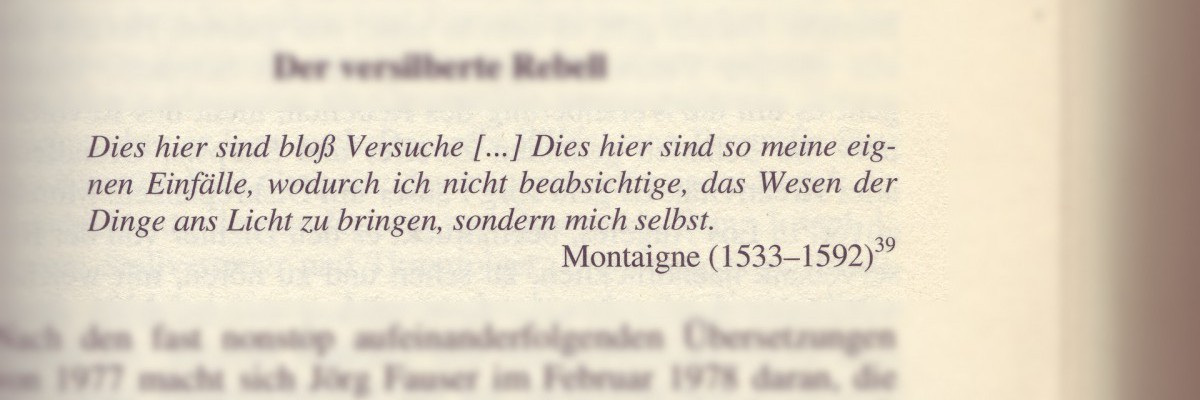[Teil 1 hier; aller guten Dinge sind drei, das Finale lässt noch auf sich warten]
Midtro:
Für das Wahre, Schöne, Gute
will jeder gerne bluten
und fühlen,
was es zu fühlen gibt…
– Alltag-
An dem Abend bei Charly in der Kneipe erfuhren wir auch, was es mit dem alten Mann auf sich hatte, der so gut wie jeden Morgen pünktlich um neun mit seinem Uralt-Kadett ankam und in dem kleinen Kabuff im Erdgeschoss verschwand. Er hatte dort mal einen Laden und wohnte bis nach dem Krieg auch in dem Haus. Er war locker über 80 und wurde mit der Zeit auch immer wackeliger auf den ohnehin schon durch Krücken verstärkten Beinen. Ab und zu kamen wir ins Gespräch und eines Tages brachte er diesen Riesenstapel Fotos und Postkarten mit – unser Kiez zwar, aber so kannten wir ihn nicht, dafür waren wir viel zu jung: Wasserwege, die längst zugeschüttet sind, Gasometer, die nicht mehr existieren und Kirchen, die zerbombt wurden. Irgendwann kam er dann allerdings nicht mehr so regelmässig, und dann gar nicht mehr.
Mit Kleingewerbe sah es auch sonst eher schlecht aus in unserem Block. Ein paar Häuser weiter gab es mal einen schlechten Pizza-Lieferservice, der schnell wieder zumachte. Einige Monate später eröffnete ein Videospielverleih in denselben Räumen, der sich erstaunlich lange hielt und von den ortsansässigen Jugendlichen begeistert frequentiert wurde, bis er einem Bäcker weichen musste. Dieser wiederum kam uns sehr entgegen: Wir konnten endlich mal ausprobieren, wie es aussehen würde, wenn der Hund wie im Klischee die Brötchentüte nach Hause trägt, es waren ja nur ein paar Meter. Dann wurde aber der Schwamm unter dem kompletten Häuserblock entdeckt, und eben auch im Gemäuer des Bäckerkellers, und das ging natürlich gar nicht. Dafür trat der Puff, der fünf Häuser weiter in der anderen Richtung lag und über den schon lange gemunkelt wurde, den offensiven Weg nach vorne an und hängte neben dem verstohlen blinkenden Herz im Fenster auch eine Leuchtreklame über die Tür. Die Geschäfte scheinen gut zu laufen, nur der Kronleuchterladen, den es auch noch gibt, hält sich genauso lange.
So zogen die Jahre auch in unserer immer weniger neuen Kreuzberger Heimat ins Land und neue und alte Nachbarn ein und aus. Nach den Polen war es unser direkter Nachbar, der nach Connewitz zog, was eine zeitlang sehr angesagt war unter Berlinern, die Flucht aus der grossen, hässlichen Stadt nach Sachsen. Kurz darauf verschwanden dann wie schon erwähnt die Dealer aus dem Dritten. Dafür kam ein sehr angenehmer Münchener dazu, der später mit seinem kleinen Bruder dort eine WG aufmachte. Madame und ich holten die Hundegrosseltern aus der O-Strasse ins Haus, später zog noch ein weiteres befreundetes Pärchen in die Wohnung der Musiker-WG.
Wir studierten mehr oder weniger vor uns hin, machten mehr oder weniger gute Nebenjobs und genossen so gut es ging unsere besten Jahre. Der Hund war viel zu schnell erwachsen geworden und irgendwann fanden wir sogar – nach ein paar handvoll Versuchen – für den mindestens jährlichen Dänemark-Hundeurlaub im stürmischen Februar den idealen Ort im Nirgendwo inmitten der Dünen. Natürlich hatten wir den Fiesta inzwischen standesgemäß durch einen schönen alten eckigen Volvo ersetzt. Schon allein wegen dem Hund, ohne den bräuchte man in Berlin sowieso kein Auto (und keine Urlaube in Dänemark). „Oh, die Dame hat extra Lippenstift für mich aufgelegt!“ spottete der Tierarzt süffisant, als wir ihn im ersten Kohleofenwinter besuchten, weil der Hund unbedingt die heisse, gusseiserne Ofentür beschnuppern musste.
Die Kreise, in denen wir uns bewegten, wurden immer kleiner, der Kiez und auch Berlin sind irgendwann durcherkundet, was eher daran liegt, dass man genügend angenehme Orte gefunden hat, als dass es nichts Neues mehr geben würde. Jedenfalls lagen die Koordinaten unseres gedanklichen Stadtplans inzwischen zum größten Teil in Kreuzberg, aber auch die althergebrachten in Mitte und Prenzlauer Berg wurden noch regelmässig besucht. Ansonsten kamen auf dem Berlin-Plan in unserem Kopf nur noch sporadisch neue dazu: Der Kickermeister aus dem Bandito machte eine neue Kneipe drei Strassenecken weiter auf. Zwei andere Leute zogen noch drei Ecken weiter ihr „Wie verprass ich mein Erbe“-Experiment noch eine Nummer grösser auf. Der Eimer hatte dafür längst zu. Grunewald – wegen dem Hund und dem jährlichen Kistenrennen der Potsepunks. Durch Madames Job natürlich alles, was irgendwie mit dem wunderbaren alten Kino in der Nähe vom Zoo zu tun hatte, und das war eine Menge: Premierenfeiern hier und da, obskure Festivals und Privatvorführungen diverser cineastischer Raritäten, nicht zu vergessen der hundertste Geburtstag des Chefs, der noch jeden Tag ins Büro kam, und zum Leidwesen seiner Angestellten auch regelmässig ans Telefon ging.
Stattdessen fuhren wir in der Weltgeschichte rum, sobald sich die Möglichkeit dazu bot: Kuba wie gesagt war die erste gemeinsame Reise, Dänemark jedes Jahr nach der Berlinale, mindestens. Der Band, in der Madame Schlagzeug spielte, ging die Gitarristin in Richtung Südafrika abhanden, was uns ein paar schöne Zeiten in diesem tollen Land bescherte. Der ehemalige Mitbewohner aus der O-Strasse hatte sich und seinen berechtigten Ärger gefangen und arbeitete inzwischen in Amsterdam, was uns als Stadt ebenso begeisterte wie Tel Aviv. Kurz gesagt: Es war eine tolle Zeit, aber es war klar, dass es nicht ewig so weitergehen konnte.
Doch bevor es sich richtig änderte, wurde es erst noch mal richtig besser: Madam steckte mitten im Examensstress, als ich mich entschied, vielleicht doch zurück an die Uni zu gehen und die letzten Scheine zu machen, die Umstände boten diesen Schritt geradezu an. Das Problem war allerdings, dass wir recht schnell bemerkten, dass ein gemeinsam genutztes Arbeitszimmer keinem von uns gut tat, und uns zusammen erst recht nicht. Eigentlich – trotz all der Jahre und all der Veränderungen – mochten wir dieses Haus und diese Wohnung immer noch sehr.
Sicher, viele Leute waren ein- und ausgezogen in der Zeit, und zugegeben: es hat sich nicht unbedingt zum Besseren gewandt. Irgendwann hörten die Hofpartys auf, irgendwann zogen neue Nachbarn ein, die selbst wir „die Jugendlichen“ nannten. Von den ursprünglichen Bewohnern – denen, die da waren als wir hier einzogen – waren nicht mehr viele übrig, und vor allem wenige, die zu richtigen Freunden geworden sind. Darüber hinaus, wenn man ehrlich ist: Nach zehn Berliner Wintern, einige davon mit sibirischen Ausmaßen, reicht es auch mal mit der Kohlenheizung. Wobei es gar nicht die Öfen oder das Heizen oder das Kohlen-aus-dem-Keller-schleppen war – das Nervigste war die Asche, die überall rumfliegt. Die Kombination aus der flauschigen und unglaublich dichten Husky-Unterwolle des rekordverdächtig haarenden Hundes und der feinen Asche killte ungefähr einen Staubsauger pro Jahr. Und ausserdem wurde in der letzten Zeit ständig die Strasse aufgerissen und mindestens zur Hälfte gesperrt, oder ein geplatztes Wasserrohr aus dem vorletzten Jahrhundert erledigte diesen Job, oder die BVG erneuerte die Hochbahnschienen. Irgendwas war immer.
– Durchbrüche, Umbrüche –
Erstaunlicherweise gab es – wir sind irgendwo in der zweiten Hälfte der sogenannten 00er Jahre – selbst zu dieser Zeit Wohnungen, die unseren Vorstellungen von Grösse, Lage und Bezahlbarkeit entsprachen, sogar in der Nähe, denn den Kiez wollten wir nicht unbedingt verlassen. Allerdings schafften wir es nicht, auch nur einen einzigen Besichtigungstermin zu absolvieren, vielleicht hätten wir ansonsten damals schon die Vorläufer der inzwischen berühmt-berüchtigten Wohnungscastings hautnah erleben können.
Der Grund dafür war recht simpel: Wir blieben doch im Haus. Überraschenderweise zog die WG aus dem Musikerumfeld, die sich nebenan eingerichtet hatte, nachdem der Nachbar gen Sachsen aufbrach, in die ehemalige Drogenhölle. Der Münchner war dabei, der Frankfurter, der manchmal nachts auf dem Balkon Kontrabass spielte auch, insgesamt also alles nette Leute. So nett, dass sie uns fragten, ob wir nicht die Wohnung haben wollten – sie hatten von unseren Plänen gehört und sie nicht gerade goutiert. Nun hatte ihre Wohnung aber auch nur drei Zimmer und eine etwas größere Abstellkammer, ausserdem war der Grundriss eigentlich ziemlich ungünstig. Es war schlauchig, das Bad war auch nicht so dolle, bis auf die Wanne, die hätten wir schon ganz gerne wieder mal genossen. Von der Küche ganz zu schweigen, die war im Grunde nicht vorhanden. Okay – zwei Arbeitszimmer wären drin gewesen, aber dafür auf unsere inzwischen optimal eingelebte und viel besser geschnittenere Wohnung verzichten?
Andererseits: Mit dem Budget, das wir für eine neue Wohnung eingeplant hatten, konnten wir uns auch beide Wohnungen zusammen leisten, wir würden damit sogar entscheidend unter der vorher festgelegten Schmerzgrenze liegen. Nachdem uns diese Idee kam, mussten wir nicht mal eine Nacht drüber schlafen – konnten wir vor lauter Begeisterung auch gar nicht – um eine Entscheidung zu treffen. Kurzerhand stellte mich die WG bei der Hausverwaltung als Nachmieter vor und wir begannen, im Kopf schon mal die neuen Räume aufzuteilen: Zwei Bäder können nie schaden, wir waren längst in der Beziehungsphase, in der man das sofort einsieht. Aus dem grossen langen Balkonzimmer würde die Bibliothek werden, mit den Flügeltüren zu meinem neuen Arbeitszimmer. Dahinter dann das zweite Wohnzimmer mit Kicker, und ganz hinten das Gästezimmer. Und als Krönung zwei Balkone! So standen meine Graspflanzen Madames Tomaten nicht mehr im Weg. Am nächsten Morgen klopften wir die Wand ab, um eine geeignete Stelle für den Durchbruch zu finden.
Allerdings leisteten wir uns diesen Luxus keine drei Jahre. Immerhin gab es so noch zwei legendäre Partys, eine zum Einzug und eine, als wir die zweite Wohnung wieder aufgaben und den Durchbruch wieder zumachten. Madame war mit dem Studium fertig und fing an, sich einen Referendariatsplatz zu suchen, was aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in Berlin passieren würde. Und ich war mal wieder in einer veritablen Krise. Wie befürchtet ging es für sie ins tiefste Westdeutschland, während der Hund und ich zusahen, wie wir alleine in Kreuzberg und vor allem auch mit der Pendelei klarkamen. Es war keine Frage, dass der Hund erst einmal bei mir blieb, schon allein, weil ich viel mehr Zeit hatte, und die Ein-Zimmer-Einliegerwohnung irgendwo auf dem Acker kurz vor Holland wäre für die Hundedame auf Dauer auch nicht so toll gewesen. Obwohl ihr die frisch mit Mist und Gülle gedüngten Felder ausserordentlich gut gefielen.
So richteten der Hund und ich uns neu in Berlin ein, aber trotzdem wurde ich den Eindruck nicht los, dass etwas fehlte, dass etwas weg war, dass das Leben in der halben, ganzen Wohnung ab und zu mal einen Phantomschmerz-Stich verteilte, wie es nach einer Amputation nun mal oft so ist. Und das lag nicht nur daran, dass uns ein paar Zimmer abhanden gekommen waren. Wir schlugen die Zeit in Kneipen und den wenig übrig gebliebenen Hausprojekten tot, gingen stundenlang am Kanal und fast täglich im Grunewald spazieren, aber eigentlich warteten wir nur darauf, dass Madame uns besuchen kam. Da dies immer seltener passierte, liess ich den Hund immer öfter übers Wochenende bei den Hundegroßeltern, die inzwischen längst in den Wedding gezogen waren, und fuhr mit der Bahn gen Westen. Berlin war selten so uninteressant für mich wie in dieser Zeit, obwohl ich tun und lassen konnte, was ich wollte. Überhaupt etwas zu tun war aber in dieser Zeit das Schwierigste für mich, zum Glück war der Hund da, der seinen geregelten Tagesablauf einforderte, und ihren braunen Kindchenschema-Augen konnte ich selbst im dunkelsten Tal keinen Wunsch abschlagen. Als ich dann anlässlich irgendeines Jubiläums an die Uni geladen wurde, um von der guten alten Zeit zu erzählen, merkte ich, dass eine Veränderung jetzt vielleicht nicht das schlechteste wäre. Obwohl es mich natürlich freute, die ganzen anderen Veteranen mal wieder zu sehen.
Es wäre uns trotzdem nie in den Sinn gekommen, damals, die Berliner Wohnung aufzugeben. Aber sie hiess eben inzwischen auch nur noch „die Berliner Wohnung“. Nachdem Madame die Qualen des Referendariats hinter sich gelassen hatte und sogar übernommen wurde, machten wir uns wieder mal auf Wohnungssuche – oder besser gesagt: Mal wieder sie alleine, obwohl wir wenig später gemeinsam einziehen würden. Da Madame in Berlin Jahre auf eine Stelle hätte warten müssen, die dann auch noch viel miesere Konditionen gehabt hätte – dit is Balin – war klar, dass unsere Zukunft woanders stattfinden würde. Ich war zu dieser Zeit sowieso mal wieder viel flexibler als mir lieb war, und so suchten wir uns eine passende Grossstadt – das musste schon sein, das brauchten wir beide – in der Gegend aus, die Auswahl war hier zum Glück recht gross. Ausserdem konnten wir so aus Jux Briefköpfe mit zwei wichtig klingenden Adressen anlegen, genau wie diese ganzen wichtigtuerischen Jungliteraten der Jahrtausendwende, die wir halb verachteten und halb bewunderten.
In der Gitsch räumten wir zwei Zimmer komplett leer und packten alles, was übrig blieb, in das dritte, das ehemalige Schlafzimmer mit dem Podest, was nach hinten raus ging. Dazu holten wir noch ein paar Bohlen und Bretter von Holz-Possling und bauten ein Hochbett – ausreichend für ein paar (hoffentlich regelmässige) Stippvisiten in der alten Heimat, dachten wir. Ausserdem hatte ich noch einige Termine im nächsten Jahr in der Stadt zu absolvieren – aber unser neues, gemeinsames Zuhause war jetzt definitiv woanders. Es stimmte schon, tief im Westen, wo die Sonne schon lange nicht mehr verstaubt (und ausserdem um einiges später versinkt und es im Winter sehr viel milder ist), ist es viel besser, als man glaubt. Madame hatte grosse Freude daran, das Nest zu bauen: Es war alles perfekt aufeinander abgestimmt und kam ganz ohne Ikea aus. Selbst der Hund gewöhnte sich, trotz ihres Alters, erstaunlich gut an die vielen Treppen – dafür wartete oben ein schöner flauschiger Teppich, so was gab es in der Kreuzberger Studentenbude natürlich nicht.
Bei der machte sich wiederum der gute Schnitt bezahlt: Wir hatten zwei separate Zimmer, die wir untervermieten konnten, noch dazu mit guten Kachelöfen (in den meisten anderen Wohnungen im Haus waren die inzwischen mit preisgünstigen, blöden Allesbrennern ersetzt) und einer komplett eingerichteten Küche samt Geschirrspüler und Waschmaschine, natürlich ganz zu schweigen von dem trotz allem immer noch angenehmen Haus. Weil Madame in der Ferne den Neustart organisierte, übernahm ich die Hin- und Herfahrerei und das Casting. Dummerweise hatten wir die Entscheidung recht spontan getroffen und keiner unserer Berliner Bekannten hatte jemanden zur Hand, der gerade eine Wohnung suchte. Jedenfalls nicht so eine, wir waren schliesslich alle älter geworden und die Leute arbeiteten inzwischen zum Teil im Bundestag oder ähnliches. Da will man nicht mehr mit dem Ofen heizen, den hat man höchstens noch als nostalgische Reminiszenz in der Ecke stehen. Das ging uns ja nicht anders. Aber ich hatte ja keine Ahnung, auf was ich mich da eingelassen hatte.
– Neustart, abgewürgt, Neustart –
Sicher, auch wir hatten inzwischen im Freundes- und Bekanntenkreis hier und da mal eine Geschichte mitbekommen, die von absurden Wohnungsbesichtigungen handelte. Wo der Geruch der zuvor Verstorbenen buchstäblich noch in der Luft lag, während sich dutzende Leute durch die Bude drängelten: So lange die Lage stimmte, konnte man sich so was scheinbar erlauben. Aber das waren doch irgendwie so Lagerfeuer-Schauergeschichten aus Mitte. Dachten wir. Schliesslich hatte Madame gerade erst eine mehr als passable Wohnung auf einem der teuersten Pflaster Westdeutschlands gefunden. Teuer, das muss man zugeben, in Berlin bekommst du dafür doppelt so viele Quadratmeter. Dachten wir.
Am Mittwoch setzte ich die Anzeige auf, ich sass mit dem Laptop auf dem Balkon, in der Ferne blinkte der Rheinturm in der Abendsonne und ich überlegte noch, ob es wirklich reicht, nur auf einem einzigen Portal zu inserieren, und vor allem, ob der Besichtigungstermin am Wochenende nicht zu knapp gewählt war. Die nächsten Tage verbrachte ich dann damit, stündlich mein Postfach zu leeren und unzählige Mails zu beantworten, die meisten davon auf Englisch, aber nicht wenige waren auch nur in Spanisch geschrieben. Am Samstag durfte ich an die 50 hellauf begeisterte Interessenten durch die Wohnung lotsen und jedes Mal den gleichen Text aufsagen, obwohl ich die Anzeige schon nach einem Tag wieder aus dem Netz genommen hatte.
Die Auswahl war also recht gross, und am Ende ist es dann doch die sprichwörtliche Schwäbin geworden, man mag es kaum glauben. Ihr Argument war – neben ihrer sympathischen Art an sich – allerdings auch schlagend, bei uns jedenfalls: Sie suchte schon seit Monaten, allein der Hund, dieser wirklich freche (sprich nicht erzogene) Australian Shepherd, den sie im Schlepptau hatte, machte es ihr recht schwer. Da wollten wir nicht im Weg stehen, Madame hatte ja auch einige Schwierigkeiten gehabt, unsere alte Hundedame in der neuen Heimat mit ins Boot zu holen. Die Sache wurde mit einem formellen Untermietvertrag offiziell gemacht, alle waren überglücklich und am Montag war ich wieder zurück am Rhein.
Das nächste halbe Jahr verbrachten wir damit, uns einzuleben und die neue Stadt – ach was sag ich – die neue Welt kennen zu lernen. Ein Ballungsraum ballte sich an den nächsten, von Ort zu Ort veränderte sich der Menschenschlag und die Grenzen der Nationalstaaten, die hier teilweise mitten durch die Dörfer verliefen, nahm man wirklich nur beiläufig wahr. Wir begannen, uns wohl zu fühlen und einzufügen. Gut, Karneval ging für uns Norddeutsche gar nicht, und das war ein grosses Hindernis bei der Assimilation. Aber ansonsten klappte es meistens ganz gut.
Doch ab und zu gab es einen empfindlichen Stich, vor allem, da ich in den ersten Monaten noch wirklich oft nach Berlin fuhr, zumal mittlerweile die komplette Familie hier wohnte, über die ganze Stadt verstreut. Was für eine Ironie: Endlich waren wieder mal alle zusammen, da ziehe ich so weit weg, wie es in diesem Land nur geht. Richtig schmerzlich bewusst wurde uns die Entfremdung von der alten Heimat, als wir einmal mit Auto und Hund herkamen für eine paar freie Tage – Pfingsten – und uns zuerst noch wunderten, dass wir keinen Parkplatz fanden und die Zufahrtsstrassen gerade abgesperrt wurden. Ist ja wie zum Karneval der Kulturen, dachten wir. Und genau so war es dann auch, das hatten wir nur absolut nicht mehr auf dem Schirm, die Verknüpfung Pfingsten-Karneval der Kulturen existierte schon nicht mehr.
Nach nicht einmal sechs Monaten wurde unserer schwäbischen Untermieterin dann langsam bewusst, dass sie das Berliner Nachtleben, was sie in vollen Zügen auskostete, am Ende viel zu vieler Nächte meist im Trinkteufel, ihre Verantwortungen als Hundebesitzerin und ihren Hammeraltenpflegejob nicht unter einen Hut bekommen würde und leider wieder zurück ins beschaulich-ländliche Baden-Württemberg gehen müsste. Was wir komplett einsahen. Da war es uns – gerade nach den Erfahrungen des letzten Castings – auch egal, dass wir eigentlich eine Kündigungsfrist von drei Monaten und eine Mindestmietdauer von einem halben Jahr ausgemacht hatten. Also spielten wir das Spielchen einfach noch mal durch, die Schwäbin hatte auch drei Interessenten an der Hand und so wurden wieder dutzende Leute durch die Wohnung bugsiert. Madame deutete an – es war ja ihre Wohnung, immer noch – dass sie im Hinblick auf die Auswahl der neuen Untermieter hoffte, dass wir uns jetzt nicht alle halbe Jahre einen Kopf um die Kreuzberger Wohnung machen müssten. Denn um ehrlich zu sein, wenn wir wieder nach Berlin zurück gehen würden, was immer noch vage im Raum stand, dann bei aller Liebe wohl nicht zurück in diese Wohnung. Sagte sie.
Von den beiden Münchenern wohnte keiner mehr wirklich im Haus, aber sie hatten es so gemacht wie wir und noch ein Zimmer in der Hinterhand behalten. Der Frankfurter wohnte inzwischen im Vierten zusammen mit einer Kanadierin und erzählte davon, dass er nach Uruguay auswandern wollte. Wir hatten eine neue Nachbarin, die wir nicht kannten und die tagelang scheinbar selbst ihre Wände verputzte, so hörte es sich an. Der Bauarbeiter wohnte immer noch über uns und lebte inzwischen ein befreites, offen schwules Leben samt Rockerkumpels. In der Wohnung der Hundegrosseltern wohnte die nächste Musiker-WG, allerdings aus einer Generation, für die Nirvana das ist, was für uns Janis Joplin und Bob Marley waren: Hätte man gerne noch selbst erlebt. Dafür kehrten die mittlerweile halbwegs berühmt-erfolgreichen Musiker aus dem vierten ab und zu wieder zurück, oder wenigstens ein paar angenehme, altbekannte Gesichter aus ihrem Umfeld. Die hatten die Wohnung also auch noch gehalten. Die Neuigkeiten aus dem Hinterhaus waren gemischt: Einiges blieb ganz beim Alten, der Juraprof mit dem alten Benz war leider gestorben und die Antifa war mit dem Studieren fertig und schwanger. Das war der Stand der Dinge, als ich mich nach einem neuen Untermieter umsah.
Auch Berlin hatte sich verändert. Das lag nicht nur daran, dass ich jetzt quasi von aussen kam und mir der Dreck und die Hundescheisse wirklich auffielen. Denn auf der anderen Seite sah es so aus, dass die halbmeterdicken Plakatschichten in den Hauseingängen in der O-Strasse inzwischen noblen Granitschildern gewichen sind, auf denen „Plakate ankleben verboten“ eingemeisselt war. Bei uns in der Strasse hatte neben dem Puff eine recht populäre und stark frequentierte Ferienwohnung aufgemacht. Und das, was da auf der Admiralsbrücke und im Görli, in den ganzen kleinen Seitenstrassen jenseits des Kanals passierte, damit hatten wir nichts mehr zu tun. Vor Jahren kannten wir die Leute hier noch und feierten zusammen mit dem Musikschrauber-Haschplattenverkäufer-Nachbarn die Eröffnung seines T-Shirt-Ladens (seine neue Berufung!), den er sich mit einem buddhistischen Kumpel teilte, der dort Räucherstäbchen, Bambuskerzen und Batikklamotten vertickte. Ihre Ladeneröffnung hatten sie günstig auf das Graefestrassenfest gelegt, so fanden sie vom ersten Tag an eine treue Kundschaft. Der Laden ist dann später in den Osten gezogen, irgendwo am Eingang vom Mauerpark lief er noch eine ganze Weile ganz gut.
Wir machten uns einen Spass daraus, die Gegend neu zu erkunden, so als ob wir auch Touristen wären, vom Kanal über die kanadische Pizzeria in der keiner Deutsch spricht bis hoch zum frisch eröffneten Tempelhofer Feld. Hätte ich noch ernsthaft studiert, wäre das eine lohnende Feldstudie wert gewesen. Dazu kamen im Stadtbild merklich mehr offensichtlich arme Menschen, übrigens selbst an den noblen Ufern des Rheins in unserer neuen Heimat. Flaschensammler. In Berlin konzentrierte sich das alles wie unter einem Brennglas. Auch wenn einige althergebrachte Ecken nicht mehr existierten: Die Abkürzung entlang der S-Bahn-Bögen, die Madame vom Zoo zu ihrem Kino immer nahm und die von den ansässigen Junkies zur Verrichtung aller möglichen Geschäfte genutzt wurde, die gab es längst nicht mehr. Dafür hatten wir jetzt ein Flüchtlingscamp vorm Brandenburger Tor und eins auf dem O-Platz.