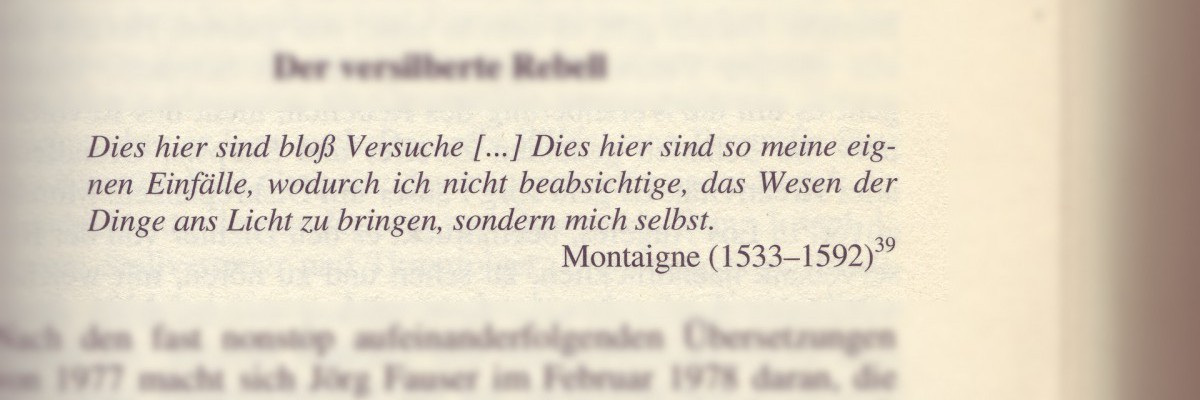Über Inspiration, das Schreiben, das (Vor)Lesen, Bücher, Filme, Musik und den ganzen Rest: Von Kriegen und Frieden, und auch vom niemals zufrieden oder je ganz fertig genug sein. Kann Spuren von Drogen enthalten.
Ein einseitiger Briefroman in Fortsetzungen
(2002-2004)
(Zur Vorrede und Teil I hier entlang.)
Datum: [März 2003]
Betreff:
Hallo M.,
vielen Dank für deine mail! und wieder mal sorry für die späte antwort. Doch ich musste leider viel arbeiten, und wenn ich dann mal den kopf frei habe, dann versuche ich zu schreiben, und wenn ich versuche zu schreiben, dann denke ich an brecht, der mal sagte, dass in solchen zeiten jedes gespräch über einen baum ein verbrechen wäre, weil damit nicht darüber geredet würde, wie viel unheil auf der welt geschieht.
Nicht dass du erschrickst, ich bin nicht auf einmal rührselig, ich habe meinen zynismus natürlich bewahrt. Gerade angesichts von medienwirksamen Massendemonstrationen, bei denen die teilnehmer am nächsten Tag mit einem super gefühl zur arbeit gehen, aber keinen blick über den tellerrand werfen, gegen einen krieg sein reicht ja, man muss ja nicht gleich gegen alle sein.
Soviel dazu, entschuldige dass ich abschweife. Aber andererseits war der erste (oder eigentlich ja mindestens der zweite) Irakkrieg 1991 für mich die erste große politische Erfahrung im freien Westen. Da kommen schon erinnerungen hoch.
Was sagst du zum Krieg? Ich fand A. hat es ja ganz gut getroffen, das thema :-). Ich habe bei der [Literatur-Website] ein wenig rumgestöbert und bin auf die neuen sachen von ihr gestossen, vor ein paar tagen (du merkst ich lebe ein wenig zeitverzögert *g*), viele grüße und meine bewunderung an sie! Naja, und dann habe ich natürlich auch mitbekommen, dass die NWO sich jetzt auch auf die [Literatur-Website] ausgedehnt hat. Ich finde langsam sollte mal ein neuer Spielplatz gebaut werden in […]irgendwashausen. Und der Osten? Ich weiß nicht, ich habe erst mal den […]-Text neu reingestellt und osten kann ja überall sein, auch im süden gibt’s ja einen Osten… Wenn sie mich drin haben wollen, dann sollen sie sich halt einen text aussuchen, ich fände es okay, kann aber auch nicht auf krampf was zu einem thema schreiben, wie gesagt, eigentlich kann ich ja gar nicht schreiben gerade :-). Wie schaut es da bei dir aus, bist du jetzt komplett zur romanautorin geworden oder zur Profi-puzzlerin?
Zum glück ist die Berlinale auch vorbei, die hat echt mit der zeit genervt, tausende von cineasten aus aller herren länder sind irgendwann mal zu viel. ich hab mir zwei drei filme angeschaut, es gab ein hommage-programm an die frühen kung-fu-filme, also noch lange vor bruce lee, das war witzig. anonsten, um auf deine frage zu antworten, schaue ich nicht alles, aber schon viel, das kommt ganz drauf an, ob ich bock habe, ins kino zu gehen. ich habe aus bequemlichkeit (oder anderen gründen – welche das wohl sein könnten…?) auch schon filme verpasst, die ich unbedingt sehen wollte, während ich mir auch schon totalen müll angeschaut habe, aus langeweile. gestern zum beispiel waren wir in catch me if you can, den würde ich mir an einem guten tag mit sonnenschein nicht mal nachmittags im fernsehen anschauen, aber für gestern abend wars ok.
Die Ferien haben jetzt gerade angefangen, obwohl wie schon erwähnt kompensiert durch längere arbeitszeiten. Klausuren muss ich zum glück nicht schreiben, ich studiere ja total altmodisch auf magister, das bedeutet drei hausarbeiten bis spätestens mai. aber das dürfte ich wohl hinkriegen. vielleicht bleiben sogar ein paar tage an der ostsee übrig, urlaub wäre mal wieder eine gute sache.
Die fragen von A. waren sehr, nun ja, amüsant passt da wohl nicht, aber so in der art. ich arbeite ja auch immer noch an meinem katalog der unbeantworteten fragen. jetzt muss ich aber leider langsam los, hier noch zum trost mein letzter schreibversuch, obwohl einiges nicht ganz neu sein wird für dich, das ist alles, wozu ich gekommen bin in letzter zeit. Aber wie du so schön sagtest, man kann ja nicht immer den supertollen text schreiben.
Übrigens: Bei einem Studentenstreik vor drei Jahren reagierte die kanadische Polizei auf die Besetzung eines Uni-Gebäudes damit, dass sie aus riesigen lautsprechern die Backstreet-Boys spielten, den ganzen tag lang. Unter diesem Aspekt sollte doch darüber nachgedacht werden, ob man UN-Waffenkontrolleure mal ins Studio von Dieter Bohlen schickt, oder?
Hier mein Text, und noch einen schönen Tag!
Bis bald
S.
Datum: [März 2003]
Betreff:
Hallo M., arme M., böse M.!
musst du mich daran erinnern, dass die Semesterferien nur 2 Monate dauern ?! *g*. Aber im Ernst, du tust mir Leid, auch du scheinst nicht viel davon zu merken, dass ja eigentlich Ferien sind. Blöde Hausarbeiten. Allerdings habe ich ja glücklicherweise schon die passenden Referate gehalten, so dass ich hochmütig davon ausgehe, schon jeweils 70 % der Hausarbeit zusammenzuhaben mit dem dafür angehäuften Wissen. Und außerdem gibt es durchaus Dozenten bei uns, die sagen „wann Sie die Hausarbeit abgeben ist mir egal, hauptsache ich bin noch nicht pensioniert.“ Daher lasse ich es wie gesagt gerade eher ruhig angehen. Wo studierst du eigentlich, hast du mir das schon verraten? in frankfurt, oder? das ist doch auch so ein netter heimeliger massenbetrieb, oder?
Ich hatte in letzter Zeit glücklicherweise wieder das vergnügen, zu leben, also zu schreiben (bei interesse schau auf meine neuigkeiten-seite, und das ist noch lange nicht alles…), zu lesen (einen Essay-Band von Jörg Fauser, sehr gut!) und mich unter menschen zu begeben. Und natürlich tennis zu spielen :-). Ich hoffe, dir sind diese vergnügungen auch bald wieder vergönnt. bis dahin musst du damit leben, dich von sat.1 teams inteviewen zu lassen. das kann man in berlin übrigens zum hobby machen, wenn man sonst nichts zu tun hat. in nachrichten-umfrage-interview-mikrofone reinlaufen, oder film-dreharbeiten. gibt’s hier ständig und macht besonders spass bei nachtdrehs, wenn man gerade betrunken von einer party kommt und da scheint dir auf einmal ein 60.000 watt strahler entgegen. das nur nebenbei.
Aber du hast ja wenigstens ein ziel vor augen, dein fragment. ich glaube ich hätte da schon längst den faden verloren. Zum thema erzählperspektive habe ich letztens in einem wirklich guten artikel im kultur-spiegel zum ende der popkultur (inhalt: leider keine millionengagen für uns zukünftige literatur-stars) gelesen, dass juli zeh sich über die langweilige ich-erzählperspektive beschwert hätte. und da fühlte ich mich persönlich getroffen, obwohl die dame mein werk wohl gar nicht kennt. also versuchte ich, meine perspektive zu wechseln, was mir aber nur in einer verlogenen art und weise gelang. ich hatte das früher schon mal versucht (in einem meiner ersten roman-fragmente), es klappte aber nicht wirklich. Also der vorwurf ist schon irgendwie begründet, aber ich glaube, jeder muss auch seine eigene perspektive finden. ich glaube nicht, dass es da qualitative unterschiede gibt, oder wie siehst du das?
Also, ich will dich auch nicht zu lange aufhalten, wünsche dir noch viel glück und erfolg und verbleibe
mit sonnigen grüßen
s.
PS. Wie es scheint hast du dich zwischenzeitlich auch wieder ins [Literatur-Website]-universum verirrt, was sagst du zu den zuständen dort, und zum osten? hast du diesen nepal-text gelesen?
Bis denne!
Datum: [2003]
Betreff:
Hallo M.,
damit du dich wieder freuen kannst, dass ich so schnell zurückschreibe, hier diese mail. Und einen Anlass gibt es auch: ich war gestern auf meinem dritten slam. Und hatte damit mein Slam-Depri-Ereignis. Es war ziemlich haarig. Als „Gaststar“ eröffnete Jan Off den Abend, der ganz gut war. Dann wurde die Reihenfolge festgelegt, und es gab nur acht Leser. Und ich kam schon an dritter Stelle, was mir gar nicht passte, da ich noch zu bekifft war :-). Als erstes kam eine typische Berlin-Amerikanerin mit englischer Lyrik, dann kam Mind J Jizum, ein Freestyler, der eigentlich richtig gut ist, aber dem der Zeitpunkt auch viel zu früh war, und der gar nix machte ausser kostenlos CDs zu verteilen. Dafür bekam er dann eine ganz gute Wertung. Und dann ich. Ich hatte den […]text, dachte gerade weil so wenig Leute lesen wollten, mal einen längeren Text, und verfranste mich voll. Als ich das merkte, wurde es nur noch schlimmer, ich versuchte auf der Bühne noch zu improvisieren und den Text zu kürzen, was auch nicht gelang. Und darüber hinaus wurde ich immer unsicherer. Das war schade, denn dadurch versaute ich einen eigentlich guten Text. Insgesamt wurde ich so 10. von 12 oder 13, aber mein Nachbar, der auf dem Fußboden neben mir saß, versicherte mir, dass es sooo schlecht nicht war.
Meine Lehre aus dem Abend: Vorbereitung. Auch der Umgang mit dem Mikro muss gelernt sein. Aber: Immerhin stand ich auf der Bühne, und das trauten sich einige nicht. Ein schwacher Trost. Eine weitere Aufheiterung meines Befindens lieferte mein Nachbar, der mich schon von den anderen Auftritten kannte, wie sich herausstellte. Man kennt mich bereits! Witzig, aber auch beängstigend.
Der weitere Verlauf war über lange Strecken irgendwie komisch. Das Publikum war sehr sehr schlecht zu motivieren, das merkte nicht nur ich. Es waren dann auch die bekannten Gesichter und Teilnehmer da, Bastian Böttcher zum Beispiel, den ich immer noch uneingeschränkt empfehlen kann. Bei ihm merkt man auch, was Professionalität bedeutet. Diese Leute schreiben nicht nur auf den Auftritt bezogen, also können berechnen, was ankommt, sondern haben ihre Performance auch eingeübt. Ich traf ihn vor seinem Auftritt auf dem Klo, wo er seinen Text unter zu Hilfenahme der Kopf-gegen-die-Wand-Technik noch mal übte.
Überraschenderweise war er nicht der einzige Sieger an diesem Abend. Der Überraschungskandidat war ein zufällig in diese Veranstaltung geratener Münchener, der nichts tat als Geräusche. Eine fabelhafte BeatBox. Da taute das Publikum dann auch auf, obwohl kaum Text gebracht wurde. Die Begeisterung war aber durchaus gerechtfertigt und der Höhepunkt wurde erreicht, als die Endabstimmung kam. Da das Publikum abstimmte, war es schwer zu sagen, wer mehr Applaus hatte. Und so einigten man sich auf zwei Sieger, die dann eine Wahnsinns-Kür hinlegten:
Sebastian Krämer ist eigentlich eher von der Prosa-Fraktion, wenn auch mit gutem Rhythmusgefühl und wie gesagt professioneller Performance. Also machte die BeatBox aus München die Musik und Krämer lieferte den Text und der Saal kochte das erste mal an diesem Abend. Alles in allem dann doch eine gute Veranstaltung, wenn auch nicht für mich *g*. Meine Lehre war, dass ich nie mehr unvorbereitet auf die Bühne gehen werde.
Soviel dazu und jetzt Helau! Auch ich bin ein Karnevals-Leidender. Nicht nur, dass ich meinen tollen neuen Fernsehempfang eine Woche lang vergessen konnte, da auf jedem Sender nur noch diese Sitzungen übertragen wurden, sondern inzwischen gibt es auch im protestantischen Berlin Karnevalisten. Die sind zusammen mit der Regierung aus Bonn gekommen und verursachen auch hier mittlerweile Straßensperrungen wegen Umzügen. Schrecklich! SCHRECKLICH!! Aber es ist ja zum Glück vorbei. Doch du hast da mein volles Mitleid, in dieser Gegend zu wohnen und zu studieren (Mainz wie es singt und lacht, haha!), ich würde mich an amnesty wenden. […]
Ich würde deine Versorgung ja gerne verbessern, habe allerdings kein rechtes Vertrauen in die Deutsche Post. Und der Weg ist mir dann doch ein wenig zu weit. Aber auch hier im Schlaraffenland gab es vor kurzem einige Engpässe, was ungewöhnlich ist. Es wurden ziemlich viele Wohnungen und Privatplantagen ausgehoben, so dass die Paranoia um sich greift, mich aber zum Glück noch nicht erreicht hat. Falls du das nächste mal im Traum mal wieder in Berlin bist, schau einfach bei mir vorbei ;).
Finde ich ja cool, dass jetzt auch in der hessischen Regionalpresse über die Fernsehprobleme Berlins berichtet wird. Und ja, es ist so kompliziert, wenn man es technisch verstehen will. Wenn man einfach nur Fernsehen schauen will, dann braucht man sich nur zu merken: Kiste kaufen für 200 € und an den Fernseher anschliessen. Das ist nicht ganz so kompliziert, aber eben trotzdem teuer *g*.
Der Oasis-Text ist nicht in monatelanger Recherche entstanden, sondern so wie es da steht: Im Rausch geschrieben, direkt beim Schauen des Videos. Inzwischen weiss ich nicht mehr genau, was ich davon halten soll, ist halt mal was anderes. Ich habe auch bemerkt, dass das Video mehr enthält, als ich dachte, und dieser Typ keinesfalls nur vor dem Baum steht, und der Baum nicht auf einem Hügel ist, sondern in einem Park, aber was zählt, ist der Moment, und der Moment, in dem ich das geschrieben hab, suggerierte mir eben einen Hügel. Also lass ich es auch so.
Die Skispringernamen gibt es doch wirklich. Danke für das Lob, ich überlege, ob ich diesen Text zum Osten-Wettstreit anmelde. Mal schauen. Und um dir ein noch schlechteres Gewissen zu machen: ich habe noch zwei Texte geschrieben, aber du weißt ja, die müssen eine Weile reifen, in der Schublade. Aber lass dich von deinem Gewissen und mir nicht zu sehr ärgern, schließlich tust du was für die Uni, was ich zur Zeit eher aufschiebe. Auf keinen Fall solltest du dich von mir entmutigen lassen, von wegen Zugang verloren und so. Schon allein deswegen, weil ich gespannt bin, ihn zu lesen.
Bei der [Literatur-Website] habe ich inzwischen die Zeitsynchronisation wieder geschafft, also den aktuellen Überblick über die neuen Texte und was gerade so abgeht. Doch das macht es auch nicht besser. Den Nepal-Text hatte ich gelesen, kurz bevor ich dir die letzte Mail geschrieben habe, und mein Problem damit war, dass der Text sagen wir mal vom Thema her sehr interessant ist, aber meiner Meinung nach nicht wirklich gut geschrieben. Rechtfertigt ein gutes Thema alleine eine Aufnahme in die Anthologie? Das ist die Frage, die ich mir stellte.
[…]
Bis demnächst
S.
Datum: [März 2003]
Betreff:
hallo m.,
ganz entgegen meiner gewohnheit diesmal keine abgeklärte mail von mir.
gerade eben sprudelte ein text aus mir heraus, und irgendwie habe ich das bedürfnis, ihn dir so „frisch“ wie möglich zuzuleiten, da ich nicht weiss, ob ich ihn nach dem „drüber schlafen“ auf meiner festplatte behalten würde. Es geht, unüblicherweise, um das populäre thema krieg, was mich natürlich auch beschäftigt, aber du weisst ja, dinge, die mich wirklich berühren, kommen selten in meinen texten vor. der zweite text ist ebenfalls zum gleichen thema, vor einer woche geschrieben. Sehe bitte beides als Fragmente, so wie du mir auch eins geschickt hast.
deine mail, für die ich mich natürlich sehr bedanke, beantworte ich bestimmt morgen. sie klang gut, hörte sich ein wenig so an, als ob es dir wieder stressfreier geht, das würde mich freuen.
Bis bald und gute Nacht in die Kleiststrasse!
S.
PS. Warum eigentlich 341?
Datum: [März 2003]
Betreff:
Hallo M.,
und, hast du den Schock meiner letzten Mail verkraftet *g*? Erst stellt sich heraus, dass ich Spiegel-Leser bin, und dann auch noch für den Krieg… Naja, das waren halt so ein paar Gedanken, entstanden durch non-stop-Vorkriegsberichterstattung. Aber im Grunde finde ich, ist was Wahres dran. In den Sechzigern war viel die Rede von der „imperialistischen Fratze“ der USA, und ich glaube, die wird jetzt, im Krieg, wieder sichtbar, auch für die, die es schwer glauben. Soviel nur kurz dazu, jetzt zu deiner Mail.
Du hast natürlich gut aufgepasst, und es freut mich dass du meine Mails so gründlich liest. Bei dem Slam waren es anfangs wirklich nur acht Teilnehmer, aber nachdem der MC so gebettelt hatte, erklärten sich noch ein paar Unentschlossene bereit, vorzulesen. So dass es am Ende 12 Leute oder so waren. Autogrammkarten habe ich noch keine, noch nicht :-). Aber es ist echt lustig, nicht nur dass mich dieser Typ bei dem Slam angesprochen hat, ich habe auch noch andere Fanpost bekommen:
vor ein paar Tagen bekam ich eine Mail von jemanden, den ich in meinem […]-Text verarbeitet habe – [geschwärzt]. Das war schon ein komisches Gefühl. Und er schrieb, er „wurde schon mehrfach auf diesen Text hingewiesen“. Ich dachte ausser dir kennt keiner meine Homepage, und dann meldet sich auch noch ein „Opfer“. Er war aber nicht sehr böse, nur etwas verwirrt, so wie ich ihn auch aus der Realität kenne. Lustigerweise weiss er nicht, wer ich bin, also er kennt den Text, und er kennt mich im „wahren Leben“ auch, wenigstens flüchtig, aber er hat das Puzzle noch nicht zusammengefügt. Apropos, was macht dein Puzzle?
Zum Thema Christiansen und Spiegel – ich weiss ja nicht, wie gesagt, die Popliteratur ist vorbei, die Millionenvorschüsse auch (wieder mal sind wir zu spät dran, so`n Mist) und wer kennt heute noch Lebert? Auch Stucki hat ja schon lange, für seine Verhältnisse, kein Buch mehr geschrieben, dafür hat er sich aber ne gute Frau geangelt, das füllt ihn jetzt wahrscheinlich genug aus.
Und natürlich werde ich weiter lesen, bis ich von der Bühne geprügelt werde. Entgegen deiner Vermutung habe ich das noch nicht getan, ich arbeite aber dran. Wie gesagt, das nächste mal will ich mich besser vorbereiten. Den richtigen Ort habe ich auch schon: Den Scheinbar-Slam in Berlin-Schöneberg. Da war ich letzte Woche das erste Mal, und während in den Bastard, wo ich sonst immer war, so bestimmt mehrere Hundert Leute reinpassen (ich kann das nicht gut schätzen, aber ich glaube 200 ist realistisch), ist die Scheinbar schon mit 50-60 Leuten überfüllt. Es war auch eine sehr nette Atmosphäre dort, irgendwie familiärer.
Aber trotzdem gibt es auch dort die Profis, da hast du schon recht, das kann einen irgendwie nervös machen. Andererseits wurden diese Leute auch nicht als Profis geboren, denke ich. Hauptsache ist, dass man den Drang danach verspürt (der bei mir immer hervorgerufen wird durch freien Eintritt und die Getränkebons).
Dein Scherz war übrigens gar nicht so lahm, keine falsche Bescheidenheit! Ich habe, Achtung: im Spiegel mal eine Reportage gelesen über ein Unternehmen, das für relativ wenig Kohle alle unzustellbaren Briefe und Pakete und so aufkauft, um den Inhalt dann zu sortieren und zu verscherbeln. Und da kam wohl einiges zusammen, Drogen, Geld, Technik usw. Wenn ich mal nachschaue, finde ich bestimmt die Adresse raus, dann kannst du ja einen Brief schreiben und dich nach deinem Paket erkundigen *g*.
Ich habe jetzt zwei Texte zur Anthologie angemeldet, mal schauen, was draus wird. Speziell was dafür schreiben könnte ich aber auch nicht. Deine Erfahrungen mit Sibiria würden mich schon interessieren, dann sind wir schon zwei, die diesen Text gerne lesen würden. Wenn du jemanden gefunden hast, der ihn geschrieben hat, sag Bescheid.
Gratulation zu den siebzig Seiten! Der Spannungsbogenaufbau ist dir jedenfalls gelungen, was meine Neugier betrifft. Ich habe mal ein paar meiner alten Texte durchgesehen, auch ich habe ja diverse Versuche in Richtung Roman gestartet (sogar in der dritten Person), dann aber mangels Zeit abgebrochen. Ich finde es echt schwierig, die Story im Kopf zu behalten, deswegen hatte ich mir damals am Ende immer Notizen gemacht, was als nächstes passieren sollte. Leider kann ich die jetzt nicht mehr wirklich deuten….
Bis gestern war bei uns auch tolles Park- und Grünanlageneinweihwetter, und ich war tatsächlich auf unserem Dach, um den Fernsehturm am Alex zu fotografieren. Zu mehr habe ich es noch nicht gebracht. Der Nachteil ist, dass jetzt wieder unzählige Wochenendspaziergänger sich im Grunewald-Hundeauslaufgebiet rumtreiben und sich über die Hunde beschweren. Aber nach fast drei Jahren habe ich mich auch daran gewöhnt.
Soviel dazu.
Bis dann und Grüsse an A. (ich habe schon viel unbrauchbarere Gedichte gelesen)
S.