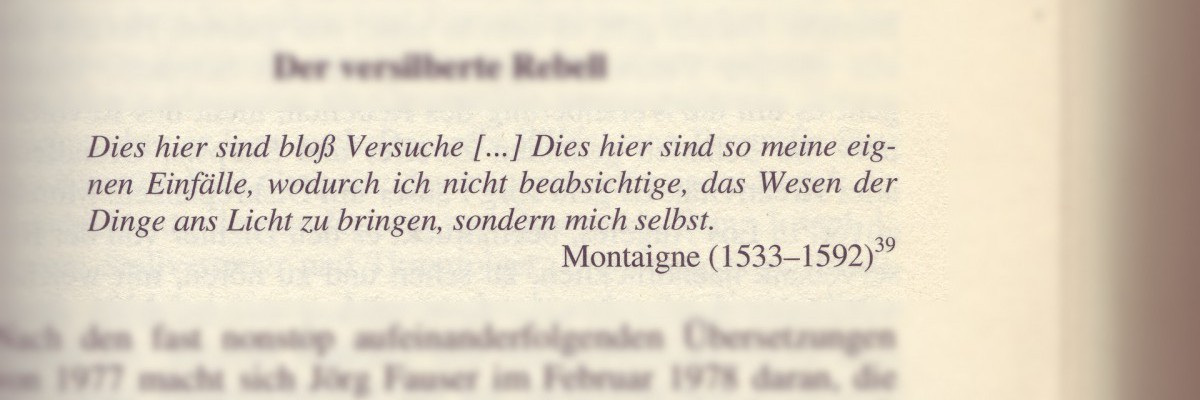Vor Jahren besuchte ich mal ein Seminar zum „Problem der Anarchie in der internationalen Politik“. Zugegeben, als ich mir kurz vor Semesterstart meinen Stundenplan zusammenstellte, hatte ich etwas anderes im Kopf als das, worum es dann schliesslich ging. Aber es lag auch am Dozenten, dass meine Wahl auf diese Veranstaltung fiel: Er war mir vorher schon als sehr angenehmer Zeitgenosse und kluger Kopf aufgefallen, damals ging es um Hobbes, wenn ich mich recht erinnere.
Dass ich nicht sofort wusste, was mit „Anarchie in der internationalen Politik“ gemeint war, lag daran, dass ich erstens nur Nebenfach-Politikwissenschaftler und zweitens IB (Internationale Beziehungen) weit davon entfernt war, einer meiner Schwerpunkte in diesem Nebenfach zu sein. Allerdings wurde ich im Laufe des Semesters mehrfach positiv überrascht. Es handelte sich, das muss dazu gesagt werden, um ein Master-Seminar. Ich studierte dagegen noch auf einen vorsintflutlichen Magister-Abschluss hin und musste die zwei, drei letzten benötigten Scheine zusammensammeln.
So furchtbar, schlimm und vollkommen unakademisch diese ganze verkorkste Bologna-Reform auch ist (irgendwann werde ich auch dazu noch was schreiben müssen) – die Masterseminare, die ich damals besuchte, waren mit das Beste, was mir in der Uni-Karriere bis dahin passierte. Hier fanden sich diejenigen zusammen, die wirklich ein ausgesprochenes Interesse, wenn nicht gar Leidenschaft, für das jeweilige Thema hatten – und es waren meist angenehm kleine Seminargruppen von nicht mehr als zwanzig Teilnehmern, im Gegensatz zu den 60 und mehr Studierenden in äquivalenten Magisterstudiumsveranstaltungen (klar, die angehenden Master mussten es ja vorher erst einmal schaffen, sich durch den Selektionsdschungel zu schlagen, da bleibt nicht viel übrig). Sie kamen mir übrigens alle erstaunlich jung und meist ebenso schlau vor, ich sah einige von ihnen mit weit unter Dreissig schon promoviert in irgendwelchen hohen Positionen bei globalen Thinktanks oder in Politik und Medien. Wenige vielleicht auch an Forschungseinrichtungen oder Universitäten, dann wahrscheinlich mit der Habilitation beschäftigt. Aber wirklich nur wenige, denn diesen ambitionierten High Professionals hatte zumindest das deutsche Hochschulwesen keine überzeugenden Karrierechancen zu bieten; Juniorprofessuren, da lachten die sich drüber kaputt, was ja auch die einzige Lösung war, wäre es nicht so traurig.
Jedenfalls sass ich da also als Veteran aus einer längst vergessenen Zeit und führte ein halbes Jahr lang angeregte Diskussionen mit den IB-Experten der kommenden Generation. Überraschend auch, dass fast immer fast alle die durchaus anspruchsvolle Lektüre gelesen hatten: Auch soetwas gab es früher kaum. Das Fazit war recht zwiespältig: Völkerrecht, Schmölkerrecht – das zählte noch weniger als das Papier, auf dem es steht, da waren selbst nationale Verfassungen besser dran. Es ist schon so, dass für die IB eigentlich der Hobbes’sche Urzustand gilt und zwischenstaatliche Verträge dagegen nur so lange, wie beide Partner das wollen und sich vertrauen – ein Leviathan ist nicht wirklich auszumachen (Sorry, UNO, grow some balls). Das Gefangenendilemma lässt grüssen. Andererseits gibt es ja durchaus viele vernetzte Interdependenzen in der modernen, industrialisierten, kapitalistischen Welt. Und das Theorem, dass entwickelte Demokratien keine Kriege untereinander führen, wurde auch noch nicht grundsätzlich widerlegt. (Nicht zu vergessen, wie der Dozent immer wieder betonte, dass kaum noch von Supermächten gesprochen werden kann, wenn überhaupt, dann von Hegemonien. Und dieser ganze Bezug der angloamerikanischen Politikwissenschaft auf das „Westfälische System“ ist auch Schmuh, diese angebliche historische Ordnung Europas wird sowieso gnadenlos überschätzt. Mich würde interessieren, wie er inzwischen seinen alten Text, den ich grad entdeckte, nach 20 Jahren beurteilen würde.)
Heute, in dieser mal wieder historisch einzigartigen Situation, wünschte ich mir manchmal solche Seminare und Diskussionen mit klugen, jungen Menschen, die für ihr Thema brennen. Aber ich bin raus aus der Uni, die Medien ™ schüren Freie-Welt-Propaganda und die Nischenblogs versuchen ein Bild gerade zu rücken, das sich eh keiner anschauen mag. Und natürlich stehen ALLE im Verdacht, von irgendwelchen Geheimdiensten gesteuert zu werden, bewusst oder nicht. Deswegen werde ich nichts zu der aktuellen politischen Lage schreiben, wozu auch?
Trotzdem möchte ich – wenn sonst schon nix Gescheites von mir kommt – auf ein paar lesenwerte Texte hinweisen. Immerhin komme ich trotz des Wetters dazu, heimlich still und leise ein paar Zeilen in den Computer zu schreiben. Zuerst – weil ich es bei der letzten Linksammlung vergaß bzw. schon längst darauf hinweisen wollte: Eine Geschichte, die ich schon mal lobte, gibt es jetzt als kleines Büchlein zu kaufen.
Ähnlich am Herzen liegt mir das Zentrum für politische Schönheit. Manche mögen sich vielleicht noch an den „Schuld“-Film erinnern, jetzt gibt es eine Art Grundlagen-Erklärung des ZPS. Sehr lang, ich bin auch noch nicht ganz durch*, aber Schlingensief thront über allem, das kann kaum schlecht sein. In dessen Genre und Generation gibt es eigentlich nur noch einen, der mich annähernd so begeistert hat: Pollesch, ich hatte ihn schon mal erwähnt, und auch Bersarin tat es gerade wieder. Hier gibt es ein aufschlussreiches Interview mit ihm, der derzeit weit weg in Zürich wirkt: über die Verteidigung der Lüge und des Verrats, und was Petitionsunterschriften mit Derailing zu tun haben.
Wie vielleicht ja schon angeklungen, ist das mit der Politik und dem Schreiben nicht immer einfach. Und schon gar nicht mit dem Schreiben über das Schreiben (und Reden) über die Politik, vor allem, wenn alle einfach nur Literatur erwartet haben. Oder so ähnlich. Deswegen und wegen meiner Menschenscheu habe ich oft versucht, wirkliche politische Zusammenhänge zu meiden. Das ist mir nicht immer geglückt, daher weiss auch ich: die Politik war immer schon ein mieses Geschäft, sobald mehrere Menschen auf einem Haufen waren, damals wie heute. Doch wie gesagt, es klappt nicht immer mit der Enthaltsamkeit. Also nochmal zurück zu einem schon oft genug besprochenem Thema.
Die NSA und die Weltöffentlichkeit wissen dank Snowden ja jetzt um das Merkel-Syndrom. Was aber auch nicht unter den Tisch fallen sollte: Dank einer furiosen Spike-Lee-Rede hat die Gentrifizierung jetzt das Christopher-Columbus-Syndrom an der Backe: We been here, you can’t discover this! Man sollte sich das wirklich alles anhören, lauter Perlen:
And then! [to audience member] Whoa whoa whoa. And then! So you’re talking about the people’s property change? But what about the people who are renting? They can’t afford it anymore! You can’t afford it. People want live in Fort Greene. People wanna live in Clinton Hill. The Lower East Side, they move to Williamsburg, they can’t even afford fuckin’, motherfuckin’ Williamsburg now because of motherfuckin’ hipsters. What do they call Bushwick now? What’s the word? [Audience: East Williamsburg]
That’s another thing: Motherfuckin’… These real estate motherfuckers are changing names! Stuyvestant Heights? 110th to 125th, there’s another name for Harlem. What is it? What? What is it? No, no, not Morningside Heights. There’s a new one. [Audience: SpaHa] What the fuck is that? How you changin’ names?
Aber der Peak scheint langsam erreicht, selbst auf Bloomberg wird jetzt schon die Geschichte von den Israelis in Berlin erzählt, und zwar gar nicht so schlecht. Derweil treibt auch zu Hause in Gusch Dan die Gentrifzierung weiter skurrile Blüten. Doch wie gesagt: Ein Ende ist in Sicht, muss in Sicht sein. Wenn der Tagesspiegel berichtet, dass des Kiezneurotikers und Pantoufles Lieblings-Titten-Comic-Tittencomic-„Online-Magazin“ (fast hätte ich die schlechte Musik vergessen) berichtet, dass Gawker berichtet, dass erst der Rolling Stone und dann auch noch die NY Times berichteten, dass die Gentrifizierung Berlin arg zu schaffen macht und schon allein deshalb mindestens Krakau jetzt viel doller in ist – dann ist es doch wirklich langsam vorbei, oder? Ein kleiner Hoffnungsschimmer also, tausend Fliegen und so weiter. Wer immer noch nicht überzeugt ist: Andrej Holm wurde in den Dorfnachrichten ausführlich interviewt. Nicht von der Grinsekatze, sondern von dem Typen mit dem Kuli. Und davor noch ein Bericht zum Thema von Uli Zelle. Wenn die Gentrifizierung damit nicht in der Mitte angekommen (und also vorbei?) ist, wann denn dann? Vielleicht, wenn auf Spiegel-Online-TV der Bar25-Film im Stream gezeigt wird?
Also kann ich mich beruhigt wieder dem Schreiben widmen. Falls jemand noch einen defitgen Rant braucht, wir sind ja hier schliesslich im Internet, bittesehr. Und wenn das mit dem Schreiben nichts werden sollte, dann wenigstens lesen: Nächste Woche ist Indiebookday.
*Inzwischen habe ich es geschafft. Grundanliegen des ZPS ist, neben dem, was der Name schon sagt, die Sache der Menschenrechte. Sie werben für einen agressiven Humanismus, den sie recht gut charakterisieren, begründen und historisch einordnen. Ehrlich gsagt haben mich ihre Kunstprojekte – ihre Praxis also – bisher mehr begeistert als dieser Grundlagentext – die Theorie – , der war mir an einigen Stellen zu naiv, zu dicht an der Oberfläche. Trotz alledem ein wirklich lesenswertes und handlungsanstiftendes Manifest, was Blickwinkel eröffnen kann, deren bisheriges Fehlen dort zu Recht angeprangert wird.