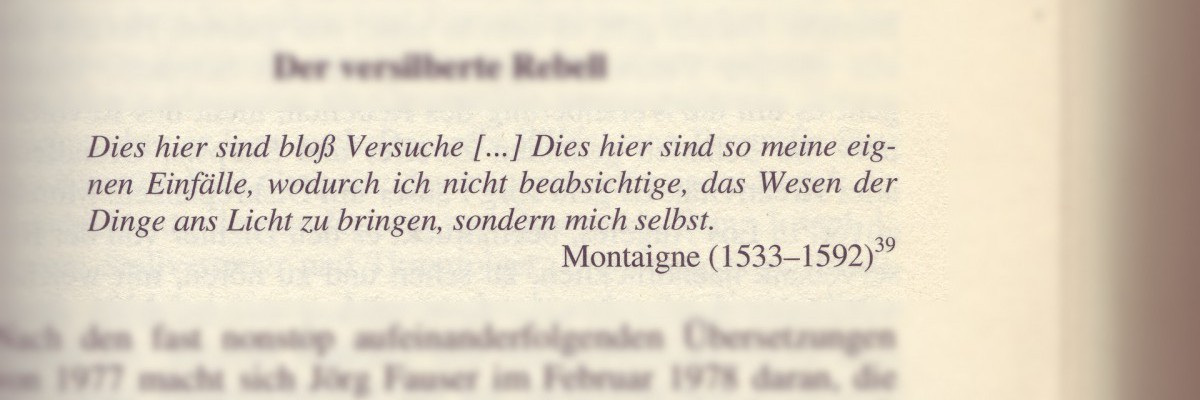Doch wo die Vergangenheit schweigt,
nicht wo sie spricht, läßt sie hoffen.
Bei dem Kneipengespräch im Wedding kamen wir auch auf Hochhuth zu sprechen. Wir waren uns soweit einig, dass dessen Werk heute unterschätzt wird, dass seine Bedeutung für die (bundes)deutsche Geschichte nicht genug gewürdigt wird. Was natürlich auch an den Berliner-Ensemble-Possen des Autors selbst liegt, und an seinen anderen Altmänner-Marotten. Eine der Ursachen des komisch-wirren Verhaltens Hochhuths ist wohl auch sein eigenes Erkennen des Bedeutungsverlusts seiner Person. Das wurmt, keine Frage.
Das letzte Gute, was man von ihm hörte, war sein – schliesslich und endlich von Erfolg gekröntes – Engagement für das Georg-Elser-Denkmal in der Wilhelmstrasse. Seine letzten Stücke kannte, wenn ich mich recht erinnere, selbst die Regisseurin nicht, sondern nur die Possen, aber auch von denen längst nicht alle. Aus zehnjähriger Erinnerung erwähnte ich „Soldaten“ – das sollte man mal lesen, das sollte ich auch mal wieder lesen, meinte ich.
Erster Akt: Das Stück
Und tat es dann auch. Literarisch ist es kein Meisterwerk, zugegeben. Schon 1963 schreibt Hochhuth an Golo Mann (dankbar für dessen Zuspruch) – und das gilt wohl bis heute: Meine Situation ist ja so: Die Historiker klopfen mir auf die Schulter und finden, ich hätte bei totaler Verzerrung der Geschichte immerhin literarische Verdienste. Die Literaten finden, ich hätte wenigstens historische. (zit. nach: Sie sind ein Fanatiker der Gerechtigkeit, Der Bund, 24.3.2001).
Das Thema von „Soldaten“(oder besser: die Verknüpfung der Themen) ist – noch mehr als vor zehn Jahren, als ich es das erste Mal las – hochaktuell: In den Rahmen einer Theateraufführung zum hundertjährigen Jubiläum der ersten Genfer Konvention 1964 eingepasst (Aufführungsort: Coventry), spielt der größte Teil des Stücks in den Monaten April bis Juli 1943. Er verwebt darin zwei Komplexe, die sich beide in der Hauptfigur Churchill (der im Stück nur „PM“ genannt wird) kristallisieren – wer Gutes will, muss Böses tun, oder wie Hochhuth selbst sagt: Leider trifft eben zu, daß Gegner immer auch Eigenschaften austauschen, wenn sie sich nur lange genug gegenüberstehen. [a]
Einerseits dreht sich die Handlung um den Tod (bzw. die Ermordung) des polnischen Exilpremiers und „letzten Reitergenerals“ Sikorski, andererseits um den Luftkrieg generell und die Operation Gomorrha im Speziellen. Deshalb auch der Untertitel „Nekrolog auf Genf“.
Es geht also um das lübecken und coventrieren, Hochhuth klagt an, dass es analog zum Landkriegsrecht keines für die Lüfte gibt (das kam – ansatzweise – erst 1977). Das moralische Dilemma Churchills wird schnell klar, ebenso die Unschärfe der Grenzen des Erlaubten. Es spricht, im ersten Akt, also 1964, der Autor-Regisseur und ehemalige Group-Captain des britischen Bomberkommandos:
DORLAND galgenlustig: Nein? – Und: S o l d a t e n!
Vorsicht, Soldat ist, wer Soldaten bekämpft, Kampfflieger, die Panzer anzielen, Brücken, Industrien, Staudämme. Du bist keiner – sowenig wie ich über Dresden einer war.
SOHN aufstehend: Was bin ich sonst als Planungsassistent?
DORLAND affektlos, ganz ruhig, ein Sachwort:
Ein Berufsverbrecher. Ein potentieller Berufsverbrecher.
[…]
DORLAND: Piloten töten Wehrlose, als g ä b e es kein Rotes Kreuz.
Doch nur M i n u t e n später,
wenn sie abgeschossen, selbst wehrlos
denen in die Hände fallen, die sie bombten:
d a n n soll es gelten, das Rote Kreuz – für s i e. (S.30f.)
Von Vietnam bis zu den Killerdrohnen in Pakistan, vom Bombergate (und den alljährlichen Verrenkungen, wie man in Dresden denn am besten mit diesem “Gedenktag” umgehen sollte) bis zu den Morddrohungen gegen den “Landesverräter” Gideon Levy (weil er die Rolle der Bomberpiloten im letzten Gaza-Krieg hinterfragte) – der Luftkrieg begleitet uns seit knapp einhundert Jahren. Doch Luftkrieg ist natürlich nicht gleich Luftkrieg, und Abfangjäger sind etwas anderes als Bomberpiloten, worüber sich Sir Arthur Harris (als “Traumpartner”) auch in “Soldaten” echauffiert:
TRAUMPARTNER: […]
Der Dank der Nation – daß sechsundfünfzigtausend Briten
und über vierzigtausend Amerikaner
in Bombern über Deutschland gefallen sind…
Er ist erschüttert, Dorland auch.
Die Gefallenen des Jägerkommandos, alle, j e d e r einzelne,
der in der Battle of Britain fiel,
hat seinen N a m e n auf der Ehrentafel in Westminster.
Von e u c h , von m e i n e n Männern, den Bombern:
ist nicht einmal die Z a h l in Westminster zu lesen.
DORLAND bestürzt: Weil es so viele sind, Air-Marshall – zu viele.
TRAUMPARTNER lacht schauerlich: Wem reden Sie das ein, Major:
die Z a h l meiner toten Männer – die Z a h l, wie:
ließe sich doch wohl unterbringen in Westminster.
Aber u n s r e geopferten Kameraden, wie – die sind,
plötzlich, nicht wahr: nicht mehr gesellschaftsfähig. (S.45)
Was soll man denn auch entgegnen auf die Frage, ob das area bombing nun ein Kriegsverbrechen war oder ein legitimer Versuch, den Krieg vorzeitig und unter womöglich insgesamt weniger Verlusten zu beenden? Ein letztes Mal Bomber Harris:
TRAUMPARTNER: […]
Hitlers Rüstungschef, sein Speer, hat nach dem Kriege zugegeben:
sechs weitere Städte angeflogen wie Gomorra,
die Nazis hätten ihre Bude schließen müssen.
Ich bitte Sie: Hamburg erbrachte vierzigtausend Tote.
Mal sechs – was wäre das, verglichen mit d e r Zahl,
die w i r k l i c h umkam bis zum Kriegsschluß!
Jedoch, Soldat ist, wer beschimpft wird. (S.44)
Die Antwort – zumindest in der Literatur – war meist Schweigen, bis 1997 W.G. Sebald in seiner Zürcher Poetikvorlesung ebenjenes kritisierte und damit eine Debatte, begleitet von einer kleinen Veröffentlichungsflut, lostrat. Sebald schrieb 1997 von einem
bis heute nicht zum Versiegen gekommene Strom psychischer Energie, dessen Quelle das von allen gehütete Geheimnis der in die Grundfesten unseres Staatswesens eingemauerten Leichen ist, ein Geheimnis, was die Deutschen in den Jahren nach dem Krieg fester aneinander band und heute noch aneinander bindet, als jede positive Zielsetzung, im Sinne etwa der Verwirklichung der Demokratie, es jemals vermochte. Vielleicht ist es nicht verkehrt, an diese Zusammenhänge gerade jetzt (1997) zu erinnern, da das zweimal bereits gescheiterte großeuropäische Projekt in eine neue Phase eintritt und der Einflussbereich der D-Mark – die Geschichte hat eine Art, sich zu wiederholen – ziemlich genau so weit sich ausdehnt wie im Jahr 1941 das von der Wehrmacht besetzte Gebiet. [zit. nach Hayner, Elende Patrioten, Link oben]
Wie nun im Zuge solcher Ausdehnungen ein Land zwischen den Fronten unter die Räder kommen kann, das lässt sich momentan gut an der Ukraine beobachten. In “Soldaten” kommt diese Rolle dem Polen Sikorskis zu. Erst von England und Frankreich mit nichts als Lippenbekenntnis-Kriegserklärungen alleingelassen und feinsäuberlich seziert von Hitler und Stalin, muss er nun mit Letzterem als Verbündeten, nicht mehr als Feind und Besatzer, umgehen. Was zunehmend schwieriger wird: Einerseits wegen der strittigen sowjetisch-polnischen Grenzfrage, andererseits, weil ein Teil seiner seit Jahren vermissten Offiziere bei Katyn in Massengräbern gefunden wurden. Die NS-Propaganda schlachtet diesen Fund genüsslich aus und beschuldigt Stalin, Sikorski ist geneigt, den Deutschen zu glauben und eine Untersuchung beim Internationalen Roten Kreuz in Auftrag zu geben.
Churchill, Gastgeber Sikorskis, bittet ihn vergeblich, keine weiteren Schritte zu unternehmen, Stalin bittet Churchill um eine Auswechslung der polnischen Exilregierung. Als weder die USA noch Grossbritannien dem Insistieren des Diktators nachgeben, beruft dieser seine Botschafter aus Washington und London ab – eine der grössten Krisen der Anti-Hitler-Koalition und geeignete Kulisse, um auf der Theaterbühne einen absichtsvollen Flugzeugabsturz zu konstruieren und ihn implizit Churchill in die Schuhe zu schieben.
PM, während Cherwell liest, zu Brooke:
Schlimmer als ein Desaster an der Front.
CHERWELL, indem er Brooke das Kabel hinüberreicht:
Stalin hat die Beziehungen zu Polen abgebrochen!
PM: Wie habe ich Stalin a n g e f l e h t ,
d i e s e n Trumpf dem Hitler nicht zu gönnen!
CHERWELL – das einzige Mal im Stück, da er tiefes Betroffensein zeigt. Er preßt sich die Worte ab:
Jetzt aber runter vom Schlitten mit dem Polacken.
[…]
BROOKE: Ich war zum Lunchen mit Sikorski:
trotz Katyn will er seinen Frieden mit Stalin.
Aber er m u ß t e doch zunächst …
PM, als wolle er Brooke umrennen („Er hielt mir die Faust unter die Nase“):
M u ß t e! — Was mußte er!
Hinter meinem Rücken im Weißen Haus
dreimal, d r e i m a l den Präsidenten überreden,
der britischen Regierung zu v e r b i e t e n,
dem Kreml die Wiedergewinnung zaristisch-russischer Provinzen zu garantieren!
CHERWELL, da PM vor Erregung nicht weitersprechen kann:
Solange d i e s e r Pole da ist, Sir Alan,
hat Großbritannien k e i n e Garantie,
daß nicht der Kreml aus dem Kriege aussteigt
und sich erneut mit Hitler arrangiert.
BROOKE ratlos: Warum gibt Roosevelt Sikorski nach?
PM ungeduldig, barsch: Weil Sikorski acht Millionen Polen in USA die Wahl vorschreibt, natürlich! (S.108f.)
“Soldaten” wurde 1967 veröffentlicht und ist Hochhuths zweites Stück – er war also nach dem “Stellvertreter“ schon einiges an Kritik und Trubel gewohnt, hatte aber auch bedeutende Fürsprecher wie Hannah Arendt gewinnen können, die in New York für ihn Partei ergriff, kurzum: Sein Debüt war ein bahnbrechendes Ereignis, das weit über die Grenzen des Literatur- und Theaterbetriebs hinaus wirkte.
Zwischenspiel
Keine Frage, dass der Nachfolger eines solchen Durchbruchs besonders beäugt wird, ganz zu Schweigen von der Situation des Autors, der nachlegen muss. Doch zum Glück fiel Hochhuth die Sikorski-Handlung aus heiterem Himmel in den Schoss, welch grossartiger Zufall für jemanden, der ein neues, provokant-spektakuläres Stück Dokumentartheater braucht. Im Spiegel erklärte er: „Ich habe von Sikorski nichts gewußt bis zu einer bestimmten, sehr zufälligen Begegnung. Dieser Mann wäre mir als Zeuge absolut unverläßlich, wenn ich ihn nicht durch einen Sack voll Indizien hätte ernst nehmen müssen.“
Passenderweise hatte sich Hochhuth – beginnend mit einem Stern-Gespräch 1965, einen Tag nach Churchills Tod – mit einem jungen britischen Autor angefreundet, der ebenfalls vor Kurzem ein aufsehenerregendes Buch geschrieben hatte – das erste Standardwerk über die Bombardierung Dresdens, laut ihm Hochhuths ursprüngliche Inspiration für „Soldaten“. Er bat seinen Freund, zum Sikorski-Fall Nachforschungen anzustellen, denn das war dessen Domäne: Quellen auftun, so unmöglich es auch scheint. Der Freund war anfangs wenig begeistert, stiess dann aber doch auf so viele Ungereimtheiten, dass er selbst ein Buch darüber schrieb – es sollte pünktlich zur englischen Uraufführung von „Soldaten“ erscheinen.
Hochhuth schlägt mit seinem so erworbenen Recherchematerial in dem Stück und in den langen Vor- und Zwischenreden geradezu um sich. Er erläuterte in zwei langen Spiegel-Beiträgen seine Theorie (das Hamburger Magazin druckte darüber hinaus auch den – leicht gekürzten – zweiten Akt des Stückes ab), ansonsten beharrte er darauf, seine Informanten schützen zu wollen und deshalb für 50 Jahre seine Dokumente in einem Schweizer Banktresor aufzubewahren. Obwohl er viele weitere interessante, bedeutende und nicht so bedeutende Fakten einstreut (die Geschichten der Herren Lindemann (Baron Cherwell) und Bell beispielsweise) und in der moralischen Bombenkriegsfrage den eigentlichen Schwerpunkt setzt, ist doch die Churchill-Anklage das, was am meisten Aufmerksamkeit bekam.
Auch wenn Hochhuth derjenige ist, den der Kanzler Erhardt 1965 einen Pinscher nannte und damit eine ganze Zunft gegen sich aufbrachte, auch wenn er der ist, der später Filbinger zu Fall brachte (was – oh Ironie! – Weikersheim gebar) – leicht in Schubladen einzuordnen war er bereits damals nicht. Es wurde ihm schon anlässlich „Soldaten“ eine Nähe zu Spengler und Jünger attestiert, deren „heroischer Nihilismus“ nicht weit entfernt sei von Hochhuths Geschichtspessismus.
So verwundert es nicht, dass angesichts der verwirrenden Person Hochhuth und der Premiere von „Soldaten“ im sowieso schon verwirrten Westberlin anno 1967 auch die K1 ein Wörtchen mitreden wollte beim bevorstehenden Theaterskandal:
Der grossartige Wolfgang Neuss – im Stück mit einer kleiner Nebenrolle betraut – sollte für die „Berliner Horror-Kommune“ sein Garderobenfenster offen lassen, damit Kunzelmann, Langhans und Co. dann auf den Brettern der Freien Volksbühne ihre Forderung nach der Freilassung Fritz Teufels vortragen konnten. Die Flugblätter waren schon gedruckt: „Auf der Bühne die großen Gauner. Im Parkett die kleinen.“ Dummerweise löschte der Nieselregen die Zündung der Signalrakete.
Aus dem Skandal wurde also nichts und auch die Kritiken waren höchst verhalten. Hochhuths Verleger führte das auf Rudolf Augsteins missmütige Besprechung zurück – ein interessantes Schlaglicht zum Thema Journalismus damals und heute, wenn man bedenkt, dass das Blatt über zwei Ausgaben in unglaublich ausführlicher Form anlässlich der Premiere ein Stück pushte, welches dem Chef scheinbar nicht zusagte. Der Spiegel selbst zitiert genüsslich: Verdorben war der Abend, meint der „Soldaten“ – Verleger Rowohlt, dennoch – durch den Dolchstoß eines deutschen Nachrichten – Magazins; schon bei der morgendlichen Pressekonferenz am Premieren-Montag schien es dem „Theater heute“ – Chef Henning Rischbieter „überflüssig, daß noch der Vorhang aufgeht, nachdem heute morgen im SPIEGEL ein zutreffender Verriß des Stückes gestanden hat“. Der Artikel liefert auch gleich noch einen Überblick über die Besprechungen in der internationalen Presse:
Rolf Hochhuths „Soldaten“ hatten keine Fortüne. Die 150 Rezensenten und Sendboten von 44 Rundfunk- und TV-Anstalten, die am vergangenen Montag in Berlins Freier Volksbühne das Churchill-Pasquill besahen, urteilten meist nörgelnd:
Die „Bombe detonierte wie ein feuchtter Knallfrosch“ („Financial Times“); im „Römerdrama eines edel denkenden Studienrates“ („Süddeutsche Zeitung“) „langweilte man sich mächtig“ („Die Welt“).
Dem „Volkshochschulkurs in Geschichte“ („The Guardian“) gebrach es an „Klarheit und Schwungkraft“ („Herald Tribüne“). „FAZ“: „Wir haben noch keinem kühneren Mißlingen zugesehen.“
Augstein äußerte dagegen fast nüchtern hauptsächlich handwerklich-thematische Kritik, sprach von einem „unglücklichen Einfall“ Hochhuths und war gespannt, wie es den Regisseuren gelingt, den ganz untheatralischen Widerstand zu überspielen, der sich im Zuschauer regen könnte, weil Hochhuth nicht den Anschein eines Beweises bringt. Die Zeit resümierte, daß der Haupteindruck der einer großen Fernseh-Sondersendung ist, aber nicht der von intensivierender Kunst. In Anlehnung an die vermeintlichen Beweise, von Hochhuth im Schweizer Banktresor gesichert, meinte der Tagesspiegel 1969, er hätte lieber die Dokumente veröffentlichen und sein Stück für fünfzig Jahre wegschließen sollen. Anlässlich der zweiten Inszenierung in Bochum stellte der Autor resigniert fest: Ich werde auch mein zweites Stück gegen die deutsche Theaterkritik durchsetzen müssen.
Ganz anders in England – hier war der Skandal praktisch programmiert, schliesslich klagte Hochhuth mehrere hochdekorierte Personen direkt mit dem Stück an. Eigentlich war die Welturaufführung in London geplant, doch es sollte anders kommen. Sir Laurence Olivier, der künstlerische Leiter des National Theatre, berief 1963 Kenneth Tynan zum neuen Chefdramaturg. Um Profilierung – nicht nur seiner Person, sondern auch des National Theatre gegen die Konkurrenz der Royal Shakespeare Company – bemüht, suchte dieser nach einem passenden (möglichst provokativem) Stück. Als er 1966 „Soldaten“ entdeckte, schrieb er an Olivier: I don’t know whether this is a great play, but I think it’s one of the most extraordinary things that has happened to British theatre in my lifetime.
Olivier (der angeblich den Inhalt des Schweizer Banktresors kannte) mochte das „bloody play“ nicht, verteidigte es aber auf dem Boardmeeting des National Theaters mit einem Verweis auf Aristoteles‘ Poetik: the artist’s function is to describe not the thing that happened, but a kind of thing that might happen. Es half nichts, das Gremium entschied sich gegen eine Aufführung, was vielleicht auch daran lag, dass dessen Vorsitzender, Lord Chandos, als Mitglied von Churchills Kriegskabinett „Soldaten“ naturgemäß nichts abgewinnen konnte.
Tynan wollte nicht von dem Stück lassen und bemühte sich weiter um eine Inszenierung. Nun existierte damals in Grossbritannien noch eine Theaterzensur, die es nicht gestattete, noch lebende Personen unvorteilhaft in Szene zu setzen. So beschwerte sich Sir Arthur Harris bei dem für Zensur zuständigen Lord Chamberlain und der Vorhang blieb weiter geschlossen. Das Getöse um „Soldaten“ befeuerte allerdings die Anti-Zensur-Kampagne kräftig, die schliesslich 1968 ihr Ziel erreichte: Die Zensur wurde abgeschafft und Hochhuth durfte gespielt werden. Die englischsprachige Premiere war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon auf einer kanadischen Bühne gelaufen, Tynan selbst inszenierte das Stück im Dezember 1968 in Londons West End New Theatre – dort lief es nur drei Monate.
Bomber Harris sollte nicht der letzte gewesen sein, der sich juristisch gegen „Soldaten“ wehrte. Der einzige Überlebende des Absturzes, der inzwischen in den USA lebende Tscheche Eduard Prchal, empfand die Darstellung seiner Person als diffamierend und verklagte Hochhuth. Er bekam 50.000 Pfund zugesprochen, damals 420.000 DM – Hochhuth, mit sicherem Wohnsitz in der Schweiz, weigerte sich zu zahlen. Und noch einen weiteren – weitaus schillernderen – Gegner hatte sich Hochhuth eingehandelt.
Ein ehemaliger Schauspieler, inzwischen Ehemann Lili Palmers und Schriftsteller, außerdem Geheimdienstoffizier und eventueller zukünftiger Präsident Argentiniens hatte sich vorgenommen, aus Hochhuth einen tragischen Witz zu machen. Zur Londoner Premiere druckte der Sunday Telegraph Passagen aus Thompsons Buch über Hochhuths Theorie ab. Thompson arrangierte den Kontakt zu Hochhuth über Friedrich Dürrenmatt und half als Dolmetscher bei den Gesprächen zur englischen „Soldaten“-Premiere aus. Im Zuge dessen gelangte er zu dem Eindruck, bei Hochhuths „Rufmord an Churchill“ wäre alles Vermutung und Erfindung, der Dramatiker leide an einem Trauma und wolle eine poetische Rache für das deutsche Volk ausüben. Hochhuth: Ich habe ihn mir zugezogen wie andere sich eine Schleimhautentzündung zuziehen.
Zweiter Akt: Das Interview
Wer bis hierher vorgedrungen sein sollte, der wird sich vielleicht langsam die Frage stellen, was das überhaupt soll. Deshalb einige erklärende Worte: Es hängt mit besagtem Freund Hochhuths zusammen, der in einigen Links schon enttarnt wurde. Und mit der aktuellen Querfront-Debatte.
Ich versuche ja, mich zum politischen Tagesgeschäft zunehmend zurückzuhalten (das klappt, trotz aller Appelle, nicht immer), wollte es mir aber nicht nehmen lassen, in die nächsten Linksammlung einen bestimmten Artikel aufzunehmen. Weil er es wert ist, und weil mich dieses Thema immer noch triggert.Ich suchte nach einer Anmoderation und da kam mir ein (inzwischen unauffindbarer) Text, ein Projekt von 2005 in den Sinn: Die Freundschaft zwischen David Irving und Rolf Hochhuth, (mal wieder) öffentlich aufgedeckt im Zuge des Skandals um Hochhuths Interview in der Jungen Freiheit, in dem er behauptete, er kenne keinen „Fall Irving“ und dessen Holocaustleugnungen mit unfassbarer Ignoranz vom Tisch fegte. [b]
Auch hier ging es – nicht zum ersten Mal, gerade was die Junge Freiheit betrifft nicht zum ersten Mal – darum, wer wem Interviews geben sollte, oder eben nicht. Auch hier spielten Antisemitismus und der Antisemitismusvorwurf eine entscheidende Rolle. Auch hier gab es kein Schwarz-Weiss-Urteil, dafür Grauzonen, Querfronten und eine Medienkampagne, teils fern jeglicher journalistischer Recherchepflicht.
Erstaunlicherweise kaum thematisiert im Rahmen des Skandals wurde der Umstand, dass dies beileibe nicht Hochhuths erster Beitrag für die Junge Freiheit war. Im Jahr 1998 lieferte er einen Ernst-Jünger-Nachruf und zwei Jahre später ein Interview, in dem er pikanterweise an Martin Walser gerichtet meint, bezogen auf dessen Paulskirchen-Rede: Aber so voraussehend mußte er doch sein, um zu erkennen, daß das mißverstanden werden würde.
Genau das könnte man Hochhuth auch entgegenhalten. Pünktlich zum fünfzigsten Jahrestag der Bombardierung Dresdens befragte die JF Hochhuth nach seiner Freundschaft zu Irving. Hochhuth empörte sich darüber, daß die Stadt Dresden es nicht für nötig befunden hat, Irving als Ehrengast zu den Feierlichkeiten einzuladen, schliesslich habe er mit „Der Untergang Dresdens“ viel für die Aufarbeitung dieses Kapitels getan: Ein fabelhafter Pionier der Zeitgeschichte nennt er ihn, ein Historiker von der Größe eines Joachim Fest. Der Vorwurf, er sei ein Holocaustleugner ist einfach idiotisch! Solche Äußerungen im Jahr 2005, zumal von jemanden, der Irving sehr nahe steht, sind, gelinde gesagt, zumindest ebenso idiotisch. Das sollte auch Hochhuth später einsehen – doch ersteinmal musste der Skandal eingetütet werden, was scheinbar nicht so einfach war. In der Zeit schreibt Jens Jessen:
Der Berliner Tagesspiegel hat das Interview entdeckt und seinerseits Hochhuth befragt, der aber, weit entfernt, davon abzurücken, noch eins draufsetzte und Irving für »sehr viel seriöser als viele deutsche Historiker« erklärte.
Das war letzten Sonnabend. Der Tagesspiegel wartete, was passieren würde. Als am Montagmorgen noch nichts passiert war, schrieb er, es sei ein Skandal, dass der Skandal nicht bemerkt worden sei.
Es folgten unzählige Artikel und Äusserungen zu dem Interview, die Hochhuth unisono vorwarfen, für Irving, den schon seit Jahren überführten und verurteilten Holocaustleugner ein Ehrenerklärung abgegeben zu habe. Die Deutsche Verlagsanstalt (nicht aber, wie fälschlich verbreitet, der dtv) rückte im Zuge des Skandals davon ab, ein geplante Ausgabe autobiografischer Schriften Hochhuths zu veröffentlichen: so jemand könne nicht in einem Verlag veröffentlichen, der selber sehr viele jüdische Autoren im Programm hat. Die angesprochenen jüdischen Autoren hatten mit keiner Silbe einen Bann Hochhuths gefordert. Den Höhepunkt der Kampagne sahen sowohl die NZZ als auch der Autor selbst in einer Spiegel-Bildunterschrift zu einem Interview mit dem neuen Präsidenten des Zentralrats der Juden (unter dem Bild Hochhuths stand: Antisemitismus in akademischen Kreisen?)
Wird jemand, der eine „Ehrenerklärung“ für einen Holocaustleugner abgibt, gar mit diesem befreundet ist, also automatisch zum Antisemiten? Wenn man das Interview in der JF komplett gelesen hat, drängt sich einem dieser Eindruck nicht gerade auf: Hochhuth bekennt sich darin unter anderem zum Anhänger der Kollektivschuldthese, bezeichnet den Eintritt Grossbritanniens in den 2. Weltkrieg als „humane Großtat der europäischen Geschichte“ und Churchill als einzige Jahrtausendgestalt unter den Staatsmännern des sich so nennenden „christlichen Abendlandes“. Jörg Friedrichs „Der Brand“ bezeichnet Hochhuth als wertlos, weil es sich nur einem einzigen Aspekt widmet – allein dem Bombenkrieg – aber zu tausend andere Aspekte des Krieges keine Beziehung herstellt. Und nicht zuletzt stellte er fest: Ich habe noch nie einen Deutschen getroffen, der, wenn er zu Recht über die Verbrennung Dresden klagt, auch den Namen des „benachbarten“ Dörfchens Auschwitz nennt. Es ist eine Schande, daß wir noch immer nicht anerkennen: Die Weltgeschichte kennt kein mit unserem Holocaust vergleichbares Verbrechen.
Wenig überraschend wurden Äußerungen dieser Art (anfangs) kaum thematisiert – ein Skandal lebt schliesslich von der Verkürzung und Verknappung, differenzierte Betrachtungen waren also rar gesät. Der unlängst verstorbene Ralph Giordano (jetzt ist er wieder zusammen mit Wolfgang Leonhard, mit dem ich ihn oft verwechselte) bildete eine rühmliche Ausnahme: Während er in einem offenen Brief Hochhuths Äußerungen noch als eine der größten Enttäuschungen der letzten 60 Jahre bezeichnete, revidierte er nach Lektüre des Interviews und nach Hochhuths Eingeständnis, die Äußerungen zu Irving seien idiotisch gewesen, seine Meinung:
Noch einmal also, und noch drastischer: Hochhuth hat mit seiner deplazierten Philippika für den britischen Schmutzfink Mist gebaut. Aber diese Verdammnis, dieses Feuer auf seinem Haupt – das hat der Mann nun wirklich nicht verdient. Man kann die political correctness auch übertreiben. Gibt es doch eine Art des Nachtretens, die nicht den Getretenen, sondern den Treter charakterisiert. Muss berechtigte Forderung nach Entschuldigung denn in Demutszwang ausarten? Er hat gebüßt, und da will ich ihn wissen lassen, dass seine Auschwitzgedichte mich tief angerührt haben, wie so manches noch in der Vita dieses streitbaren Zeitgenossen.
Doch halt: So einfach ist es auch wieder nicht. Hochhuth trifft in dem JF-Interview und in den darauf folgenden Wortmeldungen Aussagen, die sich teilweise widersprechen, vor allem was den Kontakt zu Irving betrifft. Und wiederholt eine Behauptung, die er schon 1978 gegenüber Golo Mann äußerte, die von Irving stets abgestritten wurde und die nicht gerade für ein reflektiertes Verhältnis zum Antisemitismus steht: Der Brite hätte eine jüdische Mutter und sei deshalb als „Halbjude“ zu seinem Judenhass gekommen (vgl. Der Bund, s.o. und hier).
Dritter Akt: Die Freundschaft
Gemein ist den meisten Presseberichten anlässlich des JF-Interviews Hochhuths die Frage, warum sich jemand wie Hochhuth mit einem Antisemiten und Holocaustleugner anfreunden kann. Auch bei der Besprechung von „Soldaten“ anlässlich der englischen Wiederaufführung vierzig Jahre nach der Premiere in London heisst es: Trouble was, these were in a Swiss bank vault and couldn’t be opened for 50 years. And the only historian who supported Hochhuth was David Irving, an admirer of Hitler and a Holocaust denier.
Als sich die beiden 1965 kennen lernten, war Irving noch kein Holocaustleugner. Er kam 1959 in die BRD, um sein Deutsch zu verbessern und bei Thyssen zu arbeiten. Anfang der 1960er Jahre nahm ihn Werner Höfer für eine Serie („So starben Deutschlands Städte“) in der Neuen Illustrierten unter Vertrag – aus der 37-teiligen Serie entstand schliesslich das Dresden-Buch. Wie schon erwähnt galt es lange als Referenzwerk zum Thema, auch Vonnegut (der den Angriff im Schlachthauskeller ja selbst miterlebte) zitierte in „Schlachthof 5“ Irving und dessen (später als falsch identifizierte) Opferzahl von 135.000 Toten.
Der Bombenkrieg war wohl auch Thema des Stern-Gesprächs im Januar 1965, als sich Hochhuth und Irving das erste Mal trafen. Hochhuth kannte den „Untergang Dresdens“ und konnte einige Anregungen für „Soldaten“ daraus gewinnen. Wenn es später so gut wie durchgehend (von Martin Broszat anno 1977 bis zur Wikipedia) heisst, Hochhuth wäre den Thesen Irvings zur Sikorski-Ermordung aufgesessen (1967 unter dem Namen „Accident“ veröffentlicht), dann ist trotzdem das Gegenteil der Fall: Die Idee kam von Hochhuth.
Scheinbar freundeten die beiden sich schnell an, arbeiteten jedenfalls recht zügig zusammen an den Recherchen zu „Soldaten“. Irving entdeckte beispielsweise im Kalender des Gouverneurs von Gibraltar, MacFarlane, eine Notiz, die darauf hindeutete, dass der britische Geheimdienstoffizier Sweet-Escott am Tag des Absturzes (4. Juli) in Gibraltar weilte. Dieser stritt das ab (er machte sich seiner Biografie zufolge am 3. Juli von England aus auf den Weg nach Algiers, wo er am 5. Juli ankam…), Irving warnte aber nach eigener Aussage Hochhuth davor, diesen Namen zu nennen. Dieser schlug die Warnung jedoch in den Wind und veröffentlichte eine entsprechende Passage auch in dem Spiegel-Beitrag, was prompt zu einer Klage und Verurteilung des Spiegel führte. Später wurde die Kalendereintragung als „Swear Carrara“ gedeutet.
Vielleicht empfand Hochhuth eine Art freundschaftliche Treuepflicht gegenüber Irving, der sich – nicht ganz unbegründet – seit seiner Assoziierung mit dem Dramatiker und der gemeinsamen Sikorski-Arbeit in Grossbritannien einer Kampagne des Establishments ausgesetzt sah. So verfügte der Sunday Telegraph 1969 in einem Redaktions-Memo, dass Irving nicht mehr wie bisher als Historiker, sondern als Autor zu bezeichnen sei.
Irving behauptet weiter, dass der schon erwähnte Carlos Thompson direkt von den Churchills, namentlich dem Sohn Randolph, auf ihn und Hochhuth angesetzt wurde, Ergebnis sei das 1969 erschienene Buch The Assassination of Winston Churchill. Thompson war, neben Irving, Kenneth Tynan und dem Piloten Prchal auch zu einer Fernsehsendung im Dezember 1968 eingeladen – die englische Presse war zur Zeit der Londoner Premiere verständlicherweise sehr interessiert an dem Thema. Der Gastgeber der Sendung, David Frost, sollte es später mit seinen Nixon-Interviews sogar auf die Kinoleinwand schaffen.
Die Sendung selbst sah Irving als Teil der Verschwörung gegen ihn und Hochhuth, Hauptgegner blieb aber weiter Thompson. Angeblich entschuldigte sich seine Frau, Lili Palmer, persönlich bei Hochhuth für dessen Verhalten. Er trat über zehn Jahre später, 1981, wieder in Kontakt mit Irving und Hochhuth, bzw. dessen Mutter, der er angeblich erzählte, dass ihr Sohn ein von der SED bezahlter Agent sei. Irving berichtet auch, dass ein ähnlicher Verdacht zur Zeit der „Soldaten“-Premiere und der Turbulenzen darum im Lager ihrer Gegner auftauchte: Moskau steckte hinter dem Stück und würde den beiden finanzielle Unterstützung leisten.
Interessanterweise „enthüllte“ 2007 der dreissig Jahre zuvor in die USA geflohene rumänische Securitate-General Pacepa, dass Hochhuths „Stellvertreter“ Teil einer Geheimdienstaktion namens Seat 12 war, gesteuert aus Moskau und gerichtet gegen den Vatikan. Hochhuth stritt dies in einem Spiegel-Gespräch natürlich ab: Warum hätten die östlichen Geheimdienste ihre Papiere einem jungen Mann in Gütersloh zustecken sollen, der noch nie zuvor ein Wort publiziert hatte? Das ist absurd. (Absurd, sagt er. Stimmt nicht sagt er nicht…). Sowohl Irving als auch – deutlich drastischer – Thompson berichten von Hochhuths genereller Furcht vor der Verfolgung durch Geheimdienste.
Wenn Irving behauptet, er hätte den Historikerstreit ausgelöst, dann ist das natürlich maßlos übertrieben. Dennoch spielte er darin eine Rolle – er trat generell bis in die 1980er Jahre sehr oft in der deutschen Öffentlichkeit in Erscheinung, wenn es um die Zeit des Nationalsozialismus ging. Mindestens bis 1977, bis zur Veröffentlichung von „Hitlers War“ galt er als halbwegs seriöser Historiker, der ein Händchen dafür hat, Menschen aus dem engsten Kreis der NS-Führung zum Reden zu bringen. Dabei spielte Irving schon sehr früh – als Verfasser profaschistischer „satirischer“ Texte seiner College-Zeitung – mit dem Feuer (sein Bruder meinte, Irving treibe allein die Lust an der Provokation).
Aufgrund der These, Hitler hätte mindestens ein Jahr lang nichts von der industriellen Vernichtung der Juden im Osten gewusst, da Himmler diese hinter seinem Rücken vorantrieb und es keine schriftlichen Zeugnisse aus Hitlers Hand dazu gäbe, kam es zum Bruch mit seinem deutschen Verleger Ullstein. Martin Broszat widmete Irvings Thesen 1977 einen ganzen Aufsatz in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte (Vierteljahreshefte 4/77: Hitler und die Genesis der Endlösung. Aus Anlass der Thesen von David Irving) – verfemt und nicht ernstgenommen sieht anders aus.
Als der Stern 1983 auf einer Pressekonferenz seine Hitler-Tagebücher präsentierte, war Irving als Abgesandter der Bild vor Ort. Er kannte die Sammlung, aus der sie stammten und verkündete lautstark, dass es sich um Fälschungen handelt. Das war sein Element: Etablierten Historikern ihr eigenes Versagen vorwerfen, sie der Ungenauigkeit und handwerklicher Fehler zu überführen. Allerdings änderte Irving seine Meinung zu den Hitler-Tagebüchern, vielleicht auch, weil sie seine Thesen stützten. So kam es zu dem Bonmot eines Reporters, der auf Irving Aussage, er wäre der erste gewesen, der die Tagebücher für eine Fälschung hielt, entgegnete: Ja, aber auch der letzte, der sie für echt hielt!
Der nächste Absturz kam Mitte der 80er Jahre, als Irving Gerhard Freys Einladung annahm, vor dessen DVU-Publikum Vorträge über Rommel zu halten, obwohl ihn sein Verleger Albrecht Knaus eindringlich davor gewarnt hatte. Doch noch 1985 wollte der spätere Kulturstaatsminister und damalige Rowohlt-Chef Naumann unbedingt Irvings Churchill-Biografie verlegen. Endgültig auf dem Tiefpunkt jeglichen Niveaus angekommen war er schliesslich, als er 1989 den Leuchter-Report in Großbritannien herausgab und mit einem Vorwort versah. Trotzdem setzten sich 1996, als Irvings Goebbels-Biografie wegen verschiedener Boykottaufrufe vom Verlag zurückgezogen wurde, Intellektuelle wie Noam Chomsky oder Pierre Vidal-Naquet für ihn ein. Irving besiegelte sein Schicksal schliesslich selbst, indem er Ende der 1990er eine Verleumdungsklage gegen Deborah Lipstadt und ihren Verlag Penguin Books anstrengte – sie bezeichnete ihn als einen der Hauptprotagonisten der Holocaustleugner-Szene. Der Sachverständige Richard Evans wies ihm unzählige absichtsvolle Fälschungen nach und bereitete seinen Bericht zu einem eindrucksvollen Buch (Lying About Hitler: History, Holocaust, And The David Irving Trial) auf, für die FAZ berichtete Eva Menasse ausführlich vom Prozess. Ihre Beobachtungen sind im Buch „Der Holocaust vor Gericht – Der Prozeß um David Irving“ zusammengefasst.
Während sich, bei aller Kritik, lange Zeit die Meinung hielt, Irving wäre zumindest ein guter Quellenarbeiter (er hat, das sollte nicht vergessen werden, viele seiner Unterlagen anderen Forschern zugänglich gemacht, einiges davon lagert – jetzt für ihn unerreichbar – als Schenkung im Münchener Institut für Zeitgeschichte oder im Bundesarchiv), stellte Evans ein vernichtendes Urteil aus:
Irving is essentially an ideologue who uses history for his own political purposes; he is not primarily concerned with discovering and interpreting what happened in the past, he is concerned merely to give a selective and tendentious account of it in order to further his own ideological ends in the present. The true historian’s primary concern, however, is with the past. That is why, in the end, Irving is not a historian.
Bis zu Irvings Einreiseverbot in die Bundesrepublik 1993 unterhielten er und Hochhuth regen Kontakt. Irving begleitete die Hochhuths zur Berliner Soldaten-Premiere und besuchte auch die englischsprachige Uraufführung in Kanada. Hochhuth nahm Irving mit zu Jaspers, dieser revanchierte sich und lud den Dramatiker zu Treffen mit Arno Breker oder einer der Sekretärinnen Hitlers ein. Der Brite berichtet, wie er auf Initiative Hochhuths für die deutsche Penthouse-Ausgabe ein Interview mit Edward Teller führte.
Ohne Zweifel waren Hochhuth die verqueren Ansichten seines Freundes bekannt. Golo Mann machte ihm dies immer wieder zum Vorwurf, schliesslich war die Freundschaft zu Irving einer der Gründe, warum der Kontakt zwischen Mann und Hochhuth abbrach (neben Manns Rechtsrutsch, der Filbinger verteidigte und Diwald positiv besprach. Vgl. der Bund, s.o.). Hochhuth führte Mann gegenüber aus, wie oft er öffentlich Irvings Thesen widersprochen habe, Freunde seien sie trotzdem: nur ich nehme ihn in diesem Punkt nicht ernst und sage ihm das ins Gesicht und öffentlich.
Es ist möglich, wenn auch schwer vorstellbar, mit einem Holocaustleugner befreundet zu sein, ohne selbst einer zu werden. Nur weil man bestimmten Medien Interviews gibt, macht man sich noch nicht deren Ideologie zu eigen. Es ist aber nicht klug – the medium is the message – und man gerät in Gefahr, zum Steigbügelhalter solcher Ideologien zu werden.
Finale
Die fünfzig Jahre sind für Hochhuths Schweizer Banktresor so gut wie abgelaufen – allerdings hat er diesen scheinbar schon vorzeitig aufgelöst. Von dem englischen Gentleman war jetzt keine Rede mehr, dafür aber von der Ehefrau des Hochhuth’schen Verlegers: Jane Ledig-Rowohlt soll im Zweiten Weltkrieg für den britischen Geheimdienst tätig gewesen sein und äußerte gegenüber Hochhuth: Es ist hundertprozentig sicher, ich kenne jemanden sehr gut, der persönlich deswegen zu Churchill musste. Churchill war furchtbar niedergeschlagen, aber er habe keine Wahl. Seine Aussage, dass in fünfzig Jahren keiner mehr daran zweifeln wird, daß Sikorski von Whitehall ermordet werden mußte, hat sich nicht bewahrheitet, der Absturz gilt weiterhin als nicht aufgeklärt, trotz neuer Untersuchungen der Polnischen Behörden (die bei ihren Ermittlungen auch Hochhuth befragten). Zuletzt machte eine arte-Dokumentation aus dem Jahr 2011 zum Thema von sich reden, ansonsten herrscht Schweigen.
Den Bogen schliessend zu dem Müller-Jebsen-Interview und der aktuellen Querfront-Thematik (zu der an vielen Stellen schon viel geschrieben steht) kann gesagt werden, dass Hochhuth dieses Interview nicht gerade genützt hat. Sichtlich in Panik sprach er in seiner ersten längeren Einlassung im Rahmen des Skandals in der Weltwoche von einer „geistigen Existenztilgung“: Obwohl ich öffentlich bekannte, dass ich mich für meine senilen Irving-Äusserungen schäme, reiht man mich als Antisemit ein. Eine regelrechte Treibjagd! Die Junge Freiheit dagegen ist inzwischen etabliert und selbst in den Pressedienst des Bundestags aufgenommen – keine Rede mehr davon, sie vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen, die Schmuddelkinder sind längst sowas von angekommen, während Hochhuth merk- und merkwürdiger wird.
Der größte Teil der Recherchen zu diesem Text beruht noch auf meinem Projekt aus dem Jahr 2005, ich habe versucht, die neuen Nachforschungen nicht zu sehr ausufern zu lassen. Es hat nicht ganz geklappt, welch Überraschung. Doch andererseits: Zum Glück! Die letzten Buchstaben waren eigentlich schon getippt, da kam ich plötzlich auf den Gedanken, doch mal – zum krönenden Abschluss und Ausklang dieses Kapitels – auf Youtube ein wenig nach Hochhuth zu stöbern. (Sola scriptura, eine altbekannte Historikerkrankheit.)
Und siehe da: Dort findet sich der zitierte Hochhuth-Kongress in Weimar in aller Ausführlichkeit, diverse Interviews und Fernsehauftritte und – ein Compact-Podium von 2011, bei dem Hochhuth stolz und ausführlich von Elsässer präsentiert vorgeführt wird (und das Trauerspiel dreht sich – natürlich! – um Churchill und Hitler und Elser…und natürlich lässt es sich Elsässer nicht nehmen, ihn auf Irving anzusprechen – das JF-Interview ist längst nicht so platt wie dieses – und natürlich windet sich Hochhuth, lobt viel, redet sich um Kopf und Kragen, sagt aber auch zu Irvings 77er Hitler-Buch als Zäsur: Dann ist ihm das zugestossen, was der Stefan Zweig in seiner Biografie Die Welt von gestern beschrieben hat, was mir mit Churchill passiert ist (!) – man kann nicht umhin, sich in seinen Helden zu verlieben. ).
Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich den ganzen Spass vielleicht gleich ganz gelassen. In diesem Sinne lässt sich die fatale (und hoffentlich überspitzte) Frage stellen, wie viele Jahre vergehen werden, bis die Nachdenkseiten auf dem zwischentag vertreten seien werden. Trotzdem: Hochhuth ist weiterhin relevant; es gibt wirklich weitaus Schlimmeres und Belangloseres zu lesen. (Ich nehm mir jetzt Wessis in Weimar vor – aus aktuellem Anlass, könnte man fast meinen.) Und auch trotzdem gilt, was Eva Menasse schrieb: Rolf Hochhuth ist ein alter, aufgeregter, wirrköpfiger und unbesonnener Mann. Der aus der Vergangenheit kommt und sich in der Gegenwart scheinbar nicht mehr zurecht findet. Mal sehen, was die Zukunft bringt.
[a] Alle Zitate aus „Soldaten“ nach der Rowohlt-Erstauflage von 1967 (So auch jenes ganz am Anfang des Textes, S.104). Das Zitat an dieser Stelle stammt aus dem Interview, siehe unten, 2.Akt.
[b] Das fragliche Interview verlinke ich hier nicht direkt, wer es an der Quelle lesen will, das lässt sich sehr leicht finden. Es gibt allerdings auch eine Spiegelung auf indymedia 😉
[c] Alle Äußerungen D. Irvings, wenn nicht anders vermerkt, sind seiner umfangreichen Homepage entnommen, die hier nicht verlinkt wird. Sie lässt sich nicht ganz so leicht mit einer Suchmaschine finden, aber in Liechtenstein gibt es ja auch Google.
[Nein, das ist nicht mein längster Blogtext. Er hat aber ziemlich lange gebraucht, zugegeben, und einiges musste im Zuge dessen auf der Strecke bleiben. Was mit der Linksammlung passiert ist? Würde mich wundern, wenn die in diesem Jahr noch kommt…]
[Über den 2005er Recherchen fand ich ein Textfragment, das ich hier einfach mal in Rohform ans Ende setze. Passt irgendwie immer noch:
der autor zog den stecker seines laptops heraus, packte alles ordnungsgemäß in die tasche und verschwand für das nächste halbe jahr ans andere ende der welt. dorthin, wo er sich sicher sein konnte, keine informationen mehr zu bekommen.
er las sich all das durch, was er im zuge seiner hochhuth-irving-chomsky -recherche gesammelt hatte. er las es sich durch und schrieb ein buch darüber.
nachdem er all die fakten abgehandelt hatte, nachdem ihm all die widersprüchlichkeiten auffielen, kam er zu dem schluss, dass er in einer vollkommen illusionierten welt lebte. er berief sich auf robert capa, die tanger-connection und hunter thompson. er gab als parole aus, die wirklichkeit zu verachten.
in seinem nächsten bahnbrechenden erfolg legte er die grundlagen der diktatur der statistik dar, unterhaltsam beschrieben anhand der durch 5041 personen diktierten tv-einschaltquote.
seitdem wird behauptet, er säße irgendwo in einer irrenanstalt. er selbst verkündete in einem abschiedsbrief, er sei on the road to]