09.03.06
Diese ganze Scheisse.
Hundert Tage Merkelsimulation.
Zusammenbrechende Rot-Grün-Denkmäler.
Hand in Hand stürmen
WIR Papst und DU Deutschland
in die Vergangenheit.
Kein Wunder, dass der Sternburgkonsum steigt.
Protokoll eines ständig scheiternden Lebens
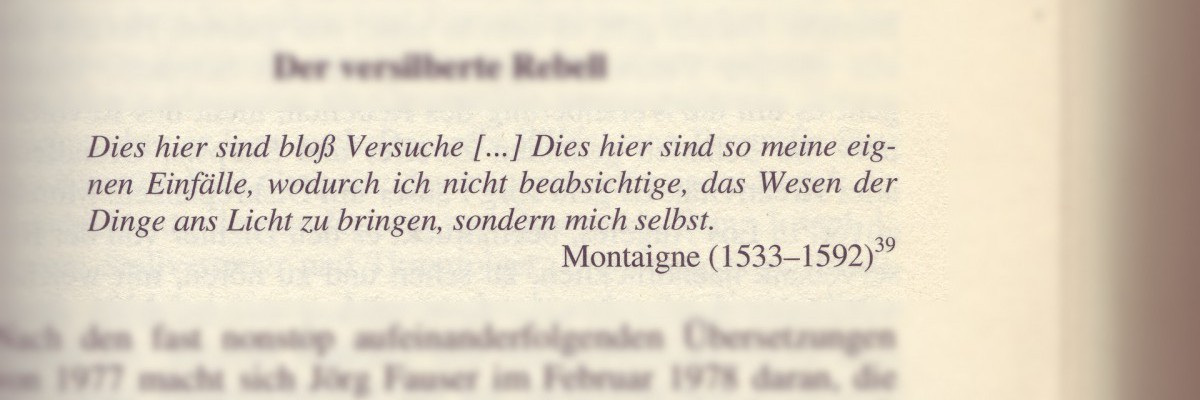
09.03.06
Diese ganze Scheisse.
Hundert Tage Merkelsimulation.
Zusammenbrechende Rot-Grün-Denkmäler.
Hand in Hand stürmen
WIR Papst und DU Deutschland
in die Vergangenheit.
Kein Wunder, dass der Sternburgkonsum steigt.
Gestern wurde der neue Mietspiegel für Berlin vorgestellt, nachdem am 11. Mai der Berliner Mietspiegel an sich vom Amtsgericht Charlottenburg als unwissenschaftlich abgekanzelt & gekippt wurde. Passt alles sehr gut zusammen, vor allem, wenn man bedenkt, dass zum 01.06. die Mietpreisbremse in Kraft treten sollte – die sich wiederum nach dem Mietspiegel richtet. Aber hey – gesetzliche Vorgaben und der Mietmarkt in Berlin, das ist sowieso eher so eine lockere on-off-Beziehung, typisch Metropole halt.
Energieausweise zum Beispiel sollte inzwischen auch jeder Vermieter vorweisen, ansonsten, so hörte ich gestern nebenbei, können Strafen bis zu 15.000 Euro verhängt werden. Nun, ich sehe derzeit immer wieder Anzeigen, in denen kein Energieausweis vorhanden (oder derzeit noch in Bearbeitung) ist.
Zusammen mit der Mietpreisbremse soll auch das sogenannte Bestellerprinzip eingeführt werden – Maklerprovisionen dürfen dann nicht mehr auf die zukünftigen Mieter abgewälzt werden. Theoretisch. In einigen Anzeigen kann man jetzt schon unter der Rubrik „Provision“ lesen, sinngemäß: Hierbei handelt es sich nicht um eine Provision, sondern um eine Bearbeitungsgebühr, die bei Abschluss des Vertrages vom Mieter zu entrichten ist.
Der frisch der Öffentlichkeit vorgestellte Mietspiegel geht übrigens von einem Durchschnittswert von 5,84 Euro/qm aus. Durchschnitt heisst ja, die Hälfte ist teurer und die andere Hälfte billiger. So ganz grob. Ich persönlich habe bisher kaum Wohnungen unter 10 Euro/qm gefunden. Ein paar waren dabei, doch, sicherlich. Erdgeschoss Vorderhaus Seestrasse, da kann man Glück haben und mit 7-8 Euro davonkommen. Staffelmiete meistens.
Und nirgends und niemals sind es unter 20 Leute: Dienstag morgens um 8: 20+. Sonntag morgen um 9, gegenüber dem RAW: 30 Leute. Nur kein Makler, was auch die Vormieterin wunderte.
Das versammelte Potpourri ist auch fast immer gleich: Geschniegelte Anzug- oder Kostümträgerinnen, die von allen anderen zuerst für die Makler gehalten werden, bevor sie sich brav schweigend in die Wartemasse stellen. Bärtig-tätowierte Hipster mit müden Gesichtern und plattgelegenen Haaren, englisch, spanisch oder italienisch parlierend. Frischgebackene Studenten mit Mama, Papa und Bürgschaft an der Hand. Berliner Ureinwohner mit Migrationshintergrund, die von sechsmonatiger, trotz Bürgen und dicker Kohle auf dem Konto erfolgloser Wohnungssuche berichten. Und alle checken sich gegenseitig ab, wer wohl rein sozialdarwinistisch auf welcher Stufe steht. Ganz selten sind auch Geflüchtete in Begleitung dabei. Ein Wahnsinnsspass. Nur falls sich wer fragt, warum es hier so still war. Für Depressionen, Texte schreiben oder die Fantasie schweifen lassen ist gerade keine Zeit. Was erstere nicht immer einsehen.
Samstag: Nach der Arbeit, spontan freiwillig ausgeholfen und komplikationslos absolviert, endlich dazu gekommen, die urls zu mieten. Demnächst wird es hier ernst, dunkel und eventuell erst einmal etwas stiller. Wenigstens ein Umzug, dem ich mit Freude entgegensehe: Endlich das umsetzen, womit ich mich schon fast zwei Monate werktags beschäftige, warum ich unter der Woche so viel zu tun habe & zu so wenig komme.
Aber Samstag, also Wochenende: Rucksack in die Ecke und wieder raus. Den Nachbarjungen, der auf dem Skateboard aus der Einfahrt schiesst, noch kurz abgeklatscht, am Hoffmann vorbei und aus der Ferne gegrüsst. Für den längeren Weg Richtung O-Platz entschieden, dafür aber komplett den alten, zugeschütteten Kanal lang gelaufen. Sonnenuntergang.
Schon von weitem sind die Bässe zu spüren. Je näher ich komme, desto mehr Leute um mich rum. Immerhin ist es also noch nicht ganz vorbei. Noch ein paar Schritte, dann kann man alles, was von der Bühne kommt, gut verstehen. Im Moment: Redebeiträge. Ich drehe eine halbe Runde um den gut gefüllten Platz, bis zum Brunnen, auf der Suche nach meiner Bezugsgruppe. Wir hatten uns lose verabredet; wenn, dann würden sie wohl hier ihr Lager aufschlagen.
Ein paar bekannte Gesichter ausgemacht, ein paar Schwätzchen gehalten. Die Bezugsgruppe meldet per SMS, dass sie noch im Hahn sitzen. Nein, denke ich mir, das wär mir grad zu rauchig und eng, da bleibe ich lieber hier. Ebenso eng bisweilen, je näher man zur Bühne kommt jedenfalls, und interessant riechende Rauchschwaden, klar – aber frische Luft, nette, friedliche Menschen und die Musik setzt auch wieder ein, nach einem Appell zur besonders unschönen Lage der geflüchteten Frauen, der mit den Worten „Herzlich willkommen zu einer weiteren sexistischen Veranstaltung“ eingeleitet wurde.
Doch die Musik ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin: Der Oranienplatz war der Stachel inmitten der Stadt, Symbol für die versagende Asylpolitik. Jeder von denen, die an diesem Ort vor Jahren ihr Lager aufschlugen, stand für werweisswieviele, die auf dem Weg hierher auf der Strecke blieben. Kurz zuvor hörte man wieder von 400 Ertrunkenen, in der Nacht darauf sollten mindestens 700 weitere dazu kommen. Nicht die, die es schaffen, sind das Problem, sondern die, die auf der Strecke bleiben – oder besser: Das Warum des auf der Strecke Bleibens, die Gründe für die Flucht und ihres vielfältigen Scheiterns sind das Problem, und dessen Ursachen liegen bei uns, zuhauf.
Aus den kurzen Gesprächen beim Rundgang war zu erfahren, dass ich sowohl Peter Fox als auch Zugezogen Maskulin verpasst hatte. Blieben also noch Irie Révoltés. Die spielten allerdings für Zehn und rissen die locker auf eine fünfstellige Zahl angewachsene Menge gut mit. Zu „Antifaschist“, wenn ich mich recht erinnere, gab es dann eine ausgeklügelte ortstypische Choreografie mit Feuerwerk und Transpis vom Dach, mittlerweile war es dunkel, passte alles. Und auf das Dach der Bushaltestelle passten 25 hüpfende Menschen.
Dann das übliche Spontandemo-Katz-und-Maus-Spiel, Zivis mit rasierten Köpfen, was den Knopf im Ohr gut erkennbar macht. Wir schauten uns das von der Seitenlinie aus eine Weile an, bis die Füße in den Chucks kalt wurden.
Der Hahn war nur über Umwege zu erreichen, ansonsten wie immer & erwartet. Deshalb (und auch, weil ich keinen Barhocker mehr erwischte) trieb es mich nach nicht allzu langer Zeit wieder nach draussen, frische Luft schnappen. Allerdings erschienen direkt hinter der geöffneten Tür ziemlich viele ziemlich breite uniformierte Rücken. Ich blieb dann doch erst mal in der Kneipe, dafür stürmte eine andere Fraktion aufgekratzt aus der Tür. Bedeutete: Einen Sitzplatz für mich.
Als das Geschehen sich etwas später verlagert hatte, nahm ich doch noch mal draussen auf den Stufen Platz, die Sirenen kamen aus Richtung Skalitzer, wo sich auch die schmalen Menschenströme hinbewegten, in der lauen Kreuzberger Frühlingsnacht. Der betrunkene Mann neben mir fragte, was denn gerade abgehe, irgendwer meinte wohl, heute würde der Kiez noch Kopf stehen, er hätte nichts mitbekommen, musste ja die ganze Zeit hinterm Tresen stehen.
Ich gab ihm eine Zusammenfassung von dem Wenigen, was ich berichten konnte, das „Eigentlich wie immer“ zum Schluss hätte vollkommen ausgereicht, eigentlich. Aber er wollte es ja genau wissen. „Den Ku’damm müsste man mal wieder platt machen“ sagte er, „jetzt, wo sie den wieder so schön aufpoliert haben. So wie damals in den 80ern, das ging ruck-zuck, von der TU-Mensa aus!“
„Jedenfalls besser als die O-Strasse…“ versuchte ich mich diplomatisch zu geben, und wollte eigentlich noch ein „Die Zeiten sind eh vorbei.“ nachschieben, aber er redete schon munter weiter. „Damals brauchtest du nur drei vernünftige Leute oben auf der Bühne, und die 2.500 unten kamen mit zum Ku’damm. Das dürfte doch kein Problem sein, ein paar Leute zusammen zu kriegen, mit der Technik heutzutage. Den Ku’damm müsste man mal wieder platt machen!“
Als ich wieder zur Tür rein kam, wurde gerade einem anderen betrunkenen Kerl ein Glas Leitungswasser quer über den Tresen ins Gesicht geschüttet, mit ordentlich Schwung. Wohl wegen penetranter sexistischer Kackscheisse.
Blöd eigentlich, dass da noch ein anderer Umzug ansteht.
Ich werde wohl nicht umhin kommen, eine Film-Rubrik einzurichten. Das war so nicht geplant (Andererseits: Diesen Film hätte ich nun wirklich nicht verpassen dürfen.). Wieder ein Dokumentarfilm, wieder spielt Gentrifizierung eine gewisse Rolle. Überraschung!
Ausserdem: Das Babylon hatte ich auch sehr lange nicht besucht. Also der denkbar beste Abschluss für ein langes Feiertagswochenende: Die Premiere von Baiz bleibt…woanders; auf einer großen Leinwand, in einem ziemlich großen Saal. Der – das kann schonmal vorweggenommen werden – wenn auch nicht ausverkauft, so doch sehr gut gefüllt war. Fast hätte ich den Termin vergessen, wäre ich nicht nochmal daran erinnert worden. Deshalb gab es hier auch keinen Hinweis, mea culpa.
Der Filmemacher Jochen Wisotzki, Autor und Dramaturg von flüstern & SCHREIEN, traf 2013 auf die/das Baiz, das zehnte Jubiläum stand bevor. Zehn Jahre bedeutete aber auch, dass der Pachtvertrag auslief. Eine fabelhafte Möglichkeit für die neue Eigentümer-Investorengruppe, dieses laute linke Unruhenest loszuwerden. Die Wohnungen in dem Haus lassen sich mit leisen Büros drunter natürlich viel besser verkaufen, direkt an der Grenze zwischen Prenzlauer Berg und Mitte. Kulturelles Umfeld gerne, kann man ja auch gut mit werben als Heuschrecke (Zitat Ahne, oder war es Gott…?), aber bitte nicht im eigenen Haus.
Als Wisotzki mit seinen Aufnahmen begann stand längst fest, dass nichts mehr zu machen ist, dass das Baiz definitiv aus dem Haus raus muss. Baiz bleibt! – der Slogan, der zu dem Zeitpunkt schon zahlreiche Widerstandsaktionen begleitet hatte, der immer noch an vielen einschlägigen Wänden klebt – galt da schon nicht mehr. Stattdessen war das einzig Sichere die Zehnjahresfeier im Dezember, und danach eine ungewisse Zukunft. Klar: Es sollte weitergehen, irgendwie, irgendwo.
Über eine Stunde begleitet der Film die Baiz-Crew bei der Suche nach einer neuen Bleibe. Er zeigt aber auch, und das sehr gelungen, dass eine Kneipe – diese Kneipe – so etwas wie die Seele des Kiezes (oder dessen, was noch davon übrig ist) sein kann. Er zeigt, was für ein Schatz verloren gehen würde, was für eine Institution solch ein Ort sein kann. In der relativ kurzen Drehzeit konnte Wisotzki einen guten Überblick über das breite Spektrum einfangen, dass das Baiz bot:
Vom klaren politischen Anspruch der linken Schülerzeitung Zeitung einer linken Jugendgruppe („Wir schreiben ja auch für Arbeiter und Lehrer!“) bis zur Altherrenschachrunde trafen sich hier die unterschiedlichsten Menschen. Über 20 Veranstaltungen im Monat gab es durchschnittlich, viele davon von Gästen und Umfeld selbst organisiert.
Der Film zeigt Ausschnitte von Auftritten der Schauspielsparte aus Weissensee bis zu Ahne (der mit einem Baiz-Zwiegespräche-mit Gott-Special vertreten ist) und Leander Sukov ebenso wie Konzerte vom Singenden Tresen über Piet Botha bis zu YOK(pocketpunkQuetschenpaua). Wobei diese Aufzählung reichlich unvollständig ist.
Und dann wirklich: Neue, brauchbare Räume sind zu haben, keinen Kilometer entfernt. Großartigerweise braucht man dank der breiten Unterstützung von Kundschaft und Freunden nicht mal eine Bank zur Finanzierung, das wäre ja auch noch schöner… Zwar muss die Viertelmillion über die nächsten 15 Jahre irgendwie zurückgezahlt werden, aber: Niemand schmeisst uns mehr raus!
Umbau und Umzug werden geplant. Die Idee wächst, aus Letzterem ein eindrucksvolles Symbol gegen den Ausverkauf der Stadt zu machen. An die Umzugsmenschenkette, die sich im Februar letzten Jahres die Schönhauser Allee hochschlängelte (und sich als roter Faden auch durch den Film zieht), mag sich vielleicht der eine oder andere noch erinnern. Immerhin: an ihr kam am Ende nicht einmal die Abendschau vorbei.
Diese Bilder, trefflich kombiniert mit der Musik, sind sicherlich einer der Höhepunkte des Films. Finale und Happy End schliesslich genau vor einem Jahr: Die Neueröffnung. So in etwa könnte eine Kurzbesprechung von Baiz bleibt…woanders aussehen. Vielleicht müsste noch etwas rumgekrittelt werden; der Musikeinsatz war oft gelungen bis hervorragend, der Ton manchmal nicht so sehr. Kann die Unschärfe als charakteristischer Charme ausgelegt werden? Gab es da nicht zwei oder drei Szenen, auf die man auch hätte verzichten können?
Keine Frage jedoch, dass der Film unbedingt zu empfehlen ist – derzeit leider nur auf DVD, hoffentlich bald auch wieder vor größerem Publikum.
***
Doch ich kann kein unvoreingenommenes Urteil zum Baiz und zum Baizfilm liefern – im Gegenteil, ich wüsste gern, welchen Eindruck man gewinnt, wenn man keinen Bezug zu dem Laden hat.
Nachdem ich ein halbes Jahr wieder in Berlin wohnte, war es das Zehnjährige, zu dem ich mich das erste Mal wieder halbwegs unter Leute begab. Schon allein deshalb, und natürlich wegen dem Gentrifizierungsscheiss. Doch eigentlich muss ich noch weiter ausholen, kurz eine Geschichte von noch viel früher erzählen, der Vollständigkeit halber:
Auf dem Weg von der Uni nach Hause landete ich als frischgebackener Student ziemlich schnell ziemlich oft im Bandito, und blieb dort meist sehr lange hängen. Billiges Bier, Kulturprogramm und Vokü, aber vor allem ein Umsonstkicker. Durchweg überzeugende Argumente; soweit, so toll. Der Kicker hatte allerdings einen Haken, der auch oft hinter dem Tresen stand und überhaupt ein netter Zeitgenosse war. Bald nannten wir ihn – nur halb im Scherz – den Meister.
Über die Jahre machten wir so manches Mal mit ihm den Laden zu und versackten noch irgendwo anders in der Gegend. Über die Jahre kam es auch manchmal – ganz selten – vor, dass wir gegen ihn gewannen. Mal verbrachten wir mehr Zeit dort, mal weniger. Leute gingen, Leute kamen, Leuten kamen wieder, Leute blieben weg. Auch wir.
Irgendwann meinte Matthias (der inzwischen seltener kickerte, weil er wie wir alle älter wurde, und ein paar Jahre Vorsprung hatte er ja sowieso), dass es vielleicht einen Versuch wert wäre, zusammen mit einem anderem Freund aus dem Haus direkt um die Ecke eine weitere gute Kneipe aufzumachen, oder besser gesagt: Überhaupt eine Kneipe. Oder besser gesagt: Eine Kultur- und Schankwirtschaft. Denn das Bandito teilten sich die unterschiedlichsten Gruppen an den verschiedenen Tagen, selbstverwaltet und so weiter.
Also: Schon kommerziell, doch so niedrigschwellig wie möglich. Und auf alle Fälle ein ambitioniertes, breites Kulturprogramm, Politik ja sowieso. Wieso sollte man das nicht einfach mal wagen?!
Nicht viel später standen wir mit Farbe und Pinsel in den Räumen Christinen- Ecke Tor. Und inzwischen – eigentlich kommt es mir auch gar nicht so viel später vor, auch weil meine Besuchsfrequenz in letzter Zeit sehr zu niedrig ist – hat dieser Laden ein zehnjähriges plus ein einjähriges Jubiläum auf dem Buckel, eine Verdrängung überstanden und ihr sowas von den Mittelfinger gezeigt. Kann man eigentlich gar nicht glauben. Muss man gesehen haben.
* KBKLKB – Kein Bex, kein Latte, kein Bullshit. Singt Yok und stand auf der alten Baiz-Markise. Und dann auch noch Selbstbedienung.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=8lUi1zmzhxQ&w=560&h=315]
Gemerkt, dass man nicht alles haben kann: lesen, schreiben und leben. Jedenfalls nicht, wenn noch täglich acht Stunden mit geregelter Tätigkeit verbracht werden, die zwingend frühaufstehen voraussetzt und anderthalb Stunden bahnfahren als Dreingabe bietet. Deswegen zieht das Lesen den Kürzeren, es reicht gerade mal, um morgens kurz den feedreader zu durchforsten und alles Interessante in die Lesezeichenliste zu packen. Sonntagmorgen fragt der Browser dann, ob ich wirklich 76 Tabs öffnen will. Ja, habe ich denn eine Wahl?!
***
Angesichts der morgendlichen Massen in der U7 war ich kurz davor, wieder mit den längeren Podcasts anzufangen, da ich nun wirklich nicht im Stehen und von allen Seiten bedrängt lesen mag. Doch dann probierte ich als Alternative die Ringbahn aus, und dort gibt es, entgegen dem schlechten Ruf der S-Bahn, immer einen Sitzplatz für mich. So konnte ich mit Kischs „Marktplatz der Sensationen“ anfangen, Aufbau Verlag, 1981 – damals 3,80 Mark (der DDR), letzte Woche blind für einen Euro gekauft. Läuft das schon unter Wertsteigerung?
Jedenfalls: Blind gekauft, wie gesagt, ich vermutete eine Sammlung bunt zusammengewürfelter Reportagen, doch eigentlich ist es eine Art loser Selbst- und Weltbeschreibung. Erinnert mich in Vielem an Zweigs „Erinnerungen eines Europäers“, das ich vor knapp einem Jahr las.
Was mir bei beiden Büchern durch den Kopf ging – und in ihrem Vergleich, ihrem Zusammenspiel noch mehr auffällt: Dass wir heute die deutschsprachige Literatur (und, gottbewahre, gar die deutschsprachige Kultur) jenseits der Landesgrenzen so gut wie komplett ausgeblendet haben. Wie Zweig das k.u.k.-Wien beschreibt, komplementär dazu Kischs k.u.k.-Prag, da bekommt man eine leichte Ahnung davon, wie vielfältig und reich die deutschsprachige Literatur mal war. Was wissen wir heute über die österreichische oder gar schweizerische Kulturszene? Eigentlich gilt nur noch Berlin – als Gegenstimme aus den Provinzen gibt es ein paar Krimis, das war es dann aber auch. Ansonsten: Frankfurt bzw. Leipzig, wenn mal wieder Messe ist (und ich mich, zumindest bei letzterer, wieder ärgere, dass ich es nicht dorthin schaffe. Aber immerhin hatte ich gestern Abend eine Messebesucherin im U-Bahn-Waggon, die in ihrem lautstark geführten Telefonat eine kostenlose lebensnahe Schilderung für alle Passagiere feilbot.)
***
Apropos Berlin: Ich meinte zu dem wankelmütigen, liebenswerten Hauptmieter-Mitbewohner, dass er sich doch mal entscheiden soll. Ich fürchte, er entscheidet sich für das Geld. Dann geht es wohl entweder in den Wedding, wo ich in letzter Zeit eh‘ relativ oft Bier trinken gehe, oder ganz weit weg. Ich wage nicht zu hoffen, in Kreuzberg bleiben zu können.
***
Einer der Höhepunkte dieser Woche: Meine Lieblingsfigur aus Breaking Bad (was ich, wie ich inzwischen festgestellt habe, viel zu schnell hintereinander schaute) – Mike Ehrmantraut – bekam beim Spin-off Better call Saul eine Episode nur für sich & seine Hintergrundgeschichte. Und mit dieser einen Folge hat er meiner bescheidenen Meinung nach alles an die Wand gespielt, was bisher aus dem BB-Universum zu uns vordrang.
Ein altes DDR-Ferienlager, größtenteils im Originalzustand.
Die Gruppe schläft zusammen in einem Raum, Doppelstockbetten.
Ein Zwei-Stunden-Spaziergang durch den Wald, dann über den alten Truppenübungsplatz, die Hunde viel zu beschäftigt, um sich den Weg zu merken.
Verlassene Schiessstände, kleine Betonbaracken, zugetaggt.
In einem Größeren ein ausgeschlachteter Trabi.
Der Schnee schmilzt, doch noch ist genug von ihm da.
Das Holz, im Wald aus dem Schnee gefischt, gibt doch ein gutes, ein schönes, ein perfektes Lagerfeuer. Stundenlang.
Knisterndes Feuer, verpasste Gelegenheiten. Stundenlang. Dann Nebel.
Die Stadt weit genug weg: kein Lärm, kein Knallen, keine pünktlich terminierte Fröhlichkeit.
Und doch: Irgendwoher taucht die obligatorische Magnumsektflasche auf, die keiner trinken will & die dann doch irgendwann leer ist.
Aufgeweckt von der Sonne, die den Schnee verscheuchte. Auch in diesem Jahr hat jede Medaille also mindestens zwei Seiten und der Hof ist voller Pfützen.
Erste kleine Dramen, erste Beruhigungen.
Zum Bus, schon wieder im Dunkeln, schon wieder Frost. Glatteis statt Schnee auf den Wegen.
An der Haltestelle Knöpfe, die man drücken muss, will man mitgenommen werden. Was trotz unserer inkompetenten Bedienung funktioniert.
Die Stadt empfängt uns in ihren Vororten mit absurd blinkenden Vorgartenschmuck. Lichtvöllerei.
Tagelang noch das Gefühl, nicht angekommen zu sein, weder im Raum, noch in der Zeit.
Es war gut, es war die richtige Entscheidung.
„Sich nur mit einfachen Leuten zu umgeben, das ist ja auch ganz schön einfach.“ sagte ich, als der Mitbewohner sein Augenbrauenrunzeln wegen der Paranoia der Nachbarin über das gesamte Gesicht verteilte. Sie sah in jedem vor der Tür parkenden Auto einen Schnüffler der Hauseigentümer, abgehört werden wir auch, natürlich.
„Versteh ich nicht.“ Meinte der Mitbewohner. Ich erklärte ihm, dass die gute Frau zweifelsohne einen Knall hat, also beileibe nicht einfach sei, ganz im Gegenteil, aber doch trotzdem unsere Unterstützung verdient. Klar, ein paar Wahnvorstellungen, wortreich ausgeschmückt und gepaart mit dem naiven Rassismus der geborenen Kreuzbergerin mit italienischem Vater, das alles in einem Redefluss, der gerade tosend einen Felsabgrund herunterstürzt – das kann einen durchaus sprachlos machen, nicht nur, weil man eh nie zum Zuge kommt. Aber es kann auch eine Herausforderung sein: Den Rassismus bloßzustellen und zu dekonstruieren, auf eine Erkenntnis hoffend; ähnlich vergeblich wie die Verschwörungstheorien und Privatsendernews zu entkräften.
Hat man nur Leute um sich, die nicht den geringsten Widerspruch in einem auslösen, dann entgehen einem all die Möglichkeiten, andere und sich selbst zu hinterfragen. Erklärungen zu finden und zu liefern. Vor Augen geführt zu bekommen, was in manchen Köpfen so für Gedanken rumschwirren, bei denen man annahm, dass auf soetwas ja wohl wirklich niemand reinfallen könnte.
Sicher, die Geduld reicht nicht immer aus, und jeden Tag das Gleiche zum gleichen Thema erzählt zu bekommen, hat mich in letzter Zeit sowieso dünnhäutig und missmutig werden lassen. Vor allem, da ihr Konterpart aus dem Stock drüber ebenfalls täglich zum gleichen Thema vorspricht. Viel elaborierter, mit grundsolidem intellektuellen Fundament, etwas zu selbstgefällig vorgetragen und angestrengt schlau daherkommend, aber eben genau so ausführlich wie die Paranoia-Verdächtigungen.
Sie wissen, glaube ich, wie sie es zu nehmen haben, wenn ich mich wie kürzlich dem ewiggleichen Thema verweigerte, deutlich sagte, dass es mich anwidert, vor allem, da nichts passiert, da nur spekuliert wird. Sie nahm es auch nicht krumm, dass ich vor Monaten nur knapp meinte „Vergiss das ganz schnell, das ist Schwachsinn, wirklich. Glaub mir.“ Damals wurde noch über dies und das gesprochen, in besagtem Fall, so machte es den Eindruck, hatte sie gerade Galileo geschaut und ist dabei irgendwie auf den Chemtrail-Trichter gekommen. Immerhin erst vor ein paar Monaten.
Also: Sich immer nur mit einfachen Menschen zu umgeben, das wäre doch zu einfach, oder? Oder liegt es daran, dass sie bei ihren beinahe täglichen Besuchen die besten Grastüten weit und breit mitbringt?
05.05.14
Ach was, von wegen friedliche Zeiten:
Dummes Zeug von Menschen, die es besser wissen müssten.
Beschwören ihr Europa, hat ja so viel Frieden gebracht
und garantiert.
Als ich ankam in diesem Europa,
rüstete es sich gerade zum Einmarsch
zusammen mit dem großen Bruder
Leader of the free world
um die Wiege der Zivilisation
platt zu machen.
Aber das war ja weit weg.
Und trotzdem gingen wir auf die Strasse
statt in die Kasernen.
Ein paar Jahre Ruhe
und Ernüchterung später
tobten die Gräuel dort
wo ich als Kind glaubte,
das Paradies auf Erden
gefunden zu haben.
Jetzt rückten einige von uns
in die Kasernen ein: zivilisiert –haha!-
in ordentlichen Uniformen.
Arbeitsplatz sicher bis zum Tod,
Karrierechancen immerhin,
sowas wächst in der Provinz
nicht auf den Bäumen.
Andere zogen eher verwegen,
verschlagen und verblendet
in die Schlacht,
als Handlanger und Handschar
der jeweiligen Nationalisten.
Eine bahnbrechende Wahl später
eröffneten dann die regierenden Friedensaktivisten
– wer waren denn die Guten, wenn nicht sie! –
drei Ecken weiter das nächste Gemetzel.
Begründung: Auschwitz.
Für einen weiteren Krieg reichte der Atem noch:
Wegen der Solidarität, wir waren jetzt schliesslich
alle Amerikaner.
Der nächste wurde dann aber ausgelassen,
wegen der Wahlen, und ausserdem
waren wir da doch schon mal.
Seitdem ist die Lage unübersichtlich,
erst wurde mit implodierenden Banken geschossen,
die in Europas Süden verwüstete Schlachtfelder hinterliessen.
Doch nun endlich wird auch wieder Platz gemacht
in den Munitionsdepots der Militärs,
um dem Russen zu zeigen,
was so eine richtige Harke ist.
Mitten im ach so friedlichen Europa.
Derweil gibt es immer mehr von denen,
die den Krieg erlebt, gesehen, erkannt.
Zurückgekehrt mit einer neuen Diagnose
für den alten Wahnsinn, dem man verfällt,
der einen schüttelt, für Jahre die Sprache
oder den Verstand raubt.
Weil das Töten so leicht und distanziert geworden ist,
wird es Zeit, dass denen,
die begeistert in den Krieg ziehen
oder andere hineintreiben
dieser Krieg entgegenkommt
und sie mal in ihren eigenen vier Wänden
besucht.
Seit Wochen rollen die Panzer
nun mitten durch Europa,
oder brennen aus, weil zu allem
Überfluss da genügend Leute
mit Panzerfäusten rumlaufen.
Seit fünfzig Jahren Garant
für Frieden und Sicherheit
my ass!
Ich werde durch einen schmalen Spalt gezerrt. Das massive Stahltor – eines von so vielen in dieser Stadt, an denen man achtlos vorbeigeht und sich nie fragt, was sich wohl dahinter verbirgt – bewegte sich kurz davor wie von Geisterhand gesteuert um dreissig oder vierzig Zentimeter nach rechts, gerade breit genug, um nacheinander durch die Öffnung hindurchzuschlüpfen. Oder gestossen zu werden.
„Bitte kommen Sie mit, zur Klärung eines Sachverhalts!“ sagte die zierliche Frau, bevor sie mich am Arm packte und in eine kleine Nebenstrasse manövrierte, Richtung Stahltor, wie ich jetzt weiss. Berlin Mitte, es ist der 11. Oktober 2014, vielleicht halb elf abends, die Nacht liegt dunkel und nasskalt über der Stadt. Oder war es doch schon Wedding? Ich habe die Orientierung verloren, kein Wunder, so wie ich in den letzten Stunden durch die Stadt geirrt bin.
Schweigend gehen wir nebeneinander die Auffahrt hinunter. Meine Frage nach dem Wohin wurde mit einem spöttischen Lächeln ignoriert, also werde ich keine weiteren Kommunikationsversuche unternehmen, denke ich mir. Schweigen ist Gold. Das Tor schliesst sich hinter uns und die Frau lässt jetzt wenigstens meinen Arm los. Unten angekommen werden wir von einer weiteren Person empfangen: strenger Blick, der Griff nach meinem Rucksack. Wir befinden uns in einem Krematorium.
Wenige Augenblicke zuvor, als wir auf das sich öffnende Tor zusteuerten, brüllte noch jemand von der Strassenecke ein paar Meter weiter: „Was ist das denn für eine Scheisse, Verfassungschutz oder was? Fangt ihr die Leute jetzt schon von der Strasse weg oder wie?!“ Wohl eine der wenigen nicht kalkulierbaren Aktionen an diesem Abend, aber es machte nichts, es war nur ein einsamer Rufer. Ich hatte keine Zeit, mich umzudrehen, sein Gesicht zu erkennen oder einen Hilferuf abzusetzen. Ich war schon längst in den weissgekachelten Räumen.
Noch vor einer Stunde hatte ich Angst, meinen Kontakt zu verpassen. Ich wartete an der Tram-Schleife vor dem Jahn-Stadion auf einen Anruf, doch das Feuerwerk dort war so laut, dass ich fürchtete, das Klingeln des Telefons nicht zu hören. Nur wenige Minuten später war mir jedoch klar, dass Sie mich im Blick haben, ständig. „Warten Sie, bis der Mann in der schwarzen Jacke aufsteht, dann dürfen Sie weitergehen.“ sagte die Stimme am Telefon.
Es war nicht weit entfernt von einem relativ belebten Platz, als die kleine Frau meinen Oberarm ergriff. Irgendein türkisches Fest wurde dort gefeiert, Kinder standen in einem Kreis und tanzten, die Erwachsenen klatschten den Rhythmus dazu. Die Lichter der Spielotheken, Kneipen und Spätis beleuchteten die breite Strasseneinmündung; kein Zwielicht, nichts, wovor man Angst haben müsste, eigentlich. Ich war gerade dabei, das Vermissten-Plakat mit dem Antlitz von Murat Kurnaz, das an einem Stromverteilerkasten hing, etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, im Begriff, es abzureissen, auf der Suche nach einem Hinweis. Ich dachte, das wäre mein Auftrag gewesen. Dann der Griff, das Tor, der Spalt und die Kacheln.
Inzwischen sitze ich auf einem unbequemen Hocker in einem langen, schlauchigen Raum. Vor mir ein Schreibtisch, darauf ein Stapel Papier und eine Lampe, die mich blendet. In meinem Rücken wäscht sich die zierliche Frau gerade die Hände, dann raschelt etwas. Eine Tüte? Für meinen Kopf? Ich will mich nicht umdrehen, sondern mustere lieber so unauffällig wie möglich meine unmittelbare Umgebung.
So oft habe ich darüber gelesen, und immer wieder hiess es: Anna und Arthur halten das Maul. Nach allem, was ich an diesem Abend erlebt habe, scheint mir das auch die beste Lösung zu sein: Keine Spielchen spielen, kein Kräftemessen mit der älteren Frau, die mir, inzwischen auf dem viel bequemeren Stuhl auf der anderen Seite des Tisches sitzend, schweigend in die Augen starrt. Stattdessen versuche ich, das „Kein offenes Feuer“-Schild zu fixieren, das ein paar Zentimeter über ihrem Kopf an der Wand hinter ihr auf den weissen Kacheln klebt, möglichst unverkrampft. Was folgt, ist das grelle Licht. Und Schweigen: Ihres und meines.
Ich beginne, Kacheln zu zählen und Szenarien durchzuspielen. Auf dem Tisch liegt meine Akte, eine stumme Anklage, doch sie genügt vollkommen, bedarf keiner Worte. Ich bemerke, dass eines der Oberlichter in dem langen, schmalen Raum blank liegt, seine Verkleidung heruntergeklappt wurde. Die zwei Neonröhren, auf halbem Weg zwischen mir und dem Schreibtisch an der Decke hängend, scheinen selbst ausgeschaltet angriffslustig in meine Richtung zu zwinkern. Schräg hinter mir höre ich auf einmal Wasser tropfen.
***
Als ich mit dem Freund und Mitbewohner auf der Suche nach ein oder zwei OZ we miss you-Stickern für unseren Kreuzberger Kühlschrank durch Hamburgs Straßen lief, erzählte er mir von einer Idee für das folgende Wochenende: Sie würden beide nach Berlin kommen und es gäbe da ein Projekt von ihren Münchener Leuten, das ziemlich aufregend und spannend klang. Und das mich letztendlich auf den unbequemen Hocker in dem stillgelegten Krematorium gebracht hat.
Nachdem ich dort ungefähr 15 Minuten hin und herrutschte und mit den Händen rang (meine Variante des Vorhabens, keine Nervosität zu zeigen), hörte ich hinter mir die Tür klappen. „Okay, es ist vorbei. Du bist erlöst, S. ist schon hier und wartet nebenan auf dich, A. braucht noch eine dreiviertel Stunde, ungefähr.“ Die Stimme gehörte Christiane Mudra, und es war mein Schlusssatz in ihrem Überwachungsexperiment YoUturn.
Sie und ihr Team haben mich in den gut zwei Stunden davor quer durch Mitte und Wedding gelotst – eine von mehreren möglichen Routen, in meinem Fall auf den Spuren der deutsch-deutschen Teilung und ihrer Konsequenzen.
Anfangs glich es einer Schnitzeljagd: In Mauerspalten oder unter Weinranken galt es, verborgene Botschaften zu finden. Neben dem Hinweis auf das nächste Versteck befand sich auch immer eine Stasi-Akte, ein NSA-Dossier oder ein Vernehmungsprotokoll in den Unterlagen. Während man sich von Station zu Station vorarbeitete, dabei das Papier in der Hand, die Informationen überfliegend, kam immer mehr ein Gefühl von Gehetztsein auf. Dazu dann noch die Anrufe, die einen durch die Stadt dirigierten und Anweisungen gaben: „Spielen Sie jetzt Track 3 ab!“ Oder der erschütternde Brief einer Mutter, deren Sohn von der Stasi umgebracht wurde, weil die Eltern ausreisen wollten. Handgeschrieben, mit einer Blume auf dem Gedenkstein an der Bernauer Strasse abgelegt. Spätestens, als ich zögerte, ihn von dort wegzunehmen – das musste ja meine Botschaft sein – begann es, ernst zu werden; begann ich, mich darauf einzulassen.
Nach ungefähr einer halben Stunde war der Kloss im Hals verschwunden, der Druck auf der Brust konnte mit großen Schlucken aus der Augustiner-Flasche bekämpft werden (richtig verschwunden war er aber erst am nächsten Morgen). Bis die letzten „Zuschauer“ angekommen waren und wir die gelungene, von uns allen für großartig befundene Vorstellung feiern konnten, war noch etwas Zeit für die Dokumentation des Stückes: Aufgebaut neben dem improvisierten Verhörraum, stilgerecht dort untergebracht, wo man nun mal die Leichen im Keller hat – im Kühlraum des Krematoriums, gegenüber der Wand mit den Reihen quadratischer Türen, die allerdings alle verschlossen waren.
Später, in irgendeiner Weddinger Kneipe, wurde noch viel über das Stück, dessen Entstehung, die hunderten geführten Interviews und die verschiedenen Erfahrungen damit in München, Potsdam oder eben jetzt in Berlin geredet. Natürlich gab es dabei auch immer unverhofft komische Situationen, etwa, als die Akteure in einen Polizeiaufmarsch gerieten und das Ganze für Kulisse hielten. Oft waren die Erlebnisse aber erschreckend: Wie einfach man Menschen von der Bildfläche verschwinden lassen kann, am helllichten Tag. Wie wenig Einsicht es gibt – damals ja … aber jetzt doch nicht, nicht bei uns… Viel zu selten regt sich Widerstand.
Hoffnung? Nun ja, eine ganze Weile nach dem Ende des Stückes kamen wir nochmal auf meine „Verhaftung“ zu sprechen. Bis dahin hatte ich fest angenommen, der einsame Rufer gehörte zur Crew. War aber gar nicht so. Immerhin…
* Auf die Überschrift bin ich natürlich nicht von alleine gekommen….
Seit langer, langer Zeit war ich mal wieder im Kino. Früher passierte das ständig, dort war schliesslich der Arbeitsplatz der Beinaheangetrauten und in irgendeinem der Yorck-Kinos lief immer was Besseres als im Fernsehen. Da ich nun aber nicht mehr über die magische Freie-Eintritt-Karte verfüge, das Internetstreaming ganz vernünftig läuft und ich Unterhaltungsfilmen alleine nicht viel abgewinnen kann – im Gegensatz zu Serien – verzichtete ich seit mindestens zwei Jahren auf jeglichen Kinobesuch.
Es war auch eher ein Zufall – ein glücklicher, wie sich herausstellte (wie immer erst im Nachhinein, vorher ist man ja nie schlauer): Eine Freundin meldete sich spontan, und da ich sie in den letzten Wochen sträflich vernachlässigt hatte, suchte ich in den einschlägigen Programmen nach einer kulturellen Abendveranstaltung. In die engere Auswahl kam ein Konzert im Schokoladen oder … Moment, das klingt gut, da würde ich sogar alleine hingehen: Ein Dokumentarfilm zur Gentrifizierung, Premiere an diesem Abend im Moviemento.
Verdrängung hat viele Gesichter lautete der Titel, den Inhalt habe ich nur kurz überflogen; wo das Thema gerade Konjunktur hat, nehme ich besser alles dazu mit, bevor es in den Mottenkisten der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten verschwindet. Als ich am Telefon die Karten reservierte, fiel mir auf, dass ich noch nie im Moviemento war: Wir schafften es früher immer nur ins Yorck, zum Rollberg, Passage oder Babylon – oder eben in das tolle alte Kino in Charlottenburg, wo Madame arbeitete und Buck manchmal verknautscht aus seinem Büro lugte.
Vor dem Kino angekommen, das dank seiner Ecklage und trotz des Schildes leicht zu übersehen ist, versammelte sich ein Publikum vor der Tür (Raucher, klar), wie man es in Kreuzberg nicht anders erwartete: Unterschiedlichste Altersgruppen, aber durchgehend bunt und mal mehr, mal weniger aus dem Rahmen gefallen. Und durch die Maschen des sozialen Netzes auch, hier war ich Gleicher unter Gleichen. Passend dazu näherte sich vom Kotti her eine Ein-Mann-Demonstration, zuerst nur akustisch wahrzunehmen: Ein älterer Mann, ein Türke vielleicht, fuhr gemächlich auf seinem über und über mit Plakaten geschmückten Fahrrad den Kottbusser Damm entlang und hielt dabei ein Megafon Richtung Bürgersteig, aus dem von Band abgespielte Wortfetzen zu hören waren – der Verkehr auf der vierspurigen Strasse und die verstärkten Doppelauspuffrohre des örtlichen Macho-Nachwuchses liessen mich nur etwas von „Bleiberecht für alle Flüchtlinge“ verstehen.
Verglichen mit den anderen Gentrifizierungs-Dokumentationen ist diese schon speziell: Relativ schnell wird klar, dass es sich hier nicht um den üblichen, professionellen Reportage-Journalismus handelt. Die eigene Betroffenheit scheint sowohl Auslöser als auch Themenschwerpunkt zu sein, Verdrängung hat viele Gesichter wurde von einem Kollektiv geschaffen, von Menschen, die zwischen Ost und West, zwischen Kreuzberg und Friedrichshain wohnen – irgendwo in dem Zipfelchen Treptow, das längst aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist und jetzt von Baugruppen erobert wird.
Das ist eine zweite, angenehme Überraschung: Nicht der große Blick, der möglichst alle Aspekte darstellen will, sondern ein kleines Phänomen, welches auf den ersten Blick auch gar nicht problematisch scheint, wird hier thematisiert. Menschen, die früher vielleicht selbst mal Häuser besetzt haben, sich überwiegend als linksalternativ verstehen und verwundert zur Kenntnis nehmen müssen, jetzt auf einmal die Bösen sein zu sollen, wo sie doch selbst nur den steigenden Mieten, die sie sich in zehn Jahren in der Gegend nicht mehr leisten können werden, entgehen wollen. Deshalb suchen sie den Ausweg im Modell der Baugruppe – keine Hedgefonds, sondern kleinteilige Zusammenschlüsse privater Investoren, die sich ihre eigenen vier Wände bauen. Was kann denn daran schlimm sein, fragen sie und wahrscheinlich auch viele aus dem Publikum, die sich mit diesem Thema noch nicht näher beschäftigt haben.
Obwohl der Film klar Stellung bezieht, wird niemand über die Maßen vorgeführt oder blossgestellt und es werden eben auch solche Fragen zugelassen, jedoch nicht, ohne eine Antwort darauf zu geben: Zuerst einmal das auch von einigen Protagonisten der „Gegenseite“ schliesslich erkannte Eingeständnis, dass sie vom puren Egoismus getrieben sind, selbst nicht unter die Räder zu kommen und es in diesem Falle eben ein Kollateralschaden ist, wenn dies anderen passiert; Hauptsache Sicherheit, auch in zehn Jahren noch. Dabei gibt es auch andere, sozialere Möglichkeiten, wenn man schon neu bauen möchte: Genossenschaftliche Modelle oder das Mietshäusersyndikat bieten hier Alternativen abseits von Wohneigentum, genauso sicher und planbar, nur kann man in Zukunft halt keinen Reibach damit machen. Um nur ein Beispiel zu nennen.
Die Stärke des Films sind die Geschichten der Porträtierten, egal, welchem Lager sie angehören: Das Dilemma der Baugruppenmitglieder wird ebenso deutlich wie die Absurdität der Politik und die Ausweglosigkeit der betroffenen Anwohner – ob das nun der stille, trotz seiner Situation erstaunlich unverzweifelte Buchhändler ist oder die Berliner Pflanze Moni, Jahrgang ’56 und seitdem mit großer Klappe und großem Herz im Kiez unterwegs. Die in einem Nebensatz ganz dezent darauf hinweist, dass das, was jetzt gerade um sie herum passiert, beileibe nicht die erste Verdrängung ist: Man erinnere sich nur mal an die Umstellung der Ostmieten auf das Westniveau, kombiniert mit dem Verlust des Einkommens durch Arbeitslosigkeit wurden dadurch schon damals nicht wenige an den Rand der Stadt und der Gesellschaft gedrängt.
Es ist müßig, auf alle großartig gelungenen Szenen (die Schuhe des Baustadtrats!) einzugehen, und selbstverständlich hat auch dieser Film seine Schwächen (Ich glaube, das, was ich persönlich am Meisten zu kritisieren habe firmiert unter dem Begriff Sounddesign). Da sich das Filmkollektiv auf die eigene kleine Lebenswelt konzentrierte, fehlt auch die große Anklage: Die Systemfrage wird nicht gestellt. Wenn ich mich recht erinnere, taucht das Wort Kapitalismus nicht ein einziges Mal in dem Film auf – ein bisschen schade, denn solange mit Grund und Boden spekuliert werden darf und daraus teils astronomische Gewinne erwirtschaftet werden, führt kein Weg daran vorbei, dass wirklich jeder Schuld ist an der Gentrifizierung.
[nothing changed]
03.08.04
Du kannst dir jeden Tag
deine Meinung aus dem Leib brüllen,
Leserbriefe schreiben
und dich bei Call-Center-Sklaven
beschweren.
Du kannst Demonstrationen anmelden,
Kreuzchen machen
und Parteien gründen.
Doch was gut und böse
oder richtig und falsch
und vor allem zu tun ist,
entscheiden andere.
Zum Schluß
gewinnt immer noch der
mit der größten Knarre.
…der Kiezneurotiker. Und Felix Schwenzel auch. Und ihnen wird Gehör geschenkt, und dann wird wieder auf die Leute gehört, die auf sie hörten. Und dann … ist irgendwann das Internet voll mit von Hand kuratierten Linklisten. Da kann ich natürlich nicht aussen vor bleiben, die letzte Linkammlung hier ist ja auch schon eine ganze Weile her.
Nun dauerte das Durchforsten der abgelegten Lesezeichen mal wieder besonders lange: Alles nochmal lesen, abwägen, ob es sich lohnt und/oder sich thematisch überhaupt einfügen lässt in das Gesamtkunstwerk Linkliste – und nicht zuletzt nachschauen, ob man diesen oder jenen Inhalt nicht schon einmal verwurstet hatte. Da sich also einiges angesammelt hat im Laufe der Zeit gibt es jetzt sogar – trommelwirbel – Kategorien:
Ein Musikvideo, gleich zum Anfang. Um die Stimmung aufzulockern, es für die kommende, vielleicht schwere Kost der Textlinks leichter erträglich zu machen? Eher nicht, obwohl dieses Video durchaus gute Laune machen kann. Also – ich hatte vor einiger Zeit in den Kommentaren schon mal auf den Song „Der Tag wird kommen“ von Marcus Wiebusch hingewiesen. (Standardfloskel: Früher war der viel besser). Jetzt ist das Video dazu da, mit 30.000 Crowdfunding-Euros gedreht, wenn ich das richtig verstanden habe. (Wobei es auch wieder komisch ist, kurz vorher eine Summer of the 90’s-Doku auf arte gesehen zu haben, in der es um die Millionenbudgets für die Clips damals ging) Das Ergebnis kann sich sehen lassen, ganz gut gemacht, schönes Konzept, wie ich finde:
Dazu noch ein paar kurze Anmerkungen: Das Video zeigt sehr schön, dass das Internet nicht gut oder böse, sondern mindestens beides ist (ich mag diese Kategorien ja sowieso nicht besonders). Einerseits: Das crowdfunding, das in diesem Falle geklappt hat. Andererseits: Die schamlosen homophoben Kommentare darunter. Es gibt also noch einiges zu tun und zeigt, wie nötig dieser Song (und dieses Video) sind. Ob es was bringt? Nun, meine Kristallkugel ist gerade nicht griffbereit und auch ansonsten bin ich ja eher ein Pessimist. Trotzdem sollte man es natürlich immer wieder versuchen. Sisyphos halt. Manchmal klappt es vielleicht sogar. Und wenn nicht, gibt es immer noch tolle Videos. Dieses hier, um ein weiteres Beispiel zu nennen, zu einem ganz anderen Zweck produziert.
Zum Abschluss und als Überleitung ein letztes Propagandavideo, dessen Anliegen ebenfalls nicht oft genug betont werden kann:
Hier scheint es also so, als ob der Protest etwas bewirkt hätte. Nur: Aaron Swartz hat sich aufgehängt. Das klingt nicht nach einem Sieg. Scheitern ist immer möglich. Womit wir schon beim nächsten Thema wären: Durch Robin Williams‘ Abschied wurde mal wieder anderthalb Tage lang über Depression und Suizid gesprochen. Für Andreas Biermann ist in den Tagesthemen niemand auf den Tisch geklettert, doch auch er hat seinen Kampf verloren. Denn genau so sehe ich das: Es ist ein Kampf, viele schaffen es, wenigstens ein Unentschieden rauszuholen, aber es kann durchaus auch schiefgehen, wenn die Dunkle Fee (die dir den einen Wunsch erfüllen kann) plötzlich aus dem Hinterhalt einen Überraschungsangriff startet. Ich würde jedenfalls in diesen anderthalb Tagen, die alle Jahre wiederkehren, gerne mehr komplexere Beiträge lesen anstatt – wie allzu oft – immer nur den Verweis auf den Werther-Effekt, damit kann ich nämlich eher wenig anfangen. Immerhin besser als die Abscheulichkeiten der Presse anlässlich des Suizids von Virginia Woolf. Letztlich muss das jeder mit sich selbst ausfechten: Der, der gehen will, und die, die übrig bleiben. Beides beschissene Situationen. Und bisher ging es ja nur und unzulässigerweise generalisierend um die Themen Depression und Suizid. Das lässt sich natürlich viel breiter auffächern: Intros und Extros, Autismus und so vieles mehr vom Krieg mit sich selbst müsste noch besprochen werden, allein – es fehlt die Zeit und die nächste Kategorie drängelt schon:
Auch in diese Gefilde soll eine kleine Brücke führen: Der Mythos von Genie und Wahnsinn hält sich ja hartnäckig, wohl nicht ganz ohne Grund. Wenn einem der Wahnsinn bestimmte Filter nimmt, schlägt sich das mitunter in genialen Resultaten nieder. Nachhelfen kann man da – auch aus medizinischen Gründen – mit diversen Drogen. Oder man kauft sich das falsche Steak. Doch sollen die erzählen, die sich damit auskennen: Bei Herbert Volkmann und Andreas Glumm scheint das ohne Zweifel der Fall zu sein.
Mit Letzterem sind wir dann auch schon mitten in den tollen Texten, die sich bei ihm zuhauf finden lassen (sagte ich das bereits?). Falls man sich je von diesen lösen kann, schlage ich vor, die Reise von Glumms Solingen in Richtung Thorges Hamburg fortzusetzen, sozusagen. Erst zu einem aus den Fugen geratenene Konzert der Beginner, dann dorthin, wo Berlin und Hamburg sich treffen.
Frau Haessys Reise führt dagegen mit dem Zug nach Bonn und Arno Frank verbrachte seine halbe Jugend auf einer Irrfahrt quer durch Europa. Auf Wirre Welt Berlin ist der Weg nicht ganz so weit, er führt lediglich das Treppenhaus runter in den Hof, spätnachts, weil es brennt. Stephanie Bart hat es da schon schwerer, eine Rikscha schiebend auf dem Oktoberfest.
Bei Nilzenburgers Geschichte zu Boris Becker spielt das Oktoberfest erstaunlicherweise keine Rolle, dafür führt er den Vorruf ein: Erlebnisse, die ich mit Persönlichkeiten hatte, die man vielleicht (mich eingeschlossen) ganz anders eingeschätzt hat. Fun Fact am Rande: Für diese Rubrik fiel mir zuerst ein Erlebnis mit Frank Zander ein. Könnt ich wirklich mal aufschreiben, dachte ich. Dann las ich den ersten Kommentar…
Der Literaturbetrieb, der etablierte, der sich etwa bei dem Berliner Literaturfestival gerade selbst feiert (oder betrauert) ist ja vor allem auch durch Preise, Stipendien und Wettbewerbe gekennzeichnet. Tante Jay hat einen preisverdächtigen Text darüber geschrieben, wie man einen Literaturpreis erringt.
Distinktion ist hierzulande in dieser Branche ja besonders wichtig, das U&E sozusagen. Da wäre es natürlich vermessen, Literatur mit Fussballspielberichterstattung oder Drehbuchschreiben in Verbindung zu bringen und gar zu empfehlen, voneinander zu lernen. Deshalb lieber schnell zurück ins sichere Unterholz der anerkannten, weil kanonisierten und ordentlich gealterten Literatur. Zu der gehört inzwischen ohne Zweifel die sogenannte Beatliteratur, auch wenn man ehedem ein extra Vokabelverzeichnis dafür benötigte (was mich irgendwie an die alljährlichen Jugendwort-Listen erinnert, ich meine, bitch please, sowas können sich doch auch nur Leute mit Immatrikulationshintergrund ausdenken, oder?).
KGB – so lautet die griffige Ab- und Verkürzung zum Thema Beat. Dass es natürlich mehr als Kerouac, Ginsberg und Burroughs in diesem Universum gibt, zeigt die Neuköllner Botschaft immer wieder (und demnächst mit einem eigenen Blog dazu). Katja Kullmann weist im Freitag auf die bedeutende, doch leider so gut wie vergessene Rolle von Diane di Prima innerhalb der Beatnik-Szene hin. Doch ganz ohne die namensgebenden Köpfe soll das Kapitel hier auch nicht enden: Holy Soul – eine Geschichte über den alten Allen Ginsberg.
…kann auch ein schönes Hobby sein. Jagdgebiete dafür gibt es einige, mein favorisiertes ist allerdings Georg Seeßlens Blog. Waidmanns Heil!
Bevor es hässlich wird, bevor wir mit den Armen bis zum Ellenbogen in der Scheisse rühren, die sich da um uns herum abspielt, noch schnell etwas Nostalgie als Reiseproviant. Einiges erscheint dabei so anders und weit weg, aber: some things never change, Mortimer. Also: Fangen wir an mit einem WDR-Bericht über „Raubkopierer“ aus dem Jahr 1986 – ich erinnere mich noch gut an einige der gezeigten Spiele, und an das ewige Spulen mit dem Kassettenlaufwerk.
Via Nante Berlin bin ich auf Starsky & Hutch aus dem Prenzlauer Berg, Berlin, Hauptstadt der DDR gestossen (aka Toto und Harry aus Ostberlin). Durchaus interessante Bilder aus dem Jahr 1985:
Nur ein paar Jahre später – genaugenommen knappe vier – und nur ein paar Strassen weiter eröffnet sich eine ganz andere Welt, festgehalten in einem Videodokument mit dem bezeichnenden Titel Kampftrinken Berlin ’89. Dessen Entstehung wird hier und hier näher beschrieben – ein schöner Kontrast zum realsozialistisch-piefigen Vopo-Ostberlin. Gewonnen hat übrigens Wolfgang Hogekamp, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zehn Jahre nach diesem historischen Ereignis lernte ich Hogekamp als Spoken-Word-Aktivisten beim Bastard-Slam kennen. Inzwischen hat er sich wohl die Bezeichnung Veteran redlich verdient, auch wenn er immer noch aktiv ist.
Die 90er kamen und gingen, ein neues Jahrtausend brach an und in Berlin grölten die Säufer wie eh und je, wahre Poesie. Berlin bleibt eben Berlin, im Guten wie im Schlechten. Wie weit ist denn etwa die Cuvrybrache von Barackia entfernt? Besser wird es jedenfalls nicht, weder in Berlin noch generell, mit der Technik, den Neuen Medien und dem Tonfilm.
Nun denn, wir kommen ja nicht drum herum: Die harte Realität also. In der das Kopfwaschen mittels Eiswasser als große Tat zelebriert wird. Zum Glück ist dazu schon alles gesagt bzw. geschrieben worden. So können wir uns den wichtigen Dingen zuwenden: Irgendwo in diesem Land hingen mal wieder eine Weile lang ununterscheidbare Plakate an Laternenmasten – es waren Wahlen. Die Aktion Doppelstimme hatte leider einen wohl etwas unerwarteten Ausgang und so sitzen demnächst jede Menge sauerkrautfurzender Kartoffelfressen in den Parlamenten. What’s new?! Deren Anhänger natürlich genauso wenig Nazis sind, wie diejenigen, die unpolitischen Rechtsrock hören. Kein Scheiss!
Ansonsten? Der Krieg feiert Geburtstag und allerorten fröhlich Urständ, Volker Strübing macht sich dazu Gedanken und ein paar sehr schöne Collagen. Viel zu selten wird der Empfehlung Klaus Baums Beachtung geschenkt, viel zu wenige versuchen sich in Detailarbeit – aber alle schimpfen auf die Presse, die Lügenpresse, die Propagandapresse, die Systempresse; aus allen Blick- und Schussrichtungen natürlich. Dabei aber immer sicher auf dem Sofa oder vor dem Schreibtisch sitzend, an der Front – dort, wo gestorben, wo elendig verreckt wird – sind andere, unter ihnen auch Journalisten und Fotografen. Mit ganz viel Glück entstehen dann aus dem Elend ganz großartige Bilder, ein altes Dilemma der Kunst. Oder stumpfe Propagandafilme.
Bei allem berechtigten Journalisten(darsteller)bashing, aber auch in der Blogwelt, in der Alternativen zum Holzmedienjournalismus längst angepackt sind, fehlt es meist an einem wichtigen Aspekt, wie sich auch gerade an den sehr bedauerlichen Vorgängen rund um Carta zeigt: Die Systemfrage. Bei der landet man über kurz oder lang immer wieder, sorry. Wenn das Ziel Gewinnmaximierung ist, dann ist das eben so, deal with it. Oder kritisiere es, kurz und knackig oder gern auch etwas ausführlicher.
Es ist zum Verzweifeln, keine Frage, da kann man auch schon mal etwas expliziter werden in der Sprache. Ob ich eine Lösung habe? Klar:

via.
PS./Update: Kurz nachdem ich auf Publish klickte, meldete sich Carta in meinem Feedreader zurück. Zum Neustart werden die Leser im zweiten Satz mit folgenden Worten begrüsst: Wir konnten lästige Bugs im Front- und Backend beseitigen und freuen uns, dass sich nun Arbeitsprozesse vereinfachen lassen und Inhalte schneller online gehen können.
Klar, es geht um die technischen Details in diesem Begrüssungstext. Und nur um die. Seltsam genug. Sonst würde man ja dem Postillon Konkurrenz machen.
Update/PS. noch ein letzter, aber verdammt relevanter Link (via wonko): If you’ve ever wondered what depression feels like, this is pretty damn spot on. It isn’t really being sad, but just being…empty. Den Nagel auf den Kopf getroffen.
Und der Kreis gehört natürlich mit einem Musikvideo geschlossen. Wer es bis hier geschafft hat, hat den jungen, engelsgleichen Eddie Vedder verdient. Mit einem Song, der generell und speziell ganz gut passt, ganz gut den Bogen schlägt. Und den Sack jetzt endgültig zumacht.
Es ist ein Wettlauf: Werden die Früchte noch reif, bevor die Tomatenpflanzen verrecken? Sie sehen schon länger nicht mehr wirklich gut aus: Schwarzfleckige Blätter, immer mehr verwelkte Triebe. Ich schiebe es auf den Dreck vom Nachbarhaus: Die Fassadensanierung. Erst der feine Staub vom abgeklopften Putz, dann die Styroporkügelchen von der Dämmung. Die werden sich unweigerlich in der Blumenerde angesammelt und aufgelöst haben, jetzt verrecken erst die Pflanzen, und dann wahrscheinlich ich, wenn ich die kümmerliche Ernte verzehrt habe.
Eine Sache allerdings hat mich dann doch positiv überrascht: Auch wenn ich es mit dem Gras auf dem Balkon dieses Jahr gelassen habe (Gerüst vorm Nachbarhaus, zu viele neue Leute über und unter mir), auch die Tomaten, die eine Sorte jedenfalls, wucherte auf über zwei Meter. Irgendwann wusste ich dann auch, was ausgeizen ist und wie man das macht. Einer der Triebe, die weichen mussten, war schon ziemlich gross, sogar ein paar Blütenansätze waren zu erkennen. Ich steckte ihn in ein altes Gurkenglas voller Wasser. Einige Tage später trieben tatsächlich Wurzeln aus; ich wollte noch etwas warten und die Pflanze dann in einen Topf umsetzen. Daraus ist nur nichts geworden: Der Trieb steht jetzt seit Wochen in dem Gurkenglas, immerhin giesse ich ihn regelmässig, das weisse Wurzelgeflecht hat inzwischen seinen eigenen Dschungel gebildet. Und das Erstaunlichste: Aus den kleinen Blütenansätzen haben sich tatsächlich Früchte entwickelt – nur im Wasserglas stehend. Diese famose Natur, selbst hier auf dem Balkon mitten in der Stadt. Von Weizenfeldern, die gerade abgeerntet werden, bekommt man hier ja leider nichts mit. Was schon etwas schmerzt.

(Der letzte Sommer auf dem Balkon: Schön grün)
***
Aber eigentlich geht es im Haus gerade um wichtigere Sachen. Zahlen spuken durch die Köpfe und Flure. „Was ist dein Preis?“ heisst es überall, mal ausgesprochen, mal nur gedacht.
Nach circa einem halben Jahr Ruhe setzte die Hausverwaltung eine zweiwöchige Frist, um Keller, Hof und Dachboden leerzuräumen. Dreizehn Tage vor Ablauf der Frist begannen Johnny & Co damit, lautstark den Sperrmüll vom Dachbodenfenster in den Hof zu schmeissen: „Hi, ich bin Johnny, your new Hausmeister. Do you smoke weed man?“ So stellte er sich vor, der Johnny aus Nigeria, der jetzt unser neuer Hausmeister ist. Was die Hausverwaltung uns bis heute nicht mitgeteilt hat, aber die wissen ja eh nichts von dem, was die neuen Eigentümer so alles machen.
Also mal wieder eine Hausgemeinschaftsversammlung: Über kurz oder lang, das ist klar, werden sie was tun. Das einzige, was wir tun können, ist auf ein paar Regeln bestehen: Fristen einhalten, Formalitäten beachten. Einer der neuen Eigentümer geht durchs Haus und verteilt Angebote, spricht aber auch von locker 300 Euro mehr Miete, wenn alles fertig ist. Gepriesen sei die energetische Sanierung, wenn die kommt, sind wir sowieso alle gefickt.
Zu Modernisieren gibt es natürlich auch eine Menge – da hat sich einiges angesammelt in den letzten 120 Jahren, klar. Doch so wie sie bisher mit den inzwischen zwei, ab nächstem Monat drei freien Wohnungen umgegangen sind, geht es ihnen nicht um die Hege und Pflege der Bausubstanz. Hauptsache schnell fertig werden und Teppichboden über die Dielen tackern, damit das nächste Dutzend Tellerwäschersklaven aus dem Gastro-Imperium einziehen kann.
Wir üben uns jetzt also in Politik – etwas, was wir alle eigentlich seit Ende der Neunziger hinter uns geglaubt hatten, nur die eine WG ist ja noch wirklich aktiv, was meist belächelt wird und manchmal unangenehm aufstösst. Nun aber müssen alle wieder ran: Standpunkt benennen (Gehen oder Bleiben), Strategie finden (Füsse stillhalten oder auf Konfrontation gehen), Informationen sammeln (Kompromat zu den Eigentümern, Anwalt vom Mieterverein zum Hausbesuch bitten zur Erläuterung der gesetzlichen Vorgaben), Vernetzungsarbeit („Die haben da und da und da noch andere Häuser, wo es grad genauso aussieht, lass doch mal mit denen zusammensetzen.“).
Erst mal wird ein E-Mail-Verteiler eingerichtet, eine Chronologie erstellt und Fotos gesammelt. „Zur Not“ meinte die Gastgeberin mit der Fabriketage vom dritten Hinterhof, „müssen wir dann halt an die Öffentlichkeit, ein Blog machen oder so. Kennt sich jemand damit aus?“ Glücklicherweise antwortete der Abgesandte der Antifa-WG schneller, als ich überhaupt überlegen konnte, ob ich mir das jetzt an den Hals kette oder nicht: „Erst mal der E-Mail-Verteiler, dann sehen wir weiter. Dieses ganze überstürzte ‚Wir machen jetzt gleich mal ein Wiki oder ein Blog oder was auch immer’ bringt zum Anfang gar nichts ausser verplemperte Zeit.“ Ein Lob den Aktivisten, die wissen Bescheid.
In der Nacht nach dem Treffen dann die erste Mail mit dem Hinweis auf die ARD-Doku. Am Morgen trudelten die ersten Antworten ein, deren Tenor überall der Gleiche war: Doku gesehen. Ach du Scheisse!
 (Inzwischen sieht es schon etwas schmucker aus, und bald wohl noch mehr)
(Inzwischen sieht es schon etwas schmucker aus, und bald wohl noch mehr)
Nachts um halb drei standen wir angetrunken vor der Moschee, neben dem fancy koreanischen Restaurant. Der Wirt wollte schon vor Stunden Schluss machen, irgendwann sahen auch wir ein, dass es besser wäre, zu gehen. Zu dritt diskutierten wir im leichten Nieselregen die aktuelle Weltlage, wobei einer von uns noch betrunkener war als die anderen beiden und eigentlich nicht mehr mitreden konnte, aber trotzdem wollte. Was gekonnt ignoriert wurde.
Natürlich ging es um Israel und Palästina. Um antisemitischen Müll auf facebook und auf der Strasse. Einer von uns konnte mit dem Hass seines tunesischen Migrationshintergrundsumfelds nichts anfangen. Der andere fand es komisch, dass er sich kaum um seine Mischpoche sorgte, auf Luftschutzkeller, Abwehrschirm und die Stochastik vertrauend. Der Dritte suchte eine Wohnung in Hamburg.
Ich war empört, dass der nicht ganz so Betrunkene eine so hohe Meinung von Mascolo hatte. Hörte mich Geheimdienstkontakte anklagen und brachte im Zuge dessen sogar Leyendecker in Verbindung mit der BND-Payroll. Musst du nur mal im Internet nachgucken, sagte ich. Ach komm, das ist doch jetzt schon ne arge Verschwörungstheorie, sagte er. Leyendecker, die machen sssuper Fenssster oder ssso, sagte der Betrunkene. Dann gingen wir zum Glück nach Hause.
(oder: Deine Mudda is‘ Kapitalismus, du Subjekt!**)
26.02.14
Weil du schneller rennen musst
als du überhaupt kannst,
nur um auf deiner Sprosse der Leiter
stehenzubleiben,
bist du so flexibel geworden,
dass du inzwischen
deinem unternehmerischen Selbst
selbst in den Arsch kriechen kannst.
Hauptsache, du bist bald nicht mehr
auf diese miesen Jobs angewiesen,
weil du endlich
eine Stelle ergattern konntest.
Aber egal, denn:
Je mehr Weltuntergangsszenarien versagen,
desto höher die Wahrscheinlichkeit,
dass das nächste stimmt.
Immer im Sommer kommen die Irren raus, Bonnys Ranch* entlässt sie zur Ferienfreizeit in die große Stadt. Das war schon damals im selbstverwalteten Ausschankbetrieb aka Unicafe nicht anders: So sicher wie zum Semesterende der Sommeranfang nahte, tauchten um dieselbe Zeit der Exhibitionist, der Tabakschnorrer und der Brüller auf der Bildfläche auf.**
Jetzt war es eben einer, der zwei Seiten des Gästebuchs vollschrieb, psychiatrieerfahren auch er, wie er freimütig einräumte, in einem Nebenstrang des handlungslosen Werkes. Er erzählte etwas davon, dass Mühsam hier ermordet worden wäre, was Quatsch ist. Konnte er natürlich nicht wissen, er hat sich ja nichts angesehen. Kam rein, setzte sich hin, schrieb seinen Stiefel runter und ging wieder. Zwischendurch wischte er sich kurz mit dem T-Shirt den Schweiß aus dem Gesicht, wobei sein überaus fleischiger Körper zum Vorschein kam. Die Hitze! Eigentlich ging es ihm aber darum, dass Wasser ja ein Gedächtnis hat und deswegen auch alle Kleidungsstücke oder Brillen, die wir tragen, letztlich Holocaustopfern gehörten, womit wir schwingungstechnisch mit ihnen verbunden wären, sie aber eben auch weiter schändeten und ausbeuten würden. Sieht man ja auch an der Beutekunst. So etwa in der Art.
Später auf dem S-Bahnsteig versuchte einer, die Aufmerksamkeit zweier auf dem Boden sitzender junger Frauen zu erlangen. Indem er sich auch auf den Boden setzte, den beiden mit der Zwei-Finger-Richtung-eigene-Augen-Geste aber vorher unmissverständlich bedeutete, ihn genau zu beobachten. Als er dann saß, klemmte er sich den rechten Fuß hinter den Kopf und begann, seine Asianudeln zu essen. Eher abgestossen als interessiert standen die Mädels auf und gingen. Enttäuscht tat er es ihnen gleich, erhob sich mit dem Bein hinterm Kopf und hüpfte ein paar unbeholfene Sätze, bis er neue Opfer fand.
Da es Sonntag war, lag der sonst sehr belebte S-Bahnhofsvorplatz ganz ruhig und friedlich in der Gegend rum, die Einkaufszentren hatten geschlossen, selbst von den vietnamesischen Zigarettenhändlern keine Spur. Bevor ich unverhofft und mit sehr mulmigem Gefühl durch ein imposantes Spalier aus Rockernazis vor ihrer Parteizentrale laufen durfte, las ich mir noch die signalrote Kundeninformation im Woolworth-Schaufenster durch. Wegen der hohen Qualitätsansprüche, mit denen giftige Farbstoffe nun mal nicht zu vereinbaren sind, werden WM-Schminkstifte zurückgerufen. Drei Wochen nach dem Finale. Nicht nur mit Dummheit geschlagen, sondern jetzt auch noch von Krebs bedroht, könnten einem fast leid tun.
Der letzte Verrückte des Tages begegnete mir auf der abendlichen Hunderunde. Gerade, als ich mir einen wirren Zettel durchlas, der behauptete, am oder im Kanal gäbe es einen MORD, und die Polizei würde natürlich nichts tun, sah ich ein paar Meter weiter einen Typen auf dem Gehweg knien und etwas auf den Boden kritzeln. Dann stand er auf, ging ein paar Meter weiter und wiederholte das Ganze. Hä? Stand auf den Kanaldeckeln, mehrfach. Als ich ihn ansprach, sah ich in seiner Tasche neben mehreren Eddings auch noch ein paar der MORD-Zettel in Klarsichthüllen. Wie, Häh? Fragte ich ihn, das interessierte mich schon. Ob ich mich noch nie gefragt hätte, was das hier sei? Antwortete er und deutete auf die Deckel. Na so Einstiege, Kanalisation und so weiter, meinte ich. Aber es waren ihm zu viele auf einen Haufen, und überhaupt. Er stelle ja nur Fragen, aber das sei doch schon alles sehr verdächtig. Sprach’s und kritzelte weiter auf die nächsten Deckel, in jede der vier Ecken ein grünes Häh?. Ich versuchte es noch mit dem Argument, dass schliesslich direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite ein Pumpwerk sei und deshalb so viele Kanäle und Deckel dazu gar nicht so ungewöhnlich in dessen Nachbarschaft, aber er liess sich nicht beirren. Ich überlegte noch kurz, ob ich ihn auf das Thema Chemtrails und was er so davon hält ansprechen sollte, ging dann aber lieber meiner Wege.
Der Wahnsinn, der mir aber viel mehr Angst macht (neben dem eigenen, natürlich), ist, dass es im nächstgelegenen Einkaufszentrum (nur wegen des Optikers, alle Jubeljahre mal), also in der Shopping Mall, jetzt eine Brow Bar gibt. Man fällt von der Rolltreppe fast drauf, könnte auch gut eine Saftbar sein, auf den ersten Blick. Aber da verdienen Menschen ihr Geld, das ihrer Chefs, der Sekretärin und die Miete für den Stand damit, vor aller Augen anderen Leuten die Brauen zu zupfen. Die einzige Kundin, die ich ausmachen konnte, trug eine dieser Porno-Jeans-Hotpants. Mit den deutlich sichtbaren Hosentaschen. Was ja eben Mode sein mag, aber auch eine Aussage in sich birgt. Vor allem, wenn dieses Hosentaschenfutter neongrün ist.
‚cause inside out is wiggida wiggida wiggida wack
* Aus einem ca. 10-15 Jahre alten Briefwechsel, als ich mit den Gepflogenheiten in Berlin noch nicht so vertraut war:
übrigens, mal kurz vom thema abschweifend: als ich noch ziemlich neu in Berlin war, fragte mich jemand in der U-Bahn, ob „Bonnys Ranch“ schon vorbei war. Ich kombinierte ziemlich schnell, dass dieser Mensch eine Station meinte, und schaute auf den Plan, der in der Bahn hing. Ich fand aber beim besten Willen kein Station mit dem Namen „Bonnys Ranch“ und zuckte mit den Schultern. Dann blickte mich der Typ an und sagte „Na du bist wohl nicht von hier, wa?!“. Als ich dann die Karte näher betrachtete, wusste ich, was er meinte: die Dietrich-Bonhoeffer-Nervenklinik. Bonnys Ranch!
** Aus einem ungefähr genauso altem Text, das Thema beschäftigt mich also schon länger:
Normalerweise wacht man dann in der Friedrichstrasse auf, zum Beispiel, weil da so viel Leute ein- und aussteigen. Und in der ganzen in den Waggon quellenden Masse sind auch immer ein paar Verrückte. Letztens war eine Frau dabei, die vor jeder Station laut und voller Überzeugung sachlich richtig die nächstfolgende Station ansagte. Man konnte das genau auf dem Display und anhand der Tonbandstimme, die Zehntelsekunden nach dem die verwirrte Frau ihr Statement beendet hatte, anfing zu scheppern, überprüfen. Komisch nur, dass die Tonbandstimme und das Display von Niemanden für verrückt gehalten wurden, schließlich hätte die verwirrte Frau ja auch das neue Kundenerfreungskonzept der BVG sein können.
Nachdem ich dann am Alex ausgestiegen bin, der wohl auch nicht mehr lange so bleibt wie er ist, nämlich ziemlich hässlich, sondern noch hässlicher werden soll, begegnen mir noch mehr Verrückte.
Ein Mann steht im Novemberwinterwetter mitten auf dem kahlen Platz, entsprechend gekleidet, also auch kahl, splitterfasernackt, und ruft abwechselnd zwei Sätze in die Rostbratwurstluft: „Ich bin Jesus“ womit er sich einig ist mit vielen anderen Berlinern, und „Kein schwuler Bürgermeister für Berlin“ – dort dürfte die Einigkeit nicht ganz so ausgeprägt sein wie bei seinem ersten Satz. Ich frage mich, ob das in anderen Großstädten Deutschlands auch so ist. Vielleicht liegt es aber auch an den Streckmaterialien Berliner zwischeninstanzlicher Drogenverschneider. Schließlich gibt es hier kaum kriminelle, also bedrohliche Verrückte, sie sind eher alle lustig, als ob sie Klone von Dieter Kunzelmann wären. Wenn man die wöchentlichen Spiegel-TV Berichte über den Drogenstandort Hamburg im Hinterkopf hat, dann ist Berlin doch ein harmloses Variete der Minderbemittelten – es wird einem ja nichts gestohlen hier, sondern eher etwas geboten.
(Die Pause geht übrigens weiter, das war nur eine kleine Unterbrechung.)
…oder bekomme ich das nur nicht mehr mit? Seeungeheuer, dackelfressende Welse und Killerschildkröten haben es schwer, wenn Kriege toben. Trotzdem, oder gerade deswegen, schliesse ich mich dem Mainstream an und mache eine (kleine?) Pause, falls sich wer fragte. Urlaub? Hahaha!
Wo Wahnsinn und Waffen so laut sprechen, sind schwer Worte und Gedanken zu finden und zu ordnen. Und überhaupt. Hier, ein Fahrrad an einer Wand: 
Gehabt euch wohl, bleibt am Leben, geniesst den Sommer.
Ick heul‘ ja immer rum, dass es viel zu viel zu lesen gibt. Deswegen wird es wohl mal wieder Zeit, diese Aussage auch theoretisch zu untermauern. Ich weiss noch nicht genau, wo dieser Text hier hinführen wird, ob ich noch zu den Grundsätzlichkeiten komme, die schon seit einer Weile danach verlangen, besprochen zu werden – jedenfalls an dieser Stelle ein kleiner Blick hinter die Kulissen des Blogs hier: Wie solche Linklisten entstehen.
Nachdem ich mit dem Lesen im Internet angefangen hatte, bemerkte ich recht schnell, dass das ewige „all die markierten tollen Blogs aufrufen, könnte ja was neues dort zu lesen sein“-Manöver sowohl die alte Kiste als auch meine Nerven arg strapazierte. Zum Glück entdeckte ich kurz darauf die rss-feed-option, macht mich schlau, was das denn sei und integrierte meine Bloglektüre erst einmal in das E-Mail-Programm: Wenn sowieso beides Teil meiner morgendlichen Routine ist, was wäre da besser, als zwei Fliegen mit einer Klappe, und so weiter?
Einiges, wie sich bald herausstellte. Denn auch das zum Feedreader hochgepushte Thunderbird trieb die alte Kiste weit über die Belastungsgrenze. Da ich mich zu dieser Zeit aus anderen Gründen zu einem Google-Account überreden liess, schaute ich mir den dort angebotenen Feedreader etwas näher an – und war dann eine ganze Weile damit sehr glücklich, bis die Oberen aus California sich dachten: Nö, woll’n wir nich mehr.
Also hiess es, sich nach einem neuen Programm umzuschauen. Ich bin generell eher ein genügsamer Mensch, deshalb war ich schon mit dem zweiten getesteten Reader zufrieden (falls es wen interessiert: rssowl). Er kommt gut klar mit den circa 350 abonnierten Feeds – ich allerdings immer weniger, schon allein deswegen, weil es kontinuierlich mehr werden. Auch wegen Linksammlungen wie dieser hier, bloss eben woanders: Beim Kiezneurotiker, bei der Ennomane, jeden Morgen bei too much information (nomen est omen) etc pp. Dabei lasse ich sogar ganze Kategorien, wie z.B. food- oder fashion-blogs, aussen vor. Dass ich inzwischen beispielsweise die tägliche Presseschau der enttäuschten Willy-Wähler von den Nachdenkseiten so gut wie immer ungelesen wegscrolle, ist da auch nur ein Tropfen auf den heissen Stein.
Mittlerweile hat sich eine Routine eingestellt, die nicht weit von der oben beschriebenen Anfangssituation entfernt ist: Kurze Texte sowie nicht allzu lange Beiträge meiner Lieblingsblogs überfliege ich im Reader. Längere oder graphisch aufwändigere Sachen schau ich mir im Original, sprich im Browser, an. Anschauen, nicht lesen, meistens. Denn die verfügbare Zeit ist schon verronnen, wenn ich mir nur den kurzen Überblick am Morgen verschaffe: Die zwei bis drei Stunden Lektüre, die früher, als die Menschen noch Briefe mit der Hand schrieben, für diverse Wochen- und Tageszeitungen draufgingen. Die langen Texte werden also erst mal wieder als Favoriten markiert, um sie später zu lesen. Wobei sich logischerweise einiges anhäuft, so dass sowohl die Kiste („Das Öffnen von so vielen Tabs könnte kritisch werden, mein Freund! Hast du auch wirklich alles gespeichert in den ganzen anderen offenen Programmen? Wäre doch eine Schande, wenn…“) als auch ich (Och nö, das sind ja schon wieder dreissig ellenlange Texte, schaff ich jetzt eh nicht zu lesen…) langsam wieder an unsere Grenzen kommen.
Falls ich es dann aber mal schaffe, die Unsortierte-Lesezeichen-Liste ansatzweise abzuarbeiten, füllt sich der Gelesene-Texte-Lesezeichen-Ordner. Der, in dem die Sachen lagern, die später mal in einer Linksammlung verwurstet werden könnten. Womit wir beim Hier und Jetzt angekommen sind.
Allerdings: Wer weiss das schon genau, das mit dem Hier und Jetzt? Zeit ist ja, selbst ohne psychoaktive Substanzen, ein durchaus dehnbarer Begriff. Schwer zu fassen. Gerne wird von den Zeichen der Zeit gesprochen, und damit meist nichts Gutes gemeint. Bei näherer Betrachtung fällt dann aber recht schnell auf, dass die Zeiten sich vielleicht ändern, die Menschen hingegegen – nun ja, eher weniger. Dafür konstruieren sie sich mit Vorliebe Geschichtsbilder, die gerade in de Kram passen. Natürlich: Geschichte wird gemacht (voran geht es dadurch noch lange nicht) – deshalb heissen Fakten (vulgo: Tat-Sachen) ja auch so, wie sie heissen.
Doch bevor das hier zu weit abdriftet, zurück zum Konkreten – wie Geschichte gemacht wird: Wie zwei Bösewichte über das too much des Bösen argumentierten (wenn man solche Kategorien mag). Wie es einem geht, wenn man erst das Kriegsrecht verhängt und auf einmal zu einer tragenden Rolle im friedlichen Wandel gedrängt wird. Ob so etwas Hoffnung geben kann, sagen wir mal angesichts heutiger Politiker? Die offen ihre Starrköpfigkeit bekennen, egal wieviele Menschenleben das kostete, kostet und kosten wird? Nur, weil es ab und an einen vermeintlichen, winzigen Lichtblick gibt?
Wirklich einfache Erklärungen greifen leider meist zu kurz. Das, was der che zum neuen Krieg in Nahost schreibt, dem Schlimmsten seit langem, würde ich trotzdem so unterschreiben. Dessen ungeachtet: Da ist Krieg, verdammt noch mal! Da sterben täglich Menschen, da fliehen täglich Menschen, weil ihre Existenz zerstört wird. Und etwas weiter nördlich ebenso. Wobei bei der mörderischen Durchsetzung des Islamischen Staates in der Levante mal wieder die Hinfälligkeit von künstlichen Grenzen klar aufgezeigt wird. Noch ein Stück weiter Richtung Nord-Nordwest wurde der Beweis ja längt erbracht: Oder besteht irgendwo begründete Hoffnung, dass die Krim an die Ukraine zurückgeht? Spricht da noch wer drüber? Stattdessen werden mitten in Europa Zivilflugzeuge vom Himmel geschossen (Der kleine Historiker in mir fragt sich, wann es so etwas das letzte Mal in Europa gab – und brauchte einen Moment, um auf Lockerbie zu kommen. Die Qualität ist aber doch eine andere, meint er.): Keiner will es gewesen sein, alle wissen aber, wer es wie mit wessen Hilfe tat. Passt ja ganz gut, so kann in der Presse von der Fussball-Kampf-Rhetorik ganz einfach auf Kriegsrhetorik umgestellt werden. Wenn man sich die Gesamtlage so anschaut, gab es in den letzten 30, 40 Jahre je mehr Instabilität um uns herum?
Nun ist – zugegeben und trotz verlogener EU-Jubiläumsbekundungen – der letzte Krieg in Europa noch gar nicht so lange her. Also sollte man wissen, wie Scheisse das ist. Oder mal einen Nachbarn fragen, einen von denen, die in Jugoslawien geboren sind, die dann aus Serbien, Kroatien oder Bosnien fliehen mussten und hier hofften, in Ruhe und Frieden leben zu können. Was ja oft klappte. Einfach mal nachlesen, wie die sich so kurz nach dem Krieg fühlten, in Sarajewo zum Beispiel. Oder man geht einfach raus, ein paar Schritte nur – und es könnte passieren, dass man beim Kaffee im Cafe Kotti in eine Sitzung des Iranischen Exilparlaments gerät. Wie ein geflüchteter jüdischer Iraner in einem linken israelischen Onlinemagazin schreibt. Verwirrende und doch grossartige Vielfalt, gleich vor der Haustür. Doch längst nicht alle haben das Glück, hier anzukommen. Zehn Prozent gehen wohl bei den Überfahrten auf den Seelenverkäufern im Mittelmeer drauf, ich hätte mit mehr gerechnet. Allerdings: Die Gefahr ist nicht nur die Passage, sondern natürlich auch der Weg dort hin, zum Hafen, zum Schiff. Nicht zu vergessen: Das ist reinste (gehobene) Mittelschicht – die Armen können sich eine Flucht schlicht nicht leisten, das war auch schon immer so.
Wer es dann trotz aller Widrigkeiten schaffte, sich hier sogar eine Existenz aufbaute und es zu einiger Berühmt- und Beliebtheit brachte, der ist noch lange nicht in Sicherheit. Selbst mit einer Heirat nicht, wenn da Bürokraten ihre Zweifel hegen.
Der Tod. Da wird es persönlich, da geht es ans Eingemachte. Gut, wenn man sich z.B. schon zur Halbzeit mal Gedanken drüber macht. Selbst, wenn die Umstände denkbar schlecht sind, kann das zum denkbar besten Ergebnis führen. Man könnte es auch Neuanfang nennen, und – schliesslich läuft gerade die Tour de France – mit Neuanfängen, Todeskampf und Grenzgängen kennen sich wenige so gut aus wie Lance Armstrong. Andererseits: Es ist ja auch nicht so, dass die Gedanken, die man sich so über das Leben macht, immer die erfreulichsten sind. Manchmal sind auch die erschreckend, und manchmal schreibt Frau Bukowsky da ganz wunderbar drüber. Womit eine wunderbare Überleitung aus eher düsteren Gefilden gebaut ist: Am Rande sei nämlich noch hemmungslos auf eine lohnenswerte Lesung im sowieso lohnenswerten Hamburg hingewiesen.
Davon kann auch Thorge erzählen, von den schönen Seiten Hamburgs. Und es kommt nur ein bisschen Fussball vor, im Gegensatz zu diesem famosen Glumm-Text. Berlin, nicht zu vergessen, mit all seiner Liebenswürdigkeit. Für die der Kiezneurotiker immer die passenden Worte findet. Schick isset hier. So wie in New York (Rio, Tokio) auch. Es geht um die Stadt, und um die Geschichten, ihre, unsere. Und bevor es zu pathetisch wird, geht das Schlusswort an Douglas Adams, mit einer wahren Geschichte.
PS. Sommerurlaubsvorschlag: Auf dem Anwesen des Chateau de Clermont nahe Nantes gibt es nicht nur schnieke Luxusappartements, sondern auch ein Louis de Funes-Museum. Nein! D…
(Die Grundsätzlichkeiten fehlen natürlich noch, und so vieles anderes hat sich inzwischen wieder aufgetürmt. Aber der Text liegt einfach schon zu lange hier rum, der muss raus. Nicht, dass der noch anfängt zu müffeln, bei dem Wetter…)
Nachtrag: Der kleine Historiker hat eine interessante Liste bei Wikipedia gefunden. Zitat: 4. Oktober 2001 – Sibir-Flug 1812: Während einer Übung der ukrainischen Marine wurde eine Zieldrohne irrtümlich mit zwei Boden-Luft-Raketen beschossen. Nachdem die Zieldrohne von der ersten Rakete zerstört wurde, suchte sich die zweite Rakete selbständig ein neues Ziel und traf eine russische Passagiermaschine.
Ach ja, wir haben uns ja noch gar nicht gesehen. ‚Schlaand und so… Begrüsste mich der Dicke beim Getränkemarkt. Wir hatten es beide befürchtet, am Freitag.
Während er das Leergut wegsortierte, nach diesem historischen Wochenende, präzisierte er seinen Standpunkt: Ist ja alles schön und gut, jetzt haben sie ihren Titel, von mir aus auch verdient. Aber dieses ganze Geschminke und Gegröle und die Fahnen überall, damit können die ja nun langsam mal aufhören.
Ganz meine Meinung, also pflichtete ich ihm bei: Stimmt schon. Aber ich habe vorhin gesehen, dass die Franzosen immer noch Militärparaden abhalten zu ihrem Nationalfeiertag. Das ist ja auch schon krass. Stell dir das hier mal vor, Militärparade zum 3. Oktober….
Er war nicht ganz überzeugt: Ach, das nennen die nur anders. Schützenumzug oder so. Geh mal zur Fanmeile, das ist keine Militärparade, das ist schon Krieg!
(Link zum Thema: Maybe not the greatest song text in the world, but a stunning tribute)
03/06/14
Gerade kriecht die Gentrifizierung bei mir um die Strassenecke,
könnte man so sagen.
Oder man könnte sagen,
da werden ein paar neue Läden aufgemacht,
schick mit prächtigen Blumen in den Schaufenstern
und Flachbildschirmen an der Decke.
Dort wo früher ein paar alte Läden waren,
und dann gar nichts,
und dann Baugerüste.
„Hier bist du sicher.“ Meinte einer,
der schon lange im Wedding wohnt.
Hochbahn, keine Entwicklungsmöglichkeiten,
wenigstens im Umkreis von drei Querstrassen.
Und dann kommen eben diese Läden mit den
viel zu üppigen Blumensträußen im Fenster
um die Ecke gekrochen.
Und scheren sich einen Scheiss drum,
was Leute aus dem Wedding sagen.
…denke ich, und dann lasse ich die noch offenen Tabs vor meinen Augen vorbeifliegen. Immer noch über 30. Ganz schlechte Idee. Nebenan, im Kohlenstoffleben, machen die Grünen endgültig klar, warum es ein Fehler war, sie zu wählen. Schon immer. Uli Zelle berichtet natürlich live aus dem Berliner Gefahrengebiet. Ärgerlich und absurd.
Fußball-Fifa-WM. Hm. Kommt man nicht drum rum, also ich nicht. Hab ich früher schon mal was drüber geschrieben, erspare ich der geneigten Leserschaft aber lieber. Erspart habe ich mir bisher auch das Rudelgucken, zum Glück kenne ich niemanden, der mich dazu überreden wollen würde. Vielleicht mal ins Yaam, obwohl…
Und wieder: Was bin ich doch für ein Hipster: Mein erstes Public Viewing war zur EM 1996. Circa 20-50.000 Leute. Roskilde-Festival, wo wir immer mindestens zwei Tage vor Festivalbeginn eintrudelten, schon allein wegen des obligatorischen Abstechers nach Christiania. Und deshalb in freundlicher Atmosphäre die Halbfinals auf der orangenen Bühne sehen konnten, wenn ich mich recht erinnere. Vorbei, lange, lange her.
Zu allem Überfluss wurde gerade das Nebenhaus eingerüstet und der Putz wird abgekloppt. Feine Staubschichten überall auf dem Balkon. Ich glaube, selbst in meinem Kopf. Besser aufhören.
18.10.03
Es war ein sonniger Herbstnachmittag, ein Sonntag, und die Luft schmeckte schon ein wenig nach dem Schnee, der bald fallen würde. Der junge Dichter mit dem blumigen Namen stand auf seinem Balkon und ließ sich die Nase ein letztes Mal von der Sonne kraulen. Er beobachtete das Geschehen unten auf der Strasse, das machte er ganz gerne, und sonntagnachmittags ist es auch nicht ganz so laut, es fahren nur wenige Autos. In solchen Momenten kommt der junge Dichter oft ein wenig ins Sinnieren.
Darüber, wie es wohl früher gewesen sein mag auf diesem Balkon. Als das Haus, in dem er wohnte, noch frisch gebaut war, und nicht am Zerbröckeln wie jetzt. Als die Straße unten noch eine Prachtmeile war. Als sie noch nicht zur bloßen Asphaltdecke degradiert, sondern stolze Pferde ebenso stolze Herrschaften auf ihr durch die Gegend kutschierten. Als der heruntergekommene U-Bahnhofsvorplatz um die Ecke noch Belle-Alliance-Platz hieß und auch dementsprechend daherkam.
Nun ja, es war nicht mehr wirklich die allerbeste Gegend hier, gut. Aber so schlimm, wie oft angenommen und bevorurteilt, war es auch nicht unbedingt. Das dachte der junge Dichter jedenfalls bisher. Als er allerdings das Tagträumen für einen Augenblick unterbrach, um zwei hübschen jungen Damen hinterherzuschauen, die eine Spur zu offenherzig gekleidet waren, sah er, wie vor der Toreinfahrt seines Hauses ein Fahrzeug versuchte, einzuparken. Es gelang mehr schlecht als recht, die Hälfte des Autos verblieb auf der Fahrbahn. Zum Glück war Sonntag.
Der junge Dichter konnte zuschauen, wie sich die Heckklappe des etwas lädiert aussehenden Wagens öffnete und jemand von hinten aus dem Auto gekrabbelt kam. Bei näherer Betrachtung erschien das dem aufmerksamen Beobachter auch nicht weiter verwunderlich, da alle anderen Sitzmöglichkeiten in diesem Fahrzeug schon mehr als belegt waren.
Das erklärte wohl auch das etwas mitgenommen wirkende Äußere des Gefährts, denn auf Dauer ist eine derartige Überladung für den Wiederverkaufswert nicht gerade förderlich. Den inzwischen auf dem Bürgersteig angekommenen entstiegenen Passagier schien das freilich nicht allzusehr zu interessieren. Im Gegenteil, er bekam aus dem heruntergekurbelten Fenster der Beifahrertür einen Briefumschlag gereicht, der einen prallen Eindruck machte. Und tatsächlich breiteten sich unzählige Fünfziger aus, als der ehemalige Kofferrauminsasse den Inhalt nochmal kontrollierte. Geldsorgen schienen hier also nicht zu herrschen, was den jungen Dichter, der langsam anfing, zu frösteln, doch ein wenig misstrauisch machte.
Der Balkon, der eigentlich eine Loggia war, was der auf ihm stehende junge Dichter aber trotz seiner sonst umfassenden Allgemeinbildung nicht wusste, konnte von dem dubiosen Gefährt nicht so gut eingesehen werden wie umgekehrt, daher war der heimliche Beobachter bisher unentdeckt. Was ihm auch ganz recht war, da ihm die Vorgänge dort unten auf der Straße langsam aber sicher etwas unheimlich wurden.
Der inzwischen mit den Geldscheinen ausgestattete Handlanger verschwand in einem der nächsten Hauseingänge. Das übrige schätzungsweise halbe Dutzend Fahrzeuginsassen rührte sich nicht. Das Gefährt allerdings schon, der Motor lief ununterbrochen, das Auto dampfte. Die kalte Jahreszeit brach wirklich langsam an. Einige Minuten später erschien der Umschlagträger wieder auf der Bildfläche, diesmal allerdings mit einer braunen Schnellimbiss-Tüte. Der junge Dichter wusste nichts von einem Schnellimbiss hier in der Gegend, vor allem nicht von einem so teuren, denn der Briefumschlag war weg.
Nachdem er die Papptüte durch das immer noch heruntergekurbelte Beifahrerfenster gereicht hatte, nahm der Bote wieder seinen Platz im Kofferraum des Fahrzeugs ein. Der junge Dichter ging das Wagnis ein, seine Position ein wenig zu ändern und damit zwar sichtbarer zu werden, aber eben auch sehender. Ihn interessierte schon sehr, was das denn für vorzügliche Hamburger sein würden, die es wert waren, gegen so viel Geld eingetauscht zu werden.
Es überraschte ihn nicht wirklich, als er sah, dass der Inhalt der Tüte nicht zum Verzehr bestimmt war. Es handelte sich dabei um einen mit zwei roten Gummibändern zusammengehaltenen Stapel Pässe. Der Fahrer, dessen tätowierter Arm jetzt zu erkennen war, riß das Bündel achtlos auseinander und warf einen kurzen Blick auf die wichtigsten Seiten in jedem der Dokumente. Das Ergebnis schien zufriedenstellend, die Reisepässe wurde nach hinten gereicht zu ihren neuen Besitzern und dem Motor wurde endlich eine Beschäftigung gegeben, dass er vor Freude die Reifen quietschen liess. Der junge Dichter blieb etwas ratlos zurück auf dem Balkon, der eigentlich eine Loggia war, und dann verschwand zu allem Überdruss auch noch die Sonne hinter dem Haus schräg gegenüber.
Gut – wenn die Anonymität, die Verwahrlosung der Großstadt dazu führt, dass am helllichten Tag vor seiner Haustür Geschäfte mir gefälschten Papieren gemacht werden – nur zu, darauf wüsste er eine Antwort zu geben! Eigentlich saß er gerade an einem naturwissenschaftlichen Projekt. Seine Aufgabe, die er sich übrigens selbst gestellt hatte, bestand darin, herauszufinden, was das Äquivalent eines durchschnittlichen Menschen, er hatte mal sich selbst als Exempel genommen, in Rekord-Briketts ist.
Die Ausgangsüberlegung war, dass ein Mensch mit seinen 37 Grad Celsius Körpertemperatur ja auch ein enormer Wärmespender sein müsste, da er über die Körperoberfläche gezwungenermassen auch Wärme abgibt, nach den Recherchen des jungen Dichters circa ein Watt pro Kilogramm Körpermasse. Und in einer Wohnung mit Kohlenheizung, wie sie sich gerade hinter ihm auftat, hinter der für jede Art von effektiver Heizbemühung völlig unzureichenden Holzdoppelbalkontür, kommt man schnell mal auf den Gedanken, auszurechnen, wie viele Zentner Kohlen man über den Winter mit seiner bloßen Anwesenheit spart. Mit dem Ergebnis dieser Untersuchung wäre es dem jungen Dichter auch möglich gewesen, den fiskalischen Vorteil auszurechnen, den ihm die Anwesenheit seiner Freunde, die jeden Abend uneingeladen vorbeischauten, verschaffte.
Aber dann eben nicht. Wenn solche Möchtegerngangster vor seiner Tür Geschäfte abwickeln, dann musste er reagieren. Wenn die Metropole ihre Krakenarme auf diese Tour in seiner Strasse ausbreitet, dann musste er zurückschlagen. Die Frage war nur: wie?
Er würde mit der U-Bahn fahren. Er würde sich in jedes in öffentlichen Verkehrsmitteln geführte Mobiltelefongespräch einmischen. Er würde offensiv die Zeitung seines Sitznachbarn lesen. Er würde ihn anstarren, wenn der Zeitungsbesitzer seine Rolle versuchen würde klarzustellen. Wenn dieser dann verschwunden wäre, was so ein behornbrillter vierzigjähriger anzuggrauer Angestellter wohl ohne Zweifel tun würde, dann würde sich der junge Dichter quer über die Sitzbank fläzen. Jede alte Dame, die ihn sitzplatzheischend anschauen würde, wird nichts als einen kaltstechenden Blick ernten.
Der junge Dichter würde jedes turtelnde Pärchen, das sich auf den ewiglangen U-Bahn-Rolltreppen nebeneinander lediglich fortbewegen lässt, ohne Hemmungen anschreien, dass sie sich gefälligst hintereinander zu stellen haben, es ist ja schließlich nicht jeder Student und hat so viel Zeit!
Er würde jedem Kind, das zusammen mit seinen zwei Geschwistern, seiner jungen, glücklichen Mutter und deren ebenfalls dreifach bekinderten Freundin unterwegs ist, dringend davon abraten, mit den dreckigen Gummistiefeln an seine Hosen zu kommen. Jedem anderen Kind, vorzugsweise in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, natürlich auch. Denn falls auch nur ein Krume feuchten steuerfinanzierten Kinderspielplatzbuddelkastensands seine Beinkleider berühren sollten, würde er sich nicht scheuen, die versammelten Bälger in aller gebotener Deutlichkeit über die Erziehungsunfähigkeit ihrer Eltern zu informieren. Und ihnen eine Tracht Prügel anzudrohen.
Der junge Dichter mit dem blumigen Namen würde im nächsten Sommer mit einem Nikolauskostüm bekleidet versuchen, den Prenzlauer Berg mit einem Schlitten herunterzurodeln. Er würde auf den Bahnhof Zoo gehen, warten bis die BGS-Büttel in seine Nähe gekommen sind, um dann empört dem nächstbesten vorbeihastenden Yuppie anzubrüllen, dass er auf keinen Fall irgendein Scheisskoks haben will. Er würde besonders vor Schulklassen und Kindergartengruppen stets versuchen, bei rot über die Ampel zu gehen.
Da sollte dieser Scheissmoloch von Grossstadt mal überlegen, mit wem er sich da anlegt.
„Und was blieb denn übrig, was haben Sie gelernt in ihrem Geschichtsstudium? Dass die Menschen nun mal so sind?“ fragte die weinende Frau, die aus dem Naziknast kam, die ihren Rundgang abbrechen musste.
„Ja, ich fürchte schon.“ sagte ich nach einigem Zögern.
*
Eigentlich wäre das doch eine tolle Sache: Europa. Eine zwingende sogar. Muss man nicht mal Zweig für bemühen. Doch ich bin es müde geworden: Letztendlich braucht es immer eine Bedrohung. Etwas, womit man den Leuten Angst machen kann, etwas Fremdes von aussen.
Es wäre also ein Leichtes: Einfach eine Gefahr konstruieren, die von so weit aussen kommt, dass sie schon nicht mehr von dieser Welt ist. Klappte mit Gott doch auch ganz gut. Es müssen ja nicht gleich Aliens sein, nicht unbedingt. Wäre auch unwahrscheinlich, leider: Denn das Argument, dass man besser nicht zu denen gehört, die entdeckt werden, sondern lieber zu denen, die entdecken, ist einfach zu schön, zu bestechend. Doch setzt man Zeit – unsere Wimpernschlagexistenz von bisher grob 100.000 Jahren (und nocheinmal so viele werden es schwerlich werden) verglichen mit den wahrscheinlich 7-10 Mrd. Jahren, in denen solch eine Existenz prinzipiell möglich wäre im Universum, ebenfalls bisher – in ein Verhältnis mit den ebenso gedankensprengenden Ausmaßen des zu überwindenden Raums, dann ist eben der Kontakt mit außerirdischer Intelligenz leider sehr unwahrscheinlich.
Höchst wahrscheinlich ist dagegen, dass ein Stein-, Staub- oder Eisbrocken uns treffen wird. Uns wieder treffen wird, früher oder später. Das taugt also eigentlich, um klar zu machen, dass Grenzen, Wirtschaftskriege und diese ganze alberne Kapitalismus-Unterdrückungs- und Konkurrenzgeschichte jetzt mal langsam ausgespielt haben und es an der Zeit wäre, so nah es nur geht zusammenzurücken, alle Ressourcen gemeinsam zu nutzen, wirklich Wert auf Bildung zu legen. Weil es uns alle und jeden einzelnen treffen könnte, jederzeit und überall. Mutig, wagemutig zusammen in die Zukunft zu schauen, selbstbewusst, mit der Stirn im Wind, weil man eben zusammen auch so etwas meistern kann, das ginge schon. Mit all den Möglichkeiten, die wir haben. Also: Wäre eigentlich ein Klacks, das mit Europa. Da ist viel mehr drin, da müsste doch viel mehr drin sein, wie kann denn das sein, dass da nicht mal ein anständig vereintes Europa drin ist?
Es ist eben so. Sicher ist jeder Einzelne, dem nahegebracht werden kann, dass Menschen prinzipiell und überhaupt gleich sind, ein Gewinn. Wo stehen wir denn heute? Es ist nämlich auch so: Genau wir, jetzt und hier – wir hätten doch die Möglichkeiten. Bei uns stapeln sich nicht die Leichenberge am Straßenrand, gerade mal nicht. Es kommt näher, keine Frage, und es war wohl immer irgendwo da. Doch es geht darum: Dass wir wirklich was machen könnten, schon seit Jahren was hätten machen können, aber es eben nicht tun, meistens, seit Jahren. Von aussen betrachtet kann das doch nur eine haarsträubende Absurdität sein: Nicht diese Wahl jetzt, nicht diese Politik, nicht diese Wirtschaft und nicht diese Landschaftszubetoniererei – sondern wirklich unsere gesamte Existenz. So ist es, und da kann man dann gerne noch mal 300, 500 oder 3500 Jahre drüber philosophieren, aber letztendlich ist es so. So einfach. Von daher ist es ganz gut, dass diese bisherigen 100.000 Jahre – und von mir aus auch noch mal 100.000 drauf – aber eben mit großer Wahrscheinlichkeit viel weniger – wirklich nur ein Wimpernschlag sind. Höchstens eine Fussnote wert, wenn man mich fragt.
Subjektiv betrachtet mag das anders sein. Trotzdem. Wozu noch mehr Argumente, genügend Phantasie reicht vollkommen aus. Und überhaupt: Wo ist denn da eigentlich der Unterschied, bitteschön?
Du bist Beute, leg dir schon mal ein schickes Nervenkostüm zurecht.
Pollesch (aus unzureichender Erinnerung zitiert)
Andererseits war es großartig, vorgestern Abend im Biergarten zu sitzen und gestern Abend am Kanal. Zu erkennen, dass es drei Reiher sind, mindestens, und nicht nur einer, wie von mir naiverweise gedacht. Und unglaublich viele Schwäne inzwischen auch, von den Menschen ganz zu schweigen. Dass mindestens zwei von den Reihern sichtlich die Show genossen, die sie abzogen, während sie tief und gemächlich ihre Runden drehten. Dass es also schon so magische Abende gibt. Nebensächlichkeiten. Wenn ich liege, dann liege ich.
PS. Es spricht natürlich nichts dagegen, eine Rede zu halten. Eine gute zumal, eine wirklich gute, kluge und wohl auch wichtige Rede. Wenn aber der Gegenstand ebendieser tagtäglich in Abrede gestellt wird, an so vielen und immer mehr Stellen nicht mehr existiert: Dann ist das auch eine Totenrede. Kaddish.
Blöde Sache an der Analogfotografie: Wenn man verkackt, dann richtig. Film zum Entwickeln gegeben, gewartet – und nur ein paar Groschen bezahlt, weil da nun mal nicht viel zu entwickeln war. Diese Fehlerquote von 1:4 muss deutlich gesenkt werden. (Noch besser: Eigentlich gingen zwei Filme drauf – Der volle, der ein zweites Mal in die Kamera gelegt wurde, und der leere, der stattdessen ins Labor ging.) Aber egal, rational ist das ja sowieso nicht: Für die Kosten von schätzungsweise 20-50 Filmen würde ich wahrscheinlich ein halbwegs passable Digitalkamera bekommen (Für eine Spiegelreflex mag man da eventuell eine Null ranhängen). Doch darum geht es ja auch gar nicht, wobei ich anfangs gedacht hatte, dass diese Rollfilme bestimmt sauteuer sind inzwischen, wegen ihres Raritätenstatusses. Von daher war ich also eher positiv überrascht.
Blöde Sache an der Ukraine-Krise: Man weiss so gut wie nichts, und man weiss nicht, ob das, was man glaubt zu wissen, wahr ist. Und man steht weiter morgens auf, isst und kackt ( und arbeitet und fickt, wenn man Pech bzw. Glück hat) und schläft. Vulgärsystemtheoretisch muss ich immer mit dem Kopf schütteln, wenn irgendjemand in den zwangsläufig dieses Thema berührenden Diskussionen mit Moral kommt. Die taugt als Argument weder bei der Kapitalismuskritik noch in der Politik. Was ist denn das objektive Ziel Interesse von Politik? Wenn ich derzeit die Rolle Putins betrachte, vielleicht sogar über einen Zeitraum von sagen wir mal zehn Jahren, dann steht er gerade ziemlich gut da: Russland ist wieder wer, mission accomplished. Aber eben: Politik. Die taugt höchstens, um dran zu verzweifeln.
Interessante Nebenbeobachtung: Bei einem der unzähligen Interviews in den Hauptnachrichtensendungen fiel mir etwas auf – die Sponsorenwand, vor der die Interviews gegeben werden. Leider ist es keine wirkliche Sponsorenwand, man sucht die Logos von Krauss-Maffei, Heckler&Koch und Co. vergeblich. Trotzdem: Dass es da eine extra gestaltete und angefertigte Pappwand gibt, die nur für die Kameras da ist, finde ich bemerkenswert. Ebenso wie die FAQs auf der zugehörigen Seite des dafür verantwortlichen Ukraine Crisis Media Centers.
Blöde Sache an den Wahlen zum EU-Parlament: Dass seit zwanzig Jahren jede Chance vertan wird, die Menschen für Europa zu begeistern. Ich hatte das gar nicht so zweifelhafte Vergnügen, in meiner Schulzeit kurz nach dem Mauerfall eine Art freiwillige Reeducation mit regelmäßigen Bildungsfahrten nach Bonn und Brüssel zu durchlaufen. Und ich fand die europäische Idee toll – die deutsche Einheit war vielleicht nicht so dolle gelaufen, aber egal, was zählte, war ja ohnehin die europäische Einigung. Dachte ich damals. Die für die privilegierierten Europäaer offenen Schengen-Grenzen fand ich (abgesehen von dem, was sie für die nichtprivilegierten Menschen bedeuten) prinzipiell ebenso gut wie die Euro-Einführung, die ich zusammen mit begeisterten Niederländern in Zandvoort erlebte: Drei Stunden nach Mitternacht am 01.01.2002 waren die Eurobestände der Geldautomaten durch den großen Ansturm restlos geplündert und die Maschine spuckte nur noch Gulden aus. Und jetzt? Bleibt einem nichts übrig, als den Kopf zu schütteln und Die Partei zu wählen. Die APPD gibt es ja leider zum Glück leider nicht mehr wirklich, die machte mal einen der ehrlichsten und besten Wahlspots aller Zeiten.
Blöde Sache am Internet: Es ist das, was man daraus macht oder machen lässt. Man kann ihm keine Schuld geben. Aber: Es lassen sich eben auch wahnsinnig tolle Sachen damit machen. Ich fand zum Beispiel diesen Beitrag über die Rolle sozialer Medien in den Protesten in der Türkei (ich glaub ich bin durch ix drauf gekommen) rumdum gelungen. Auch nicht schlecht: Eine Reportage über Ostermaiers Schaubühne in Paris beim Online-Zeit-Magazin. Hier muss ich leider am „rundum gelungen“ sparen, der Text entlockte mir nicht ganz die Begeisterung wie die Gestaltung an sich. Zu behäbig, irgendwie – aber das ist ja auch Geschmackssache. Genau wie dieser Text, mal wieder vom Magazin-Blog, den ich sehr unterhaltsam finde. Andere vielleicht ja nicht.
Hauptsache, man schreibt, auch wenn es nicht ganz egal ist, für wen. Ich sehe das ähnlich wie der Kiezschreiber: In selbstgewählter Mündigkeit selbstbestimmter Verelendung zwar, aber dafür angstfrei. Und wo wir schon mal beim Thema Schreiben & Lesen sind: Schade, dass Hildesheim nicht um die Ecke liegt. Aber immerhin, das Lesen bleibt ja noch, und die Liste wird immer länger. Ohne Internet war es jedenfalls viel langweiliger, und es gäbe keine Youtube-Videos von Schlingensief über Bayreuth. Wo Gysi weitestgehend die Klappe hält. Was man ja nicht glaubt, wenn man es nicht gesehen hat. Grandios.
Ansonsten: Vielleicht mal in den Wedding nach Gesundbrunnen fahren.
01.07.04
Bei dem Sommer
läuft es einem kalt
den Rücken runter.
Eisverkäufer fordern Subventionen.
Politiker fordern Mäßigung.
Blut fordert Zoll.
Zum Glück erkennt man
zwischen all den Konjunkturnachrichten
die Kriege kaum mehr.
…wollte ich. Sollten sich doch andere weiter aufregen über den absurden Charaktermaskenball, der auf dem politischen Parkett ausgetanzt wird. Als dieser Entschluss noch nicht ganz so fest stand, beschäftigte ich mich intensiv, bis an die Grenze, wo einem der Verstand abhanden zu kommen droht, mit einem der vielen Geheimdienstskandale. In diesem Fall war es der mit dem NSU. Natürlich stolperte ich da auch ab und zu über Sebastian Edathy. Da mein Recherchemodus durch einen starken Hang zum Ausufern gekennzeichnet ist, stiess ich relativ schnell auf diese Sache mit der Journalistin. Aus ihrer Sicht – würde man die Vorgeschichte nicht kennen, könnte man sich Susanne Haerpfer bei manchen ihrer Blogbeiträge gut mit Aluhut vorstellen – hat ihre Causa Edathy zumindest indirekt ihre Existenz als gern nachgefragte Journalistin zerstört. Und schon hatte ich einen neuen Faden in der Hand, er führte zu einem verworrenen Knäuel, in dem sich die Schicksale diverser unbequemer Journalisten wiederfanden. Wäre ein lohnenswertes neues Thema, dachte ich, legen wir mal auf Halde.
Dieser Wiedervorlagestapel rief sich in Erinnerung, als irgendwann im letzten Jahr zum tausendundersten Mal über Journalisten und ihre Rolle in der Gesellschaft diskutiert wurde. Sie wären ja schliesslich die letzten Verteidiger der Demokratie, während die anderen drei Säulen kräftig bröckelten. Quatsch, natürlich. Der professionelle Journalismus ist genauso von der kapitalistischen Landnahme betroffen wie alle anderen Bereiche in Kultur oder Wissenschaft. Am Ende geht es um die Kohle – die, die der Journalist am Ende des Monats in der Tasche hat, und die, die der Verlag als Gewinn in der Bilanz verzeichnen kann. Doch das ist ein anderes, unendliches Thema. Eigentlich geht es darum, dass (auch jenseits der rein ökonomischen Verwertungslogik) der Berichterstattung Grenzen gesetzt sind, bzw. werden. Wer aus dem Rahmen fällt, muss sehen wo er bleibt. Zensur findet statt.
Thomas Moser zum Beispiel: Er war (und ist es immer noch, keine Sorge) eine der wenigen kritischen Stimmen zum NSU-Komplex, die wenigstens ganz leise, in der Nische der Kontext-Wochenzeitung, zu hören waren. Er recherchierte tief im Baden-Württembergischen Dickicht aus Verfassungsschützern und KKK, speziell der Kiesewetter-Mord hatte es ihm angetan. Neben Wolf Wetzel und Andreas Förster (und vielleicht noch Jens Eumann) ist er einer der selten zu findenden Journalisten gewesen, die Zweifel anmeldeten, die nicht sofort vom „Terror-Trio“ sprachen, die unbequeme Fragen stellten, die einfach das machten, was Journalisten machen sollten: Fakten checken, recherchieren, nicht einfach die Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft abtippen.
Und dann flog Herr Moser bei Kontext raus. Im Vorfeld wurde von der Zeitung bestätigt, dass es Versuche der Einflussnahme von offizieller Seite gegeben hätte. Aber dass dem freien Journalisten Moser jetzt die Texte nicht mehr abgenommen werden, hätte damit natürlich nichts zu tun. (Ich glaube übrigens auch, dass Moser sich in manchen Dingen verrannt hat, oder seine Agenda ist mir noch nicht ganz ersichtlich, trotz alledem sind seine „Verschwörungstheorien“ nicht weniger plausibel als die offiziellen der Bundesanwaltschaft.) Jetzt ist Moser nur noch Blogger (das hier ist wahrscheinlich seins), abgesehen von einem Artikel bei den „Blättern“ gab es von ihm nichts mehr in den „richtigen“ Medien.
Oder Gaby Weber. Die in Buenos Aires arbeitende Journalistin wird zwar – zum Glück – immer mal wieder von Fefe gepusht (unter anderem mit dieser tollen Alternativlos-Folge), ihre Rechercheergebnisse passen allerdings nicht ins öffentlich-rechtliche TV-Programm, sie wird als Verschwörungstheoretikerin diffamiert. Dass ihr Film über die Verstrickungen von Mercedes Benz mit der argentinischen Militärdiktatur, der bei labournet in Gänze zu sehen ist, beim WDR einfach weichgespült von Dritten nacherzählt wird, während er in mehreren südamerikanischen Sendern zur Prime Time zu sehen war und sogar im argentinischen Parlament gezeigt und behandelt wurde, hat natürlich auch nichts mit Zensur zu tun.
Nur exemplarisch sei hier auch noch auf das Beispiel Hubert Denk hingewiesen, da in diesem Fall ausnahmsweise von „der Presse“ berichtet wurde, welchen Zwängen freie Journalisten ausgesetzt sind: Auch Anwaltskosten können die Ausübung der Pressefreiheit einschränken. Da braucht es gar keine Horrorvorstellung vom tiefen Staat:
„Ein Verfassungsschutz, der mit Nazis, die die Demokratie gewaltsam beseitigen wollen und Menschen zu ermorden bereit sind, zusammen arbeitet und zugleich kritische Journalisten überwacht. Das ist die Horrorvorstellung, die offenbar deutsche Realität ist.“
Lohnen sich also die vereinzelten Aufschreie überhaupt noch? Was blieb zum Beispiel von diesem Memorandum? Was soll man dazu sagen, bzw. was darf man überhaupt noch fragen? Wenn Anne Roth, Partnerin von Andrej Holm und damit aktenkundig in Terrorismusnähe gerückt, unbequeme Fragen stellt, diesmal wieder zum NSU, und darauf diesen wohlmeinenden Kommentar bekommt:
Liebe Anne,
ich möchte Dich bitten, Dich nicht weiter mit diesem Thema zu befassen.
Der hier beschriebene Fall eines verbrannten Zeugen gehört zur Kategorie “bedauerlicher Unfall / plötzlicher Suizid”. Damit werden Probleme unbürokratisch aus der Welt geschafft. Das ist kein Kinderspielplatz. Jeder, der tiefer bohrt, gerät automatisch ins Visier.
Du solltest die Kreise der deutschen und insbesondere der US-Nachrichtendienste nicht stören. Denke an Deine Zukunft und die Deiner Familie. Du bist ohnehin schon ein “target of high interest”.
PS: Das hier ist ernstgemeint.
Bitterernst, keine Frage. Und es fügt sich alles so wunderbar ein in den Totalitarismus der Postdemokratie. Man kann es kaum treffender formulieren als – mal wieder, immer wieder – Georg Seeßlen:
Das Geheimnis der Verwandlung von Demokratie in Postdemokratie liegt darin, dass viele Menschen davon profitieren.
Die Verwandlung ist so weit fortgeschritten, dass jemand, der sich ihr entgegensetzt, bereits seine soziale Existenz riskieren muss.
Sein Fazit ist wenig aufmunternd:
An die Stelle der rebellischen Aufklärung ist eine ironische Abklärung getreten. Man arrangiert sich mit Verhältnissen, deren Schwächen man erkennt, und deren Widersprüche schon als Lebendigkeit missverstanden werden. Man sagt „gemach“, und grinst „Früher war alles besser“, und links und rechts lauern „Verschwörungstheorie“ und „Kulturpessimismus“. Welcher kritische Geist getraut sich noch die verbliebenen Plätze der freien Rede mit den Worten zu betreten: „Die Zeit drängt“. Wir leben nicht in der versprochenen besten aller Welten sondern in ihrem Gegenteil. Es haben sich Kräfte verschworen gegen die Freiheit, die Menschlichkeit und die Veränderung der Verhältnisse. Und es gibt Gründe, nicht sehr optimistisch die Kultur zu betrachten, die sich diese Kräfte noch leisten.
Wir müssen uns wohl, pathetisch gesprochen, die kritische Vernunft als eingekerkerte vorstellen. Wir müssen Briefe aus dem Gefängnis schreiben.
Und sonst so? Wo ich mich eh schon aufrege: Die Gentrifizierung geht natürlich ungehemmt weiter, mit handfesten Auseinandersetzungen unter und gegen die Zugezogenen. Die letzten drei Samstage, an denen ich wie fast immer in einer Kaschemme nahe des Görlis einkehrte, empfing mich an ebendiesem Bahnhof jeweils eine veritable Schlägerei. Es wird härter. Die Probleme bleiben, verstärken sich; betroffen sind wir alle. Und dazu kommen die üblichen Verrückten in dieser (immer noch tollen) Stadt. Trotzdem wäre es mal wieder an der Zeit – gerade bei dem Angebot – sich ausführlicher und tiefer mit dem Thema zu befassen. Aber erstmal ist genug aufgeregt, manchmal sollte man den Rat alter, weiser Männer annehmen:

(via http://wonko.soup.io)
PS. bzw. Update: Da ist man mal ein paar Stunden draussen, um das Mütchen zu kühlen und die Sonne zu grüssen etc., und schon verpasst man, dass auch andere, hier speziell fefe, sich heute schön in Rage geredet haben. Ich hegte ja schon immer den Verdacht, dass es reicht, ein paar Tage fefe zu lesen, und man verliert jeglichen Glauben. Es reichen die Posts von einem Tag, wie sich heute herausstellte.
Hätte ich heute morgen nicht so unter Zeitdruck & im Affekt geschrieben, wäre mir bei meiner Aufzählung Jens Weinreich bestimmt nicht durch die Lappen gegangen; sicher ein im mehrfachen Sinne unbequemer Geist, trotzdem hatte seine Kündigung beim DLF ein Geschmäckle. Oder die kürzlich veröffentlichte Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen, über die sich just heute (also heute veröffentlicht) Daniel mit Markus Beckedahl von dem linksextremistischen [(c) Focus] Blog netzpolitik.org unterhielt.
Jetzt ist hier aber erst mal Schluss mit Politik. Hoffentlich. Feierabend. Wochenende.
Mir fehlen gerade die Worte. Sie sind da, sie gehen durch meinen Kopf, ständig, aber sie wollen zur Zeit einfach nicht raus. Das ist nicht unüblich bei mir, zumal in dieser Jahreszeit: writers block plus Winterdepression, was davon jetzt was verursacht, ist so verworren wie diese ganze wirre Welt. But nevermind. Apropos:
(via alter boy ignored prayer)
Die Gedanken zu den Worten sind da, zuhauf: Wenn ich erst mal anfangen würde, über Journalisten, über „Journalisten“ und dieses ganze absurde Theater zu fabulieren, was sich da draussen abspielt, so leicht fände ich kein Ende. Später vielleicht. Dieses Jahr noch, bestimmt, der eine Text. Obwohl ich schon wieder zweifle, auf zwei Dritteln der Strecke: Zu persönlich? Will ich das, will ich damit an die Öffentlichkeit, wenn auch an die kleine hier?
Einstweilen nur das hier, zur Verdeutlichung, wie es einem die Sprache verschlagen kann: Bayern – sprich die CSU – wird nun doch keine historisch-kritische „Mein Kampf“-Ausgabe erarbeiten: Das Buch sei volksverhetzend. Wenn Verlage das Buch in Zukunft veröffentlichen wollten, werde die Staatsregierung Strafanzeige stellen.
Nun, Hauptsache sie haben die Maut für Ausländer durchgesetzt. Mehr will der CSU-Wähler nicht, schon gar nicht mit diesem österreichisch-böhmischen Gefreiten behelligt werden. Verbieten, ganz einfach verbieten und Strafanzeige stellen.
Muss man sich die Avantgarde, die Vorhut, die, die voranschreiten und neue Gedankenwege als erste betreten, nicht als unglücklich, verzweifelt und resigniert vorstellen? (Eine kleine Camus-Referenz in diesen Tagen, da kommt man nicht drum rum.)
Die Revolutionäre in der DDR, die teils seit Jahren vielleicht nicht Leib und Leben, aber doch ihre Freiheit riskierten (für die sie stritten, weil sie ihnen viel zu kümmerlich war), wurden innerhalb von Wochen übertönt von denen, die nur schnell Geld wollten, um schnelles Geld zu machen.
Die Pioniere und Visionäre des Netzes, die teils seit Jahren und Jahrzenten die utopischen Potentiale dieses Mediums erkunden und vorantreiben, werden immer wieder in die anarchistische Schmuddelecke gestellt, damit im Netz – wie schon immer bei der Landnahme des Kapitalismus und seiner vorherigen Inkarnationen – für ein paar Glasperlen zukunftsträchtige Märkte etabliert werden können.
Die Foucault-und Derrida-Jünger der 80er und 90er Jahre, die sich ja selbst auch vielen Anfeindungen ausgesetzt sahen, müssen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen (heute heisst das wohl: Sich die Hand ins Gesicht drücken aka Fazialpalmierung), wenn sie sehen, mit welcher Begeisterung die Bachelorstudenten von heute ihre Subjektivierung vorantreiben und die Entgrenzung von dem, was sie Arbeit nennen, als moderne Errungenschaft preisen, dabei hat sich die Ausbeutung einfach nur neu in Schale geschmissen.
Diejenigen, die seit Jahren die Abschaffung von Geheimdiensten bzw. die Beschneidung ihrer Allmacht fordern müssten sich hysterisch lachend vom Merkel-Handygate abwenden. Wenn man Zeit nicht als linear betrachtet und sich ein wenig auf die Erkenntnisse der Astrophysik einlässt; wenn gleichförmige Ereignisse unterschiedlicher Epochen in dieser alternativen Zeitleiste wirklich parallel passieren; wenn Zukunft und Vergangenheit sich wechselseitig bedingen oder gleichzeitig passieren, zukünftiges Handeln gar Entscheidungen in der Vergangenheit beeinflussen: Wie weit weg sind wir von Moskau 1937 („Wyschinski ist ein großer Erzähler und Regisseur von Kriminalfällen. Ihm steht die grenzenlose Phantasie eines Verschwörungstheoretikers zur Verfügung, aber auch der ganze Apparat des NKWD, dessen Verhör- und Folterspezialisten in der Lage sind, Geschichten, Lebensläufe, Ereignisse, Verknüpfungen ad libitum zu produzieren.“ S.107)? Der eine Teil des Apparats jagt unliebsam gewordene Angehörige desselben, wenn es sein muss, rund um die Welt.
Und denen, die heute daran erinnern, dass Mitbürger ausgegrenzt, stigmatisiert, enteignet, dehumanisiert und letztlich vernichtet wurden, bleibt denen nicht jeder Bissen ihres Zigeunerschnitzels im Halse stecken angesichts des Parasiten– und Sozialschmarotzer-Gewäschs, was ständig in unzähligen Kommentarspalten abgesondert wird?
Wie ich drauf komme? Ich war einfach wahnsinnig begeistert vom Einstiegssatz zu Georg Seeßlens Essay „Weitere Notizen zum Sterben der Demokratie“:
Demokratie, im Idealfall, ist die zivilisierteste, freundlichste und vielleicht auch „kreativste“ Form des Bürgerkriegs. Sie bedeutet unentwegten Streit, und wenn es gut geht, dann ist es „offener Streit“. Die Gesellschaft, die sich Demokratie leisten will, muss gelernt haben, mit dauerndem, offenen Streit zu leben, und in gewisser Weise auch Gefallen und Nutzen davon zu tragen, auch und gerade eingedenk der Tatsache, dass dieser Streit weder garantiert, immer zu den besten Ergebnissen zu führen, noch eines Tages wirklich „beigelegt“ zu werden.
Vor zwanzig Minuten hatte ich noch eine Idee, wie ich diesen Splitter mit einem leichtfüssigen Beispiel etwas aufheiternd abschliessen kann, damit er nicht so schwer im Magen liegt. Ist mir leider zwischenzeitlich entfallen.
Der Steinbrück-Erpresser, falls sich wer erinnert, stellte sich ja als Ex-Postvorstand heraus. Schon allein das ist natürlich ein Brüller: Ein ehemaliger McKinseyaner und als Vorstand eines der größten deutschen Unternehmen praktizierender Kapitalist erpresst den Finanz-Zampano der SPD, und zwar mit angeblicher Schwarzarbeit aka Steuer- und Abgabenhinterziehung. Allerdings: Das Sahnehäubchen ist sein Rechtfertigungsversuch. Er hatte sich geärgert über Steinbrück, hat sich die Wut vom Herzen geschrieben und wollte es dabei bewenden lassen. Dann ist der Brief aber irgendwie, vollkommen zufällig und unabsichtlich, in die Post geraten. Sagt der ehemalige Postvorstand. Glaub ich sofort, keine Fragen mehr.
Wovon man ja auch viel zu wenig hört – das bemerkte irgendwer aus meinem rss-feed heute morge zu recht – ist dieser zugedröhnte Typ, der mit sich und seinen Halluzinationen vier Stunden lang im Regierungsflieger ungestört Party machen konnte. Das ist doch der Terrormann [(c) flatter] schlechthin. Ich meine, das war nicht nur ein Flugzeug, sondern auch noch eins der Regierung! Wieso fordert da keiner mehr Videoüberwachung in Luftbereitschaftsmaschinen? Lückenlose Telefonüberwachung und Vorratsdatenspeicherung anyone? Nicht? Na gut…
…aber wir haben nur die Wahl zwischen mehr als einem Dutzend alberner Parteien. „Was du auch wählst, es kommt immer >Deutschland< dabei raus“ heisst eine Veranstaltung, die der Stressfaktor für heute abend vorschlägt. Und genau so isses.
Der unsäglich-unfassbare Prolog, den die gestrige Bayernwahl geliefert hat, beweist doch den Unsinn dieser ganzen Veranstaltung. Von hundert Wahlberechtigten gingen 64 wählen. Von den 64 waren knapp unter die Hälfte, also sagen wir mal 31 30, so dämlich, die CSU zu wählen. Und 30 von Hundert – mal ganz abgesehen von denen, die nicht wählen dürfen, obwohl sie Jahrzehnte hier leben, egal ob wegen ihrer Herkunft oder ihres derzeitigen Aufenthaltsortes, Psychiatrie oder Knast beispielsweise – also 30 von Hundert wird jetzt von diesen Dobrindts und Seehofers und Aigners als Rückgewinnung der absolute Mehrheit gefeiert. Passt scho, wenigstens die FDP seid’s losgeworden. Der fällt grad eh nix G’scheites ein ausser „Künast sieht scheisse aus und will uns alles verbieten, rot-rot-grün, buhu!“ Tolle Demokratie!
Da hilft es auch nicht, dem ganzen ein politikwissenschaftlich-avantgardistisches „Post“ voranzustellen, das wirkte schon bei der Moderne und dem Strukturalismus allenfalls hilflos. Es ist mit der Verfasstheit unserer Verfassung in etwa so wie mit der Werbung – dem anderen (eigentlichen?) Übel dieser Zeit: Die Lasagne sieht nicht im entferntesten so aus wie das Bild auf der Packung, jeder weiss das, niemand regt sich auf. Und egal ob da jetzt Pferdefleisch drin ist oder NSA, war doch eh klar, hat doch jeder gewusst, irgendwie.
Wozu also bei diesem Theater mitmachen? Wenn jemand ernsthaft erwägen würde, diese ganze Geheimdienstgeschichte mal aufzulösen, im doppelten Sinne. Wenn dabei all der kranke Mist, der sich zwischen den gut gemeinten Fugen des Grundgesetzes festgesetzt hat, entsorgt werden würde. Wenn die Entscheidungsbefugnisse und die Systemrelevanz wieder dem eigentlichen Souverän zugestanden werden würde statt den Aufsichtsräten, Klüngelnetzwerken und kapitalistischen Verwertungsmaschinerien – dann vielleicht.
Aber solange die Staatsräson dadurch geschützt wird, dass von der Allgemeinheit bezahlte Verfassungsschützer ihre schützende Hand über all unsere Kommunikationskanäle halten, die sie sicherheitshalber stets im Blick haben, Grenzen hin oder her;
solange sie zu unser aller Sicherheit Nazi-Vereine wie den KKK, Nazimusiklabels und Naziterrorgruppen aufbauen, um sie bei Bedarf hochgehen zu lassen (gerade sind Nazis halt in, das ging und geht auch in die andere Richtung);
solange ein staatstragendes Gewese um Nationalitäten gemacht wird, anstatt sich endlich mal ernsthaft um einen Ausweichplaneten zu kümmern;
und solange „unsere“ Regierungen uns unsere Drogen verbieten, nur um ihr lukratives Schwarzmarktmonopol auf diesem Gebiet nicht auch noch an die menschenhandelnden Mafiarocker zu verlieren, die sich über ihre verbeamteten Handlanger sowieso schon kaputtlachen –
solange macht wählen gehen doch nun wirklich keinen Sinn, oder?
Wenn man also aufgrund dieser ganzen verlogenen Wahlmotivationswerbung in die Versuchung kommt, am nächsten Sonntag ein Kreuz zu machen, dann bitte wenigstens ein ganz großes, quer über den Wahlzettel, er ist groß genug. Und danach kann man sich dann mal ernsthaft Gedanken über eine neue APO machen, Zeit wird’s.
PS. Der ARD-Deutschland-Trend (sic!, siehe oben) sagt:
CDU 40%
SPD 28 %
Grüne 10 %
Linke 8%
FDP 5 %
Piraten 2,5%
AFD 2,5%
Ich sag – realistische Variante-
CDU 41%
SPD 27%
Grüne 8%
Linke 8%
FDP 4,9%
AfD 4,9%
Piraten 4,9 %
-wenigstens halbwegs spannende Variante, wenn auch unwahrscheinlich
CDU 38 %
SPD 26%
Grüne 10%
Linke 11%
FDP 2,9%
AfD 5 %
Piraten 5 %
Top, die Wette gilt! Oder es fällt vorher noch ein ordentlicher Meteorit vom Himmel und beendet dieses ganze irdische Trauerspiel. Wär mir lieber.