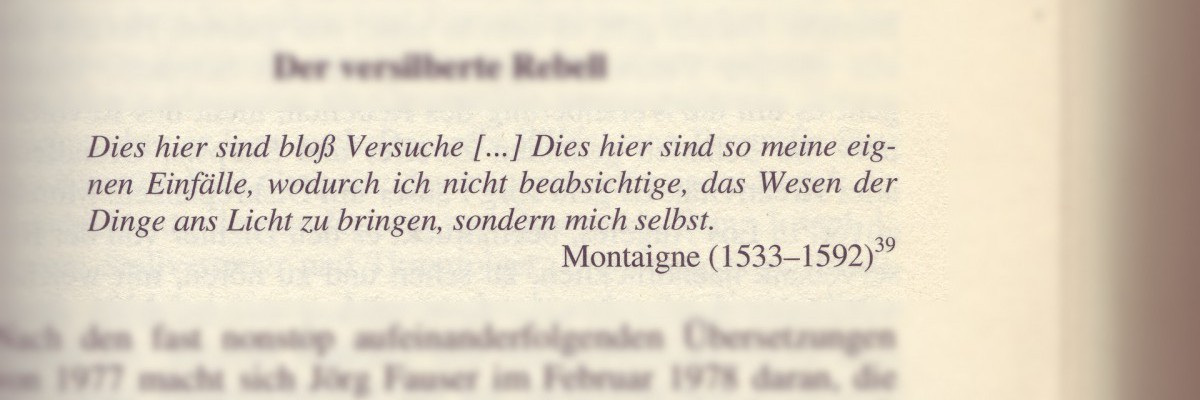Asal lud mich unlängst ein, in den Reigen der Beichten und Geständnisse einzutreten. Bisher habe ich ein einziges Stöckchen aufgenommen – und dabei will ich es auch belassen. Dennoch möchte ich die gute asal nicht einfach so rüde abweisen, das hätte sie nicht verdient. Allerdings: Aus sieben mache ich eins, und aus dem Stöckchen einen groben Knüppel, eine Keule gar.
Nicht nur, weil aus der Blog-Nachbarschaft so charmant gefragt wurde, sondern auch, weil ich heute Abend ins Kino gehe kam mir ein älterer Blogtext in Erinnerung. Ich werde mir den Lichtenhagen-Film anschauen. („Gehen wir in den Lichtenhagen-Film?“ fragte ich. „Ja, hab ich auch schon von gehört, unbedingt. Wie hiess der doch gleich?“ sagte sie. „Keine Ahnung, war zu lang, der Titel.“)
Ursprünglich veröffentlichte ich den folgenden Text am 16. Dezember 2011, einen guten Monat nach der NSU-Enttarnung. Ausser einigen kosmetischen Korrekturen belasse ich ihn so, wie er war, inklusive der Updates am Ende. Der Trailer zu „Wir sind jung, wir sind stark“ – so heisst der Film – ist durchaus sehenswert (zum Film kann ich noch nichts sagen, Kritiken lese ich mir besser erst danach durch), als Prolog und Einführung eignet sich diese Dokumentation aber weit besser [Triggerwarnung: starker Tobak voraus, sowohl im Video als auch im Text]
Ich bin Mitte der 1990er Jahre aus der nordostdeutschen Provinz nach Berlin gezogen. Eigene Wohnung, eigenes Leben, vibrierende, unfertige Grossstadt – das bedeutete für mich hauptsächlich eins: Freiheit. Vor allem auch die Freiheit, nachts nach einem Kneipenbesuch alleine sicher nach Hause torkeln zu können, ohne sich ständig panisch umzuschauen und bei entgegenkommenden Menschengruppen auf die andere Strassenseite oder in irgendwelche dunklen Seitengassen ausweichen zu müssen. Klar, auch in Berlin gab es damals Nazis, und wirklich sicher ist man nie, aber im Gegensatz zum heutigen Berlin waren die faschistischen Schläger noch weniger sichtbar – und nach Hellersdorf, Marzahn und Hohenschönhausen fuhr man einfach nicht.
In Stralsund war das anders. Die Stadt ist nicht sehr gross, man läuft sich dort zwangsläufig über den Weg. Für langhaarige Nachwuchslinke gab es zwar zwei, drei sichere Kneipen, aber spätestens der Heimweg war niemals sicher. Nicht selten kam ich ausser Atem an der Haustür an.
Pöbeleien waren alltäglich, Brandanschläge auf “unsere” Hälfte des Jugendclubs auch nicht unüblich. (Die von den Plattenbaunazis genutzte andere Seite des Gebäudes – Oh gloriose Jugendarbeit der frühen 90er Jahre! – blieb meist unbeschadet.) Eine gewisse Zeit lang mussten wir uns auch immer mal wieder zusammenschlagen lassen – wir waren kein auf Krawall gebürsteter Schwarzer Block, unsere zahlenmässige und körperliche Unterlegenheit war uns sehr wohl bewusst. Wir provozierten lediglich mit dem “falschen” Aussehen und der “falschen” politischen Einstellung.
Bei einer der grösseren Schlägereien, zu der wir sowohl mehrere Unterstützer als auch die Polizei herbeitelefonieren konnten, kam von der zweiköpfigen Streifenwagenbesatzung nur das leidige und viel zu oft verwendete Argument “Ach, ihr haut euch doch bloss untereinander, bestimmt wegen irgendwelchen Frauengeschichten” – dann kurbelten sie schnell das Fenster hoch und machten sich aus dem Staub. Natürlich wussten sie, was los war.
Erst nachdem wir konsequent jeden Angriff zur Anzeige brachten und einige der Nazis dadurch ihre Bewährung aufs Spiel setzten, fand zumindest die physische Gewalt ein Ende. Die Stadt war klein, wie gesagt, und die Schläger kannten wir teilweise seit Kindertagen.
***
Doch nicht nur das. Zur Wahrheit gehört auch, dass ich ein paar Jahre davor – ungefähr mit 13, 14 Jahren – selbst ein kleiner Nachwuchsnazi war. Vieles aus meiner Jugend konnte ich erfolgreich verdrängen, das allerdings nicht. Ich habe in dieser Zeit nie selbst Gewalt angewendet, soweit ich mich erinnere auch kein anderer von den Leuten, mit denen ich mich umgab. Eigentlich ging es nur ums Saufen, von zu Hause wegsein, Störkraft und die Böhsen Onkelz hören und Leute schocken. Konkret handelt es sich um den Zeitraum zwischen dem Mauerfall und Hoyerswerda, es war ein schleichender Prozess, den ich mir inzwischen ganz gut erklären kann.
Meine Eltern arbeiteten in den letzten Jahren der DDR für ein paar Jahre im Ausland. Ich war schulpflichtig und somit zu alt, um sie begleiten zu dürfen (so die offizielle Version der Unterpfand-Praxis) und lebte bei Verwandten in der Lausitz. Das hatte viele gute Seiten: Ich durfte die kompletten Großen Ferien in den sonnigen Süden, dort gab es Obst, von dem man in der DDR nicht mal träumte (Nektarinen!), Comics, Westautos und lauter bunte Fische, Seesterne und Seeigel beim Tauchen. Meine Eltern sah ich aber – soviel zu der nicht so sonnigen Seite – nur im Sommer und über Weihnachten, da hatten sie ein paar Wochen Heimaturlaub.
Als ich 1989 nach den Sommerferien wieder zurück kam, fing mein damaliger bester Freund, der zwei Jahre älter und unglaublich stark war, mit dem Deutschland-Gequatsche an. Sein Elternhaus war richtig zerrüttet, so dass er tun und lassen konnte, was er wollte, es kümmerte niemanden. Für mich war er eine Art grosser Bruder. Eigentlich war ich ein vorbildlich sozialistisch sozialisiertes DDR-Kind: stolzer Thälmannpionier, stellvertretener Gruppenratsvorsitzender, Wandzeitungsredakteur und Agitator, durchaus freudig der FDJ-Aufnahme im nächsten Jahr entgegenblickend. Faschismus – soviel war klar – gab es nur jenseits der Mauer, dort allerdings zuhauf.
Und auf einmal brach der Staat, den ich bis dahin dank kindlichen Glaubens, dank frühkindlicher Indoktrination trotz allem als meinen und vor allem als den besseren deutschen ansah, zusammen – und die Ehe meiner Eltern auseinander. Das einzige, was wir noch gemeinsam machten, war wieder zurück nach Stralsund zu ziehen, was für mich bedeutete, nicht nur meine Familie, sondern auch meine Freunde – speziell den einen – zu verlieren. Der dann übrigens nicht viel später mittels eines schicken Westautos sein Leben an einem Brandenburger Alleebaum verlor, wie einige andere meiner Mitschüler auch. All das führte zu einer veritablen Klatsche, von der ich immer noch ganz gut zehre. Damals versuchte ich wohl, irgendeine Stabilität dadurch zu gewinnen, dass ich mich an dem orientierte, was mir mein verlorener Freund mit auf den Weg gab. Ich suchte mir einen dementsprechenden neuen Freundeskreis, was zu dieser Zeit an diesem Ort im Übrigen auch nicht sehr schwer war.
Wie gesagt, es war ein schleichender Prozess: Zuerst ging es nur darum, möglichst viel Alkohol zu konsumieren, dann kamen die ersten Kassetten mit entsprechender Musik, wahrscheinlich von irgendwelchen großen Brüdern. Über diese Texte wurden Phrasen transportiert, die wir nachplapperten und uns wer weiss wie rebellisch fanden. Meine Mutter war verzweifelt, noch mehr als sowieso schon, ich beschränkte den Kontakt zu ihr auf ein Minimum und trieb mich rum.
Eines Tages brachte jemand DVU-Broschüren und diverse VHS-Bänder mit einschlägigen Inhalten mit. Zum Glück interessierte ich mich nicht sonderlich für Fussball, keiner von uns eigentlich, wenn ich mich recht erinnere. Ansonsten wären wir vermutlich sehr schnell bei den Hansa-Hools gelandet. Ein weiterer Glücksfall für mich war der Wechsel auf eine andere Schule, es gab jetzt schliesslich Gymnasien und keine Polytechnischen Oberschulen mehr, auf die alle bis zur zehnten Klasse gingen. So lernte ich neue Leute kennen, aber auch dort gab es durchaus eine weit verbreitete Aktzeptanz rechten Gedankenguts; Nazis waren Mainstream-Jugendkultur.
***
Doch es gab dort auch einige wenige wunderbare Lehrer und ausserschulische Projekte. Ich setzte meine Wandzeitungsredakteurskarriere fort, jetzt bei der Schülerzeitung, die mit dem daranhängenden Verein bald mein zweites Zuhause wurde. Während sich einige meiner Freunde angesichts des in Hoyerswerda wütenden Mobs begeisterten, wurde mir übel. Schliesslich wohnte ich als kleines Kind zusammen mit meiner Mutter in einem Studentenwohnheim, und meine besten Freunde dort waren sehr nette afrikanische Freiheitskämpfer, die in der DDR Revolution studierten. Ausserdem – ich war inzwischen 14 – waren die Mädchen an dem Gymnasium, die mich interessierten, eher in der linken Ecke verortet. Sie gingen in der Pause immer in ein obskures Cafe mit lauter Punks und komischen Gerüchen.
Meine alten Freunde fingen an, sich die Köpfe zu rasieren und zu den ersten DVU-, REP- und FAP-Schulungsveranstaltungen zu fahren. Ich hingegen liess meine Haare wachsen, färbte die Springerstiefel blau, fuhr zu Jugendpresseseminaren und war kaum noch für die Nazis zu sprechen. Erst war es eine stille Abkehr, doch spätestens mit dem Pogrom von Lichtenhagen wurde ein offener Konflikt daraus, der sich dann über die Jahre fortsetzte.
Mittlerweile war ich 15 und an meiner Kinderzimmerwand hingen Edelweisspiraten-Poster. Ich hatte Glück gehabt und gerade nochmal so die Kurve gekriegt. Für einen Protest vor Ort hatten wir nicht den Mumm, während meine alten Freunde tatsächlich begeistert und durch intensive Schulung aufgeputscht dort hin fuhren und wer weiss was anstellten. Später erfuhr ich in Berlin aus erster Hand, was in und um die Plattenbauten passierte: Ein inzwischen guter Bekannter begleitete die Bewohner des Sonnenblumenhauses auf der Flucht vor den Flammen bis unters Dach in purer Todesangst. Ihm legte ich meine erste Beichte ab in meinem neuen Berliner Leben, nachdem sich mein umgedrehter Magen nach seinen Geschichten wieder beruhigt hatte.
***
So war mein Wegzug auch eine Flucht. Sicher, in Stralsund hätte ich sowieso nicht studieren können, aber auch meine Besuche wurden immer seltener. Die meisten aus meinem Freundeskreis zogen genau wie ich nach Abitur und Zivildienst weg, wenn nicht Richtung Berlin, dann halt nach Hamburg oder richtig tief in den Westen. Kaum einer entschied sich für Rostock oder Greifswald, die Gründe lagen auf der Hand.
Stralsund aber veränderte sich: neue Ortsumgehungen und eine schicke Brücke Richtung Rügen wurden gebaut, die UNESCO erhob die Altstadt zum Weltkulturerbe, das berühmte Meeresmuseum zog in einen avantgardistischen Neubau am Hafen und die CDU-Wahlkreiskandidatin schaffte es bis ins Kanzleramt. Das gelang dem NPD-Kandidaten, der übrigens mit der Stadt genausowenig zu schaffen hatte wie sie, nicht ganz. Aufgrund seiner terroristischen Vergangenheit und Prominenz zog die Stadt jedoch erstmals bundesweite Aufmerksamkeit in dieser Sache auf sich.
Ganz anders als knappe fünf Jahre vorher, als ich ein Nazi war, stellte sich die Lage inzwischen etwas anders dar. Die Überfälle wurden weniger, was nicht nur an möglichen Strafen lag oder daran, dass die Schläger gerade ebendiese hinter Gittern verbrachten. Die Szene hatte sich auch umstrukturiert: Von DVU und REPs war nicht mehr die Rede, viel zu bürgerlich und von Millionären gesteuert. Die FAP war zwar verboten, aber ihre Kader bauten munter weiter straff Kameradschaften auf, die immer näher Richtung NPD rückten. So konnte zwar von hier aus lange Zeit unbehelligt das wichtigste Nazi-Portal betrieben werden, nach aussen gaben sich die Faschisten allerdings als Biedermänner und veranstalten bis heute sehr erfolgreiche Kinderfeste.
Das Fatale daran war, dass es für die Öffentlichkeit und Lokalpolitik lange keine Naziproblematik gab. Was natürlich Quatsch ist. Dahinter steckte eine ausgeklügelte Strategie, die scheinbar aufgegangen ist. Soweit, dass sich unbehelligt eine Terrororganisation bilden konnte, die im Übrigen in Stralsund gleich zwei ihrer Banküberfälle (auf die gleiche Sparkassenfiliale) durchführte, im November 2006 und Januar 2007. Mich würde nicht wundern, wenn sie in der Zwischenzeit nicht zurück in den Süden gefahren, sondern einfach irgendwo im Norden untergetaucht sind. Bönhardt, Mundlos und Zschäpe – alle aus meiner Generation – konnten hier garantiert auf gut funktionierende Strukturen zurückgreifen. Ich kannte die betreffenden Leute, ich bin mit ihnen zur Schule gegangen, ich war kurz einer von ihnen und habe dann lange von ihnen auf die Fresse bekommen.
***
Erfahrung macht klug, sagte meine Oma immer. Und aus meinen persönlichen Erfahrungen inmitten der und gegen die Nazis konnte ich wenigstens etwas lernen. Kurzum: Niemand wird als Nazi geboren. Doch Kinder und Jugendliche lassen sich wunderbar indoktrinieren, sei es in staatssozialistischen Jugendorganisationen oder bei den Nazis.
Es geht um Zugehörigkeit, Anerkennung und Identifikation. Und es braucht engagierte Menschen, die genau das jenseits von faschistischen Ideologien oder staatlich verordnetem Politunterricht vermitteln. Sowohl Schule als auch Eltern sind hier meistens die falschen Ansprechpartner (dafür aber gute Sündenböcke) – und oft hilflos. Ich hatte Glück. Meine Vergangenheit hat mich dazu gebracht, nie wieder einer Gruppe angehören zu wollen und stattdessen lieber ewig zu zweifeln. Ich kann aber auch sehr gut nachvollziehen, wie junge Menschen in dem braunen Sumpf stecken bleiben können und im Extremfall eben auch zu Terroristen werden. Die Geschichte ist voll damit.
Wie schon an vielen Stellen bemerkt, schafft hier weder ein NPD-Verbot noch ein perfekt funktionierender Verfassungsschutz Abhilfe. Solange die Nazis die Lücken besetzen, Kinderfeste veranstalten, Einkaufsbeutel die Treppen hochtragen, Hartz IV-Bescheide ausfüllen, Jugendclubs führen oder sonst wie reizvoller sind als Demokratie und Menschenwürde, solange wird sich nichts ändern. Es gibt unzählige hart arbeitende und täglich Bedrohungen ausgesetzte Menschen, die in der ländlichen Provinz versuchen, Jugendliche vom rechten Weg abzubringen. Wenn aber deren Arbeit nicht gewürdigt wird, und zwar ständig, offensiv und öffentlich, dann wird sich nichts ändern.
Wenn Menschen nicht das Gefühl haben, wichtig, akzeptiert, gebraucht und anerkannt zu werden von diesem Staat – also dazuzugehören – dann verwundert es kaum, dass sich einige von ihnen irgendwann gegen ihn wenden. Das gilt im übrigen nicht nur für Nazikinder.
Update 19.12.2011: Jana Hensel hat sich beim Freitag Gedanken gemacht, die in eine ähnliche Richtung gehen, eine Reaktion darauf von den Ruhrbaronen (bzw. publikative.org).
Update 21.12.2011: Eigentlich sollte das hier keine never ending story werden, aber weil es so gut ist und in die gleiche Kerbe haut, hier der Link zu einem Interview mit dem Filmemacher Thomas Heise in der taz.
***
Tja, 2011. (Und: 1990ff) Da hatte man zwar gerade eine leichte Ahnung vom NSU, sich aber Pegida und die anderen Abkürzungsnazis nicht im Traume vorstellen können. Zufälligerweise weist drei Türen weiter der kiezneurotiker in einem fabelhaften Text gerade auf einen anderen fabelhaften älteren Text hin, der Erinnerungen beschwört, die ähnlich sind und doch ganz anders.