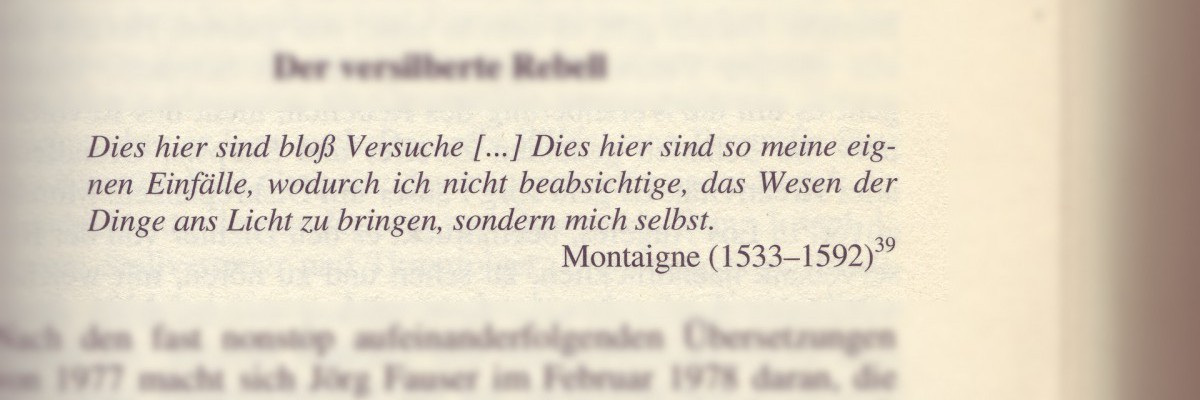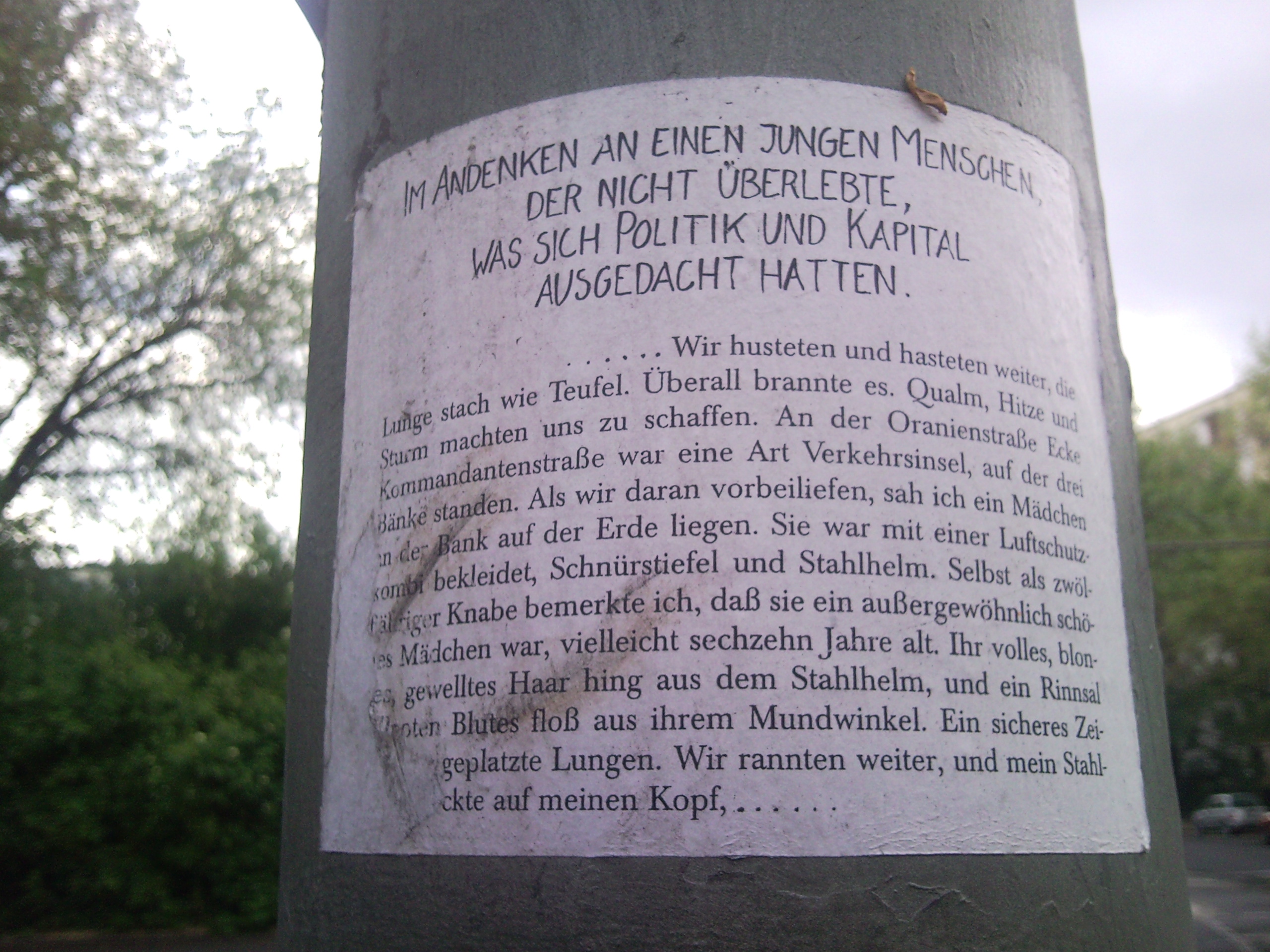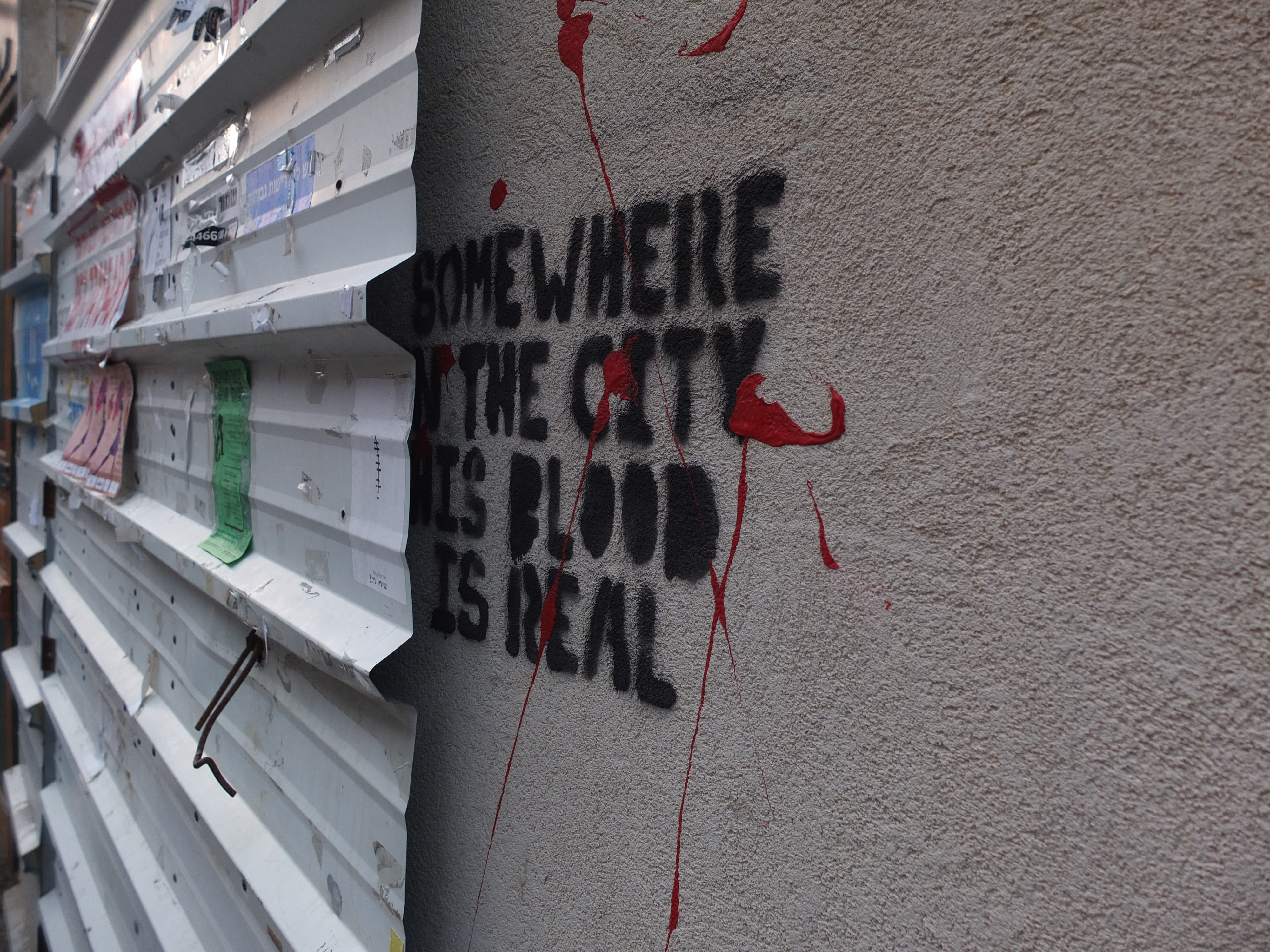13.09.03
Otto Sperber war Frührentner. Sein Rücken! Er hatte sich mal verhoben, und danach noch ein paar Stunden weitergearbeitet. Das ließ sich nicht mehr geradebiegen. Nach der Reha saß er noch einige Monate am Schreibtisch, aber das war nichts für ihn.
Jetzt sitzt er jeden Tag an der Fensterbank. Seine Frau hat ihm zu seinem letzten Geburtstag ein extra Fensterbank-Kissen geschenkt, inklusive selbstgenähtem Wendebezug. Damit war sein Fensterbank-Glück perfekt.
Doch ein Jahr später, inzwischen vollzog Otto Sperber schon drei Jahre seinen unentgeltlichen Spitzeldienst, täglich von 11-16 Uhr, wurde er unzufrieden mit seiner Ausstattung. Das Kissen war perfekt, aber mittlerweile konnte er vorhersagen, was als nächstes passieren würde. Es wurde ihm langweilig. Immer die gleichen schreienden Kinder, immer die gleichen schwangeren Frauen und immer die gleichen quietschenden Reifen. Er musste sein Aufgabenfeld erweitern. Sich eine neue Herausforderung suchen.
Da fiel ihm der letzte Urlaub ein, den er mit seinem Hildchen gemacht hat. Sie waren beide in Kenia, am besten gefiel ihnen die Safari. Davon hatte er noch diverse Mitbringsel auf Lager. Er ging in die Abstellkammer und schob den Vorhang vom Reiseutensilien-Regal zur Seite. Erst griff er noch nach der Flinte, die er auf der Safari ebenfalls dabei hatte, dachte dann aber, dass dies keine so gute Idee wäre, und nahm den Feldstecher in die Hand.
Da hätte er eigentlich schon viel früher drauf kommen können! Von nun an stand ihm endlich die Welt der nackt duschenden Studentinnen in der Wohngemeinschaft gegenüber offen, er konnte sehen, welchen Groschenroman Helga Schumpeter im 3. Stock schräg rechts las und wer in diesem Haus seine Kinder, Frauen oder Hunde schlug. Das dürfte Stoff genug für die Frühpensionärsbeschäftigung der nächsten drei Jahre geben, und dann könnte er sich ja immer noch eine Modelleisenbahn kaufen.
Zweieinhalb Wochen nachdem er damit angefangen hatte, sein Blickfeld mittels Fernglas zu erweitern, bekam Otto Sperber einen Schreck. Er konnte bisher einige nackte Brüste erspähen, auch ein paar fliegende Tassen, aber hauptsächlich doch geblümte Gardinen. An diesem Abend aber leuchtete ihn ein Fenster geradezu einladend an, völlig entblösst und ohne jeden Vorhang. Sein Hildchen hatte sich schon hingelegt, und so konnte er die Nachtschicht in Ruhe angehen. Er hatte inzwischen einen regelrechten Ablaufplan entwickelt, schließlich war er mal ein ordentlicher Angestellter, der jeden Plan einhielt, und eben, wenn kein Plan da war, schnell einen machte. Ordnung musste schließlich sein.
Also konnte er den Blick nicht gleich auf das einladende Fenster richten. Er musste das Haus gemäß seinem Plan von oben rechts nach links, dann die nächste Etage – und so weiter – absuchen. Und vorher natürlich noch schauen, ob Herr Schmidt heute den Hund Gassi führt oder seine Tochter. Die Fenster boten im Großen und Ganzen nur die üblichen Stoffmuster, und in der Studentinnenwohngemeinschaft duschte ein langhaariger Hippie. Ekelhaft, dachte er, als er erkannte, dass ihm keine wohlgeformten Brüste, sondern ein haariger Schrumpelpimmel beim Aussteigen aus der Duschkabine entgegenlachte. Doch langsam aber sicher näherten sich die verlängerten Sperber-Augen dem Ziel ihrer Begierde.
Das hell erleuchtete Fenster im vierten Stock links gegenüber gab den Blick frei auf einen nahezu leeren, weißgestrichenen Raum. Otto Sperbers erster Gedanke war, dass dort wohl gerade jemand einziehen würde. Diese Straße lag in einer zur Zeit sehr beliebten Gegend, es zogen andauernd neue Jungfamilien und Studenten hierher.
In dem Zimmer schien nur eine einzige große Palme zu stehen. Er erkannte, dass der Raum relativ groß war, vom Fenster zur gegenüberliegenden Wand ungefähr sechs Meter, schöner Altbau mit Stuck. Leute mit solchen Zimmern verhängen ihre Fenster meistens mit leinenen Bomull-Gardinen von IKEA. Das war jedenfalls Otto Sperbers Tip. Hildchen kaufte meistens bei Woolworth, aber die hatte ja auch sonst keine Ahnung.
Plötzlich bewegte sich etwas hinter der Palme. Ganz langsam, Stück für Stück, kam ein junger Mann auf einem Bürodrehstuhl hinter der Pflanze vorgerollt. Er hatte vor seinen Augen ein riesiges Armeefernglas, und in seiner linken Hand hielt er ein Schild mit der Aufschrift „Hallo Otto! Schön, dich zu sehen! Du hörst von mir!“. Otto Sperber war geschockt, er machte sofort das Fenster zu und löschte das Licht. Wer war dieser Kerl, und was wollte er von ihm? Woher wusste er seinen Namen?
Am nächsten Tag schlich Otto Sperber nachmittags ziemlich geduckt zum Supermarkt. Er hoffte, er würde diesem Typen nicht begegnen. Er hatte unruhig geschlafen, sich immer wieder gefragt, was er jetzt tun solle. Es ging ja hier nicht mehr nur um sein Hobby. Dieser Rowdy drang in seine Privatsphäre ein, er verhöhnte den anständigen Frührentner Otto Sperber einfach so mir nichts, dir nichts. Das geht ja nun nicht. Sein Steckenpferd würde er wegen so einem Vogel nicht aufgeben, mal sehen, wer hier von wem hört. Mit entschlossener Miene und gefülltem Einkaufsbeutel schloss er beschwingt seine Haustür auf. Irgendwas würde ihm schon einfallen, um diesem Bengel die Flausen auszutreiben.
Als er, oben angekommen, die Wohnungstür aufschloss, stürzte ihm auch schon seine Frau entgegen. Aufgeregt erzählte sie etwas von einem Paket, das abgegeben wurde, und sie wüsste ja gar nicht, wer ihnen denn ein Paket schicken sollte, es ist doch nicht Ostern oder Weihnachten, und sonst bekommen sie doch nie Pakete. Ob das vielleicht von den Kindern wäre? Es war aber an ihn adressiert, und deswegen hat sie es noch nicht aufgemacht.
Otto Sperber öffnete das Paket, aber er drehte sich ein wenig zur Seite, damit das Hildchen nicht gleich sehen könnte, was sich unter dem Packpapier verbirgt. Er wühlte den Papierwust zur Seite und es kam ein Spielzeugfernglas zum Vorschein. Plötzlich hatte er einen Verdacht, von wem dieses Päckchen stammen könnte. Seine Frau schaute erstaunt. Was soll denn das nun? Wir sind doch keine Kinder hier! meinte sie, vermutete doch eine Fehlsendung.
Ihr Mann wusste allerdings genau, dass das Paket hier goldrichtig war. Er nahm das Kinderfernglas vor die Augen und beruhigte seine Frau. Ist schon gut Hildchen, dat is bestimmt bloss wieder son Scherz. Er selbst war alles andere als beruhigt. Denn was er durch das Kinderfernglas sah, war nicht unbedingt für Kinderaugen gedacht.
Otto Sperber war ein wenig aufgebracht. Solche Spässe trieb man nicht mit ihm. Er kramte noch ein wenig in der Kiste rum, auf der Suche nach einer Erklärung. Und siehe da, seine Finger ertasteten eine Karte. Er setzte sich seine Brille auf und las den Text: Hallo Otto, wie geht`s, altes Haus? Damit Du Dich nicht immer so über die Vorhänge ärgerst, hier ein kleines Geschenk für Dich. Wir sehen uns!
Auf der Vorderseite der Karte war ein Bild von dem Frührentner Sperber zu sehen, wie er auf der Fensterbank gelehnt mit einem Feldstecher seine Nachbarschaft ausspionierte. Dazu war noch handschriftlich vermerkt: Was meinst du, an wen ich diese Karte noch geschickt habe? Das gefiel ihm gar nicht. Er müsste diesem Bürschchen wohl mal eine ordentliche Lektion erteilen. Die Jugend von heute hatte eindeutig zu viel Zeit, dessen war sich Otto Sperber schon lange sicher.
Nachdem er den Kaffee, den seine Frau wirklich über die Jahre immer besser hinbekam, genüßlich geleert hatte, schritt er zur Tat. Erst versicherte er sich, dass das Fenster gegenüber auch erhellt war, auf ihn also gewartet wird. Die Dämmerung war bereits angebrochen und sein Hildchen schaute sich voller Hingabe Dieter Thomas Heck an, war also für die nächsten zwei Stunden abgeschrieben. Er hatte jede Zeit der Welt.
Sein Weg führte ihn wieder einmal in die Abstellkammer, zum Regal, und diesmal holte er die Flinte hervor. Wie es sich gehörte, war diese mit einem Zielfernrohr ausgestattet, das in etwa die Vergrößerung des Fernglases hatte. Otto Sperber war schon sehr auf das Gesicht seines Widersachers gespannt, wenn der mit seinem angeberischen Militärfeldstecher direkt in die Mündung einer etwas antiken, doch erkennbar funktionsfähigen und nicht zugeschweißten Flinte schauen würde.
Diesmal hatte sich der Halunke gar nicht erst hinter der Palme versteckt. Sie war im Übrigen immer noch der einzige Einrichtungsgegenstand in dem Raum. Er saß ganz bequem in seinem Drehstuhl und hatte die Hälfte des Gesichts schon wieder hinter dem Riesenfernglas versteckt. Jetzt machte es sich auch Otto Sperber gemütlich, der rüstige Frühpensionär und Hobbyschütze stützte seinen rechten Arm auf das Kissen und setzte das Gewehr an. Dann kniff er das linke Auge zu und schaute mit dem anderen neugierig durch das Zielfernrohr.
Der Typ von gegenüber schien nicht sonderlich geschockt, aber Otto Sperber sah, dass er wieder ein Schild in der Hand hielt. Er richtete das Gewehr auf das Schild aus und las: War nur ein Scherz, das mit der Karte. Der Junge schien bemerkt oder gesehen zu haben, dass sein Schild gelesen wurde, denn er drehte es um. Auf der Rückseite ging der Text weiter: Allerdings sind die Typen eine Etage unter mir kein Scherz.
Das verstand Otto Sperber nun gar nicht. Er senkte den Lauf ein Stockwerk nach unten, um nachzuschauen, was ihm das Schild bedeuten wollte.
Die Mitarbeiter des BKA fanden es gar nicht witzig, dass ein Frührentner in seiner Freizeit mit einer unregistrierten Waffe auf eine frisch eingerichtete konspirative Wohnung zielte.
*
„Nicht schlecht für den Anfang“ dachte sich der Star der diesjährigen Burgfestspiele, Kaspar Rautenberg, als er das Skript auf dem Weg in eine dieser unsäglichen Freitagabendtalkshows durchlas. Er würde es sich überlegen, ein engagiertes Filmprojekt könnte das werden, so in der Tradition des großen Tetzlaff. Eigentlich fand Kaspar Rautenberg, dass er sich solche Auftritte nicht antun sollte, diese Niederungen fand er zu tief für sich. Doch leider stand es im Vertrag der Festspiele, und Verträge hatte er immer erfüllt, auch das begründete seinen Ruf. Klappern gehört nun mal zum Geschäft. Und schließlich wurde er wenigstens von einer anständigen Limousine abgeholt, die zusammen mit ihm gerade in die Hofeinfahrt des Fernsehstudios einbog.
Knapp eine Stunde später fand er sich wieder inmitten einer Runde sogenannter illustrer Gäste. Es waren zwei Moderatoren, ein Mann, der bärtig war und mit seiner Brille scheinbar den putzigen Intellektuellen gab, und eine Frau, die auch als Schlagersängerin berühmt zu sein schien und sich ansonsten durch ihr tadelloses Äußeres und ihre unbefangen-anzügliche Art qualifizierte. Die Getränke hier waren wie es sich gehörte frei und reichlich vorhanden, was Kaspar Rautenberg ganz gut zu pass kam. Sein übermäßiger Drogenkonsum verursachte in letzter Zeit immer eine gewisse Trockenheit in der Kehle.
Er bestellte sich ein grosses Wasserglas voller Wodka. Weder die Moderatoren noch die Aufnahmeleitung zuckten auch nur mit der Augenbraue bei der Bestellung. Diese Sendung fing an, ihm zu gefallen. Er könnte eigentlich auch gleich noch Werbung für das neue Projekt machen, dachte er sich.
Die Sendung begann und der Burgfestspielstar Kaspar Rautenberg nahm an, dass ihm und den Zuschauern jetzt die anderen Gäste vorgestellt werden würden. Denn ehrlich gesagt kannte er hier kaum jemanden, und ihm fiel die Navigation in der Welt gerade sowieso zunehmend schwerer. Die hatten verdammt guten Wodka hier. Doch die Show schien auf Spannung zu bauen: es wurde, bevor die Klappe fiel, nur noch schnell die Reihenfolge festgelegt. Geplant war, dass Kaspar Rautenberg den krönenden Abschluss der Runde bilden würde, er könne sich aber auch gerne jederzeit früher in ein Gespräch einmischen, falls ihm danach wäre.
Das ließ er sich nicht zweimal sagen. Als der erste Gast, ein blonder, junger und ziemlich eingebildeter Schönling vorgestellt wurde, traute Kaspar Rautenberg seinen Augen und Ohren nicht. Scheinbar hatte irgendjemand diesen Bengel aus einem Cafe gezerrt und in eine billige Sperrholz-Kulisse gesteckt, ehe der sich wehren konnte. Und jetzt sitzt er hier und gibt den Eröffnungsgast, inklusive frisch aufgenommener CD. Nachdem der neunzehnjährige Mimendarsteller seinen zweiten Satz mit den Worten „Als Schauspieler ist das natürlich schwer zu beurteilen…“ begann, nahm Kaspar Rautenberg den Klappstuhl des Tonmanns in die Hand.
Der wohl bedeutendste deutschsprachige Theaterschauspieler zog den Blechklappstuhl zielgenau über den Scheitel des Sprechenden, noch bevor auch nur die ersten Silben des Wortes „Lee-Strasberg-Schule“ dessen Lippen verlassen konnten. Dabei brüllte der diesjährige Star der Burgfestspiele „Dafür habe ich nicht sieben Jahre bei Matschullak gelernt und vierzig Jahre an den besten Theatern gespielt, dass so ein dahergelaufener Taugenichts sagt, er ist ein Schauspieler!“
Das war das vorläufige Ende der Karriere des Kaspar Rautenberg. Sören Schelling trug lediglich eine leichte Gehirnerschütterung und einige Schürfwunden davon und begann schon drei Wochen später mit den Dreharbeiten an einem Film, in dem er einen jugendlichen Voyeur spielte, der einen Rentner zur Weißglut treibt.