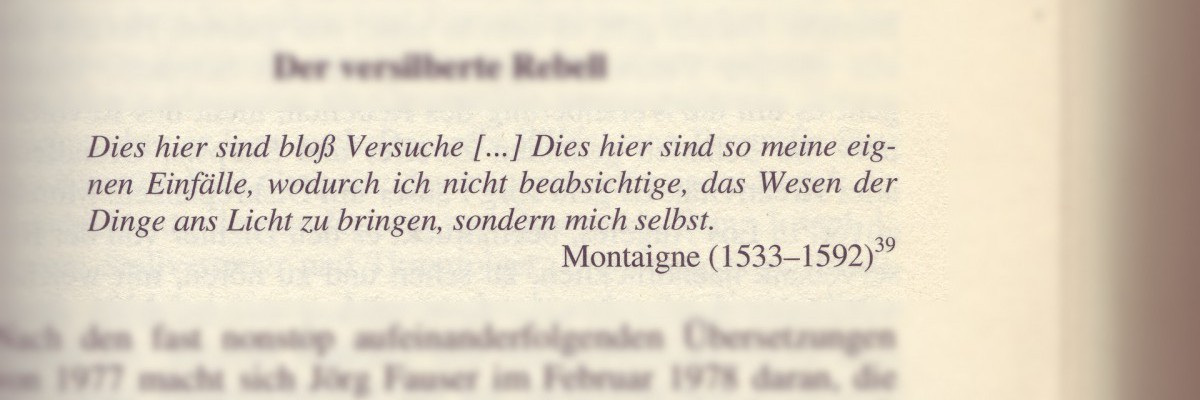Eigentlich war ein alter Bekannter, Nachbar und temporärer Mitbewohner schuld. Lange verschollen und jetzt das erste Mal seit fünf Jahren wieder im Lande, zu Besuch von den Inseln, die unser Wetter machen. Er hat ein etwas seltsames Verhältnis zu seinem etwas seltsamen Hund. Und schaut etwas zu laut seine seltsamen ARD-Vorabendserien, gestreamt, nebenan im Wohnzimmer, weil er drüben kein Netz hat.
Also schmiedete ich Fluchtpläne, und siehe da: In der Schankwirtschaft eines anderen alten Freundes, den ich ebenfalls viel zu lange nicht mehr gesehen hatte, gab es so eine Art Lesung. Ein günstiger Zufall.
Sowieso: Schon Monate nicht mehr im Prenzlauer Berg gewesen! Kein Regen in Sicht und die letzte Spätsommerabendluft in der Nase, mit dem Rad über die Fischerinsel mit Blick auf den in der viel zu frühen Dämmerung angeleuchteten Dom, über die Spree, die hier fast einen Hauch von Hamburg versprüht.
Ich kannte den Laden schon, als es ihn noch gar nicht gab, nur im Kopf des zukünftigen Wirtes. Inzwischen musste er unter großem Getöse umziehen, hat dafür aber jetzt seine eigenen vier Wände. Das Konzept ist immer noch das Gleiche, im Grunde stammt es von der alten, selbstverwalteten Kneipe drei Ecke weiter, wo wir uns damals um Kopf und Kragen kickerten und kifften: Im Angebot waren Kultur, Politik und Alkohol, in unterschiedlichen Dosierungen, aber immer möglichst preiswert. Natürlich ist auch hier die Kultur meist am billigsten, oft sogar umsonst. Beim Alkohol kommt das nur in Ausnahmefällen in Frage.
Seit je her wehte hier ein schwacher Hauch der alten Prenzlauer Berg-Bohème, oder dem, was noch davon übrig ist. So auch an diesem Abend. Eine Zeitschrift wurde vorgestellt, genauer die vierte Ausgabe derselben. Subkultur, natürlich. Gibt es auch noch, so etwas, zum Glück. Ich wies ja schon vor einer Weile auf ein anderes Blatt hin und mache das auch jetzt gerne wieder . Wie viele weitere gute Underground-Mags derweil unerkannt an mir vorbeirauschen, kann ich natürlich nicht wissen; eine Menge, wahrscheinlich, hoffentlich.
Der Saal war noch leer, so konnten wir in Ruhe am Tresen die Ereignisse der letzten Wochen und Monate abgleichen. Der Überfall letztens – auch die verschiedensten Meldungen darüber weckten meine Neugier und bewogen mich an diesem Abend hier her zu fahren – war weit weniger dramatisch als von den einschlägigen Quellen behauptet. Ein Plastikaschenbecher musste dran glauben, das war’s. Den größten Schaden richtete die Staatsmacht an, besser gesagt ihr Pfefferspray in Kombination mit dem Deckenventilator. Also alles halb so wild.
Pünktlich eine halbe Stunde nach dem angekündigten Beginn ging es dann los, ein wenig mehr Publikum war inzwischen auch eingetroffen, trotzdem nahmen die Autoren der vorzustellenden Zeitschrift auch jetzt noch den Großteil der Stühle in Beschlag.
Für Brasch, Have- und Biermann bin selbst ich viel zu jung, aber hier saßen Leute, die damals dabei waren, zumindest hätten dabei sein können. Und – von dem was ich über diese Zeit weiss, darüber gelesen habe – viel anders war es jetzt&hier auch nicht. Ohne Begrüßung las man erst einmal drauf los, ein kosovarisches Gedicht, wie sich herausstellte.
Erst danach wurde die Runde und der genaue Ablauf der nächsten Stunde vorgestellt. Und ab da war wirklich erst einmal kein Unterschied zu den späten 70ern erkennbar: Auf Heiner Müller-Lyrik folgten Victor-Jara-Nachdichtungen, deren Originale daraufhin zur Gitarre gesungen wurden, von jemanden, der ein wenig wie eine Mischung aus Müller und Wim Wenders aussah. Übrigens ziemlich gut gesungen, hatte ja aber auch genug Zeit, der gute Mann, zu üben und zu beobachten, wie was am besten ankam. In all den Jahren.
Schon bei den Müller-Gedichten fiel mir mal wieder auf, dass Gedichte zu schreiben ein Klacks ist, verglichen damit, Gedichte zu lesen(unter bestimmten Umständen jedenfalls – über den feedreader zum Beispiel), oder gar vorgelesen zu bekommen. Daher auch meine Verweigerung dem Vorlesen gegenüber – das sollte man können. Andersrum wird ja auch in den seltensten Fällen erwartet, dass Schauspieler gute Stücke schreiben. Nicht umsonst gab es früher Vortragskünstler. Kurzum: Bis auf wenige Ausnahmen lese ich mir Gedichte am liebsten selbst stumm in meinem Kopf vor, bevorzugt von Papier.
Ganz ähnlich erging es mir, als die zeitgenössische, selbstverfasste Literatur an der Reihe war. Nur selten drang bei der vorgelesenen Austellungskritik (Alltag in der DDR) durch, wie gut sich der Text vielleicht lesen lässt (Diese Ausstellung muss genauso gegen den Strich gelesen werden wie das ND zu DDR-Zeiten.).
Ein alter Profi und Ostpunkexperte brachte dann etwas Schwung in die Veranstaltung. Erst berichtete er von den unwissenden Studenten, mit denen er sich gerade in einer Gastvorlesung herumschlagen musste (sowas kommt immer gut an), dann beschwor er wort- und stimmgewaltig vergangene Beatpoetenabende mit Wolfgang Hilbig, Leipzig anno 79. Da war er wieder, der Fluch des Vergangenen, er schien über diesem Abend zu liegen, aber dieser Abend war dann auch schon vorbei und selbst vergangen.
Als Zugabe, nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung, gab der Wirt noch eine Improvisation im Notenständer-Zusammenklappen (eine Spende des Konzerthauses, ob freiwillig oder nicht habe ich nicht herausgehört). Womit er leicht einen der Höhepunkte des Abends ablieferte, was nichts zur Qualität der Texte oder der Zeitschrift sagen soll. Die werde ich mir nämlich noch mal in Ruhe selbst vorlesen; stumm, in meinem Kopf.
Eine Lesung. Wer weiss, vielleicht berichte ich ja demnächst von einer anderen.
Protokoll eines ständig scheiternden Lebens