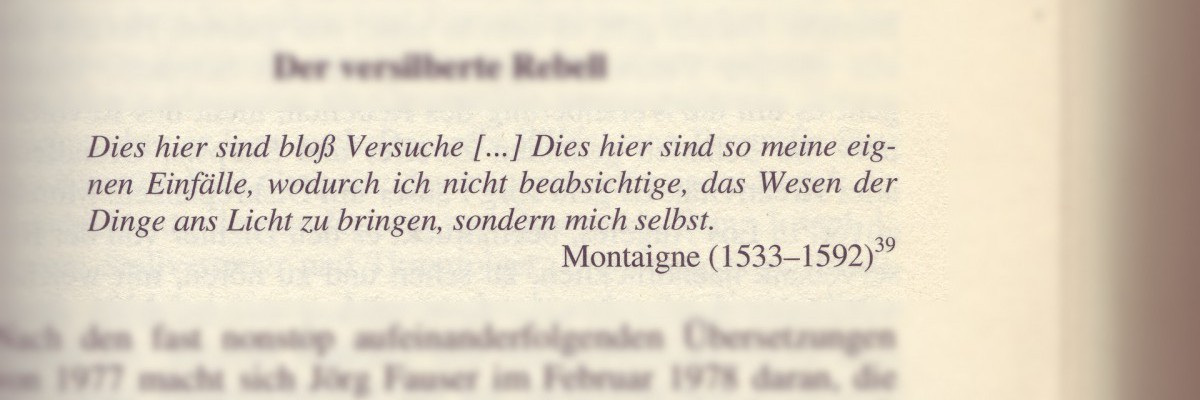Seit langer, langer Zeit war ich mal wieder im Kino. Früher passierte das ständig, dort war schliesslich der Arbeitsplatz der Beinaheangetrauten und in irgendeinem der Yorck-Kinos lief immer was Besseres als im Fernsehen. Da ich nun aber nicht mehr über die magische Freie-Eintritt-Karte verfüge, das Internetstreaming ganz vernünftig läuft und ich Unterhaltungsfilmen alleine nicht viel abgewinnen kann – im Gegensatz zu Serien – verzichtete ich seit mindestens zwei Jahren auf jeglichen Kinobesuch.
Es war auch eher ein Zufall – ein glücklicher, wie sich herausstellte (wie immer erst im Nachhinein, vorher ist man ja nie schlauer): Eine Freundin meldete sich spontan, und da ich sie in den letzten Wochen sträflich vernachlässigt hatte, suchte ich in den einschlägigen Programmen nach einer kulturellen Abendveranstaltung. In die engere Auswahl kam ein Konzert im Schokoladen oder … Moment, das klingt gut, da würde ich sogar alleine hingehen: Ein Dokumentarfilm zur Gentrifizierung, Premiere an diesem Abend im Moviemento.
Verdrängung hat viele Gesichter lautete der Titel, den Inhalt habe ich nur kurz überflogen; wo das Thema gerade Konjunktur hat, nehme ich besser alles dazu mit, bevor es in den Mottenkisten der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten verschwindet. Als ich am Telefon die Karten reservierte, fiel mir auf, dass ich noch nie im Moviemento war: Wir schafften es früher immer nur ins Yorck, zum Rollberg, Passage oder Babylon – oder eben in das tolle alte Kino in Charlottenburg, wo Madame arbeitete und Buck manchmal verknautscht aus seinem Büro lugte.
Vor dem Kino angekommen, das dank seiner Ecklage und trotz des Schildes leicht zu übersehen ist, versammelte sich ein Publikum vor der Tür (Raucher, klar), wie man es in Kreuzberg nicht anders erwartete: Unterschiedlichste Altersgruppen, aber durchgehend bunt und mal mehr, mal weniger aus dem Rahmen gefallen. Und durch die Maschen des sozialen Netzes auch, hier war ich Gleicher unter Gleichen. Passend dazu näherte sich vom Kotti her eine Ein-Mann-Demonstration, zuerst nur akustisch wahrzunehmen: Ein älterer Mann, ein Türke vielleicht, fuhr gemächlich auf seinem über und über mit Plakaten geschmückten Fahrrad den Kottbusser Damm entlang und hielt dabei ein Megafon Richtung Bürgersteig, aus dem von Band abgespielte Wortfetzen zu hören waren – der Verkehr auf der vierspurigen Strasse und die verstärkten Doppelauspuffrohre des örtlichen Macho-Nachwuchses liessen mich nur etwas von „Bleiberecht für alle Flüchtlinge“ verstehen.
Verglichen mit den anderen Gentrifizierungs-Dokumentationen ist diese schon speziell: Relativ schnell wird klar, dass es sich hier nicht um den üblichen, professionellen Reportage-Journalismus handelt. Die eigene Betroffenheit scheint sowohl Auslöser als auch Themenschwerpunkt zu sein, Verdrängung hat viele Gesichter wurde von einem Kollektiv geschaffen, von Menschen, die zwischen Ost und West, zwischen Kreuzberg und Friedrichshain wohnen – irgendwo in dem Zipfelchen Treptow, das längst aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist und jetzt von Baugruppen erobert wird.
Das ist eine zweite, angenehme Überraschung: Nicht der große Blick, der möglichst alle Aspekte darstellen will, sondern ein kleines Phänomen, welches auf den ersten Blick auch gar nicht problematisch scheint, wird hier thematisiert. Menschen, die früher vielleicht selbst mal Häuser besetzt haben, sich überwiegend als linksalternativ verstehen und verwundert zur Kenntnis nehmen müssen, jetzt auf einmal die Bösen sein zu sollen, wo sie doch selbst nur den steigenden Mieten, die sie sich in zehn Jahren in der Gegend nicht mehr leisten können werden, entgehen wollen. Deshalb suchen sie den Ausweg im Modell der Baugruppe – keine Hedgefonds, sondern kleinteilige Zusammenschlüsse privater Investoren, die sich ihre eigenen vier Wände bauen. Was kann denn daran schlimm sein, fragen sie und wahrscheinlich auch viele aus dem Publikum, die sich mit diesem Thema noch nicht näher beschäftigt haben.
Obwohl der Film klar Stellung bezieht, wird niemand über die Maßen vorgeführt oder blossgestellt und es werden eben auch solche Fragen zugelassen, jedoch nicht, ohne eine Antwort darauf zu geben: Zuerst einmal das auch von einigen Protagonisten der „Gegenseite“ schliesslich erkannte Eingeständnis, dass sie vom puren Egoismus getrieben sind, selbst nicht unter die Räder zu kommen und es in diesem Falle eben ein Kollateralschaden ist, wenn dies anderen passiert; Hauptsache Sicherheit, auch in zehn Jahren noch. Dabei gibt es auch andere, sozialere Möglichkeiten, wenn man schon neu bauen möchte: Genossenschaftliche Modelle oder das Mietshäusersyndikat bieten hier Alternativen abseits von Wohneigentum, genauso sicher und planbar, nur kann man in Zukunft halt keinen Reibach damit machen. Um nur ein Beispiel zu nennen.
Die Stärke des Films sind die Geschichten der Porträtierten, egal, welchem Lager sie angehören: Das Dilemma der Baugruppenmitglieder wird ebenso deutlich wie die Absurdität der Politik und die Ausweglosigkeit der betroffenen Anwohner – ob das nun der stille, trotz seiner Situation erstaunlich unverzweifelte Buchhändler ist oder die Berliner Pflanze Moni, Jahrgang ’56 und seitdem mit großer Klappe und großem Herz im Kiez unterwegs. Die in einem Nebensatz ganz dezent darauf hinweist, dass das, was jetzt gerade um sie herum passiert, beileibe nicht die erste Verdrängung ist: Man erinnere sich nur mal an die Umstellung der Ostmieten auf das Westniveau, kombiniert mit dem Verlust des Einkommens durch Arbeitslosigkeit wurden dadurch schon damals nicht wenige an den Rand der Stadt und der Gesellschaft gedrängt.
Es ist müßig, auf alle großartig gelungenen Szenen (die Schuhe des Baustadtrats!) einzugehen, und selbstverständlich hat auch dieser Film seine Schwächen (Ich glaube, das, was ich persönlich am Meisten zu kritisieren habe firmiert unter dem Begriff Sounddesign). Da sich das Filmkollektiv auf die eigene kleine Lebenswelt konzentrierte, fehlt auch die große Anklage: Die Systemfrage wird nicht gestellt. Wenn ich mich recht erinnere, taucht das Wort Kapitalismus nicht ein einziges Mal in dem Film auf – ein bisschen schade, denn solange mit Grund und Boden spekuliert werden darf und daraus teils astronomische Gewinne erwirtschaftet werden, führt kein Weg daran vorbei, dass wirklich jeder Schuld ist an der Gentrifizierung.