[Ja, es ist verdammt lang geworden: leicht überarbeitete & erweiterte Komplettfassung. Für alle, die Teil 1 + 2 schon kennen & nicht nochmal lesen wollen, geht es hier weiter.]
Intro:
Und Berlin war wie New York
Ein meilenweit entfernter Ort…
Es war irgendwann im August 1997, kurz vor Ferragosto, als mich im heissen Süditalien die Nachricht erreichte: Berlin! Jetzt!
Der Zivildienst war gerade beendet, der Studienplatz an der Humboldt-Uni zugesagt und mit der damaligen Freundin, die nach dem Abi schon zwei Semester Kunst hinter sich hatte, fuhren wir nun endlich durch Italien: Die klassische nicht ganz so grosse Grand Tour deutscher Abiturienten, schon irgendwie. Dafür hatten wir so Sachen wie Ferragosto gelernt, ganze drei Tage in den Vatikanischen Museen verbracht und uns wie in Arkadien gefühlt. Es war toll, selbst der kleine blaue Fiesta namens Ozzy hielt trotz mautvermeidenden Apenninenserpentinen tapfer durch. Und jetzt schien das mit der Wohnung im Prenzlauer Berg also auch geklappt zu haben! Wir hatten drei Tage, um von dem Fährableger statt nach Griechenland wieder zurück nach Hause zu fahren. Was ab jetzt Berlin hiess.
Vor dem Mauerfall war Berlin für mich – ausser Hauptstadt der DDR natürlich – ein Ausflugsziel, um mit der von dort stammenden Verwandtschaft in den Tierpark zu fahren, einzukaufen, noch entferntere Verwandte zu besuchen und die große, weite Welt zu bestaunen.
Als wir mal wieder umzogen, diesmal richtig weit und nicht nur ins nächste Dorf oder unter der Woche ins Studentenwohnheim, wurde Berlin Durchfahrtsort auf der Strecke zum Familienstammsitz. Oft fuhren wir dran vorbei, aber wenn die Eltern gute Laune und Zeit hatten, ging es auf der langen Fahrt längs durch die sozialistische Heimat nachts auch manchmal quer durch die glitzernde, blinkende grosse Stadt. So viele Lichter auf einmal gab es sonst nirgendwo in der ganzen Republik zu sehen. Ich sprang vor lauter Begeisterung auf der Rückbank des alten Skoda hin und her, bis ich nur noch müde und staunend mit offenem Mund da saß, als die Brandenburger Dunkelheit uns wieder langsam umhüllte, draussen auf der F96.
Noch eine Weile später, immer noch Kind, war Berlin für ein paar Sommer lang der Ort, von dem mich die Iljuschins in den grossen Ferien zu den Eltern brachten.
Da war es nur naheliegend, nicht nur geographisch, dass das erste Westgeld natürlich auch in Westberlin abgeholt und ausgegeben wurde: Doppelkassettenrekorder! Später dann soviel skurrile Klamotten, wie wir uns im Basement kaufen konnten: Kilopreise!
Der Zufall wollte es, dass wir kurz darauf ein paar Berliner kennenlernten, wegen denen wir in den nächsten Jahren auch immer wieder so oft wir konnten zurück kamen. Sie waren damals gerade dabei, eine Band zu gründen, die zufälligerweise ebenfalls Basement im Namen trug.
Ausserdem schaffte es der grosse Bruder des besten Freundes, der uns über die Jahre all die verbotenen und spannenden Sachen, Substanzen und Gedanken nähergebracht hatte, nach Weissensee. So waren wir fast jedes Wochenende in der Oberstufe hier: Es war ein Paradies. Selbst Hamburg, was ungefähr gleich weit weg war, schien uns längst nicht so so aufregend, trotz einiger Abenteuer, die wir dort erlebten. Obwohl es norddeutsch war, was uns wiederum vom Gemüt und der Sprache eher lag.
– Ankommen –
Also keine Frage, dass es für’s Studium die HU sein sollte – also Berlin. Was hatten wir inzwischen hier in den letzten Jahren schon alles erlebt, ausprobiert und kennengelernt! Die wilden 90er, manchmal sogar mit elektronischer Musik, da kam man kaum drum rum zu dieser Zeit. Und wie toll würde das erst werden, wenn man hier ganz und gar wohnte! Die Konzerte, die Partys, die illegalen Wochentagsbars irgendwo im Hinterhof, im Keller oder in einer leeren Wohnung. Das Bandito! Die Köpi! Der Eimer! Das Acud! Die Fehre! Der Schokoladen! Das Tacheles!
Wo wir lebten gab es dagegen – trotz Fachhochschule und laut DDR-Statistik festgestellten 77.000 Einwohnern – ganze zwei halbwegs passable Kneipen. Zum Tanzen fuhr man in die nächstgelegene Uni-Stadt, weil: Man wollte ja keine Chartmusik hören, sondern mindestens Indie, besser Punk oder Ska. Es wurde also höchste Zeit für die Metropole: Kindheit in Lausitzer Heidewäldern, Jugend an der Küste, und nun endlich Berlin – das war nur logisch.
Der grosse Bruder wohnte in der Senefelder, so wurde dieser Kiez unser Basislager. Grenze zu Mitte, Klo auf der halben Treppe, ein Zimmer mit Hochbett und Ofenheizung. Deshalb wollte ich auch unbedingt die Wohnung in der Christburger haben, wegen der wir die 2200 Kilometer von Brindisi in die alte Heimat und die 300 Kilometer von dort zurück nach Berlin gern in einer Drei-Tage-Monstertour abrissen: Mir war die Gegend sehr vertraut, ich fühlte mich hier schon heimisch, bevor ich es überhaupt war.
Zwei Zimmer Altbau, Wannenbad, Gamat-Aussenwandheizkörper. Die Vormieter aus Moskau sagten, sie hätten eine Greencard gewonnen und wollten weiter gen Westen ziehen. Ich liess mich mit 1.500 Mark Abstand für ein paar Möbel und anderen Kram über den Tisch ziehen, aber es war immerhin die erste eigene Wohnung und dank der Zivi-Abfindung samt rund-um-die-Uhr-ISB-Zuschlag konnte ich das problemlos verschmerzen. Also machten wir uns ans Renovieren. Beim Stuckabpinseln und Malern wurden dann die Modalitäten für die zukünftige Fernbeziehung festgelegt: Sie wollte von Anfang an nicht in Berlin studieren – zu gross, zu viel los und nicht zuletzt kein passender Studiengang.
Dann der Semesterstart: Ausgestattet mit jahrelanger Berlin-Besucher-Erfahrung, einer wunderbar dilettantisch hergerichteten Erstsemesterwohnung im Prenzlauer Berg und unbändiger Vorfreude stürzte ich mich von den Einführungsveranstaltungen direkt in das Zentrum des Aufstands. Was mich bis heute versaut hat.
Schon bevor mit dem Streik alles Übel seinen Lauf nahm, fand sich recht schnell ein kleines Grüppchen zusammen, dank der verschiedenen Magisterteilstudiengänge bunt gemischt. Einige hatten Wohnungen oder WGs in Mitte, andere im Prenzlauer Berg, nur wenige in Kreuzberg – die wohnten dann meist schon länger in Berlin. Selbst Avantgardisten aus Friedrichshain waren dabei; vereinzelt gab es auch Leute aus Lichtenberger Studentenwohnheimen, Charlottenburger Hinterhofwohnungen oder aus Spandau. und es gab schon damals nur verschwindend wenige Urberliner. Anfangs waren die Freundeskreise noch in Bewegung – gerade auch durch die ganze Streik-Geschichte – aber bestimmte Kerne bildeten sich doch recht schnell und blieben sehr lange bestehen. Wir eroberten Berlin auf so vielfältige Art und Weise:
All das Wissen, was die Uni zu bieten hatte, selbst und gerade in den autonomen Streik-Seminaren. All die Kultur an jeder vergammelten Strassenenecke, an denen damals noch der alte Ostberliner Putz abbröckelte (Lesebühnen! Schlingensief!). Die Menschenmassen überall, mal als Beobachtungsobjekt, mal als ein Etwas, dem man selbst angehörte. Interessante neue Menschen und Begegnungen allerorten. Und auf einmal ist man mitten im Geschehen und meint – euphorisch wie man ist – einen Hauch von Anarchie und Revolution zu spüren, der sich hartnäckig an einem festsetzt. Tagsüber dem Universitäts- und Politgeschäft nachgehen und nachts dann die Tour runter vom Prenzlauer Berg, über die Sredzki-, Ryke- und Kollwitzstrasse bis zur Zionskirchstrasse oder Senefelder Richtung Mitte, und in jedem dritten Hinterhof tat sich eine neue Welt auf. Zum Schluss landete man immer irgendwie beim Imbiss International.
Die Wohnung in der Christburger hielt nicht lange, aber immerhin länger als die Fernbeziehung. Die war im Frühling vorbei: Die Verlockungen waren zu gross, die Strecke zu weit, wir zu jung und das neue Leben zu fordernd. Wie ich später herausfand, wurde auch schon im Herbst bei einer der ersten Vollversammlungen ein interessierter und folgenreicher Blick auf mich geworfen.
Irgendwann im neuen Jahr, nach der verhängnisvollen Silvesternacht, in der ein Stuhl in der Heckklappe des Fiesta landete und dessen langsamen Untergang einläutete, kam dann die Nachricht von der WIP: Meine Wohnung würde – zusammen mit tausenden anderen – von der kommunalen Genossenschaft verkauft werden. Sanierung und so weiter wahrscheinlich, man sollte sich mal unterhalten. Nach gerade mal einem knappen halben Jahr.
Würde ich irgendeinen roten Heller auf Herkunft legen (was ich natürlich mache), dann hätte ich bestimmt längst Zigeunerblut zwischen den ganzen Kommunisten, Sorben, Juden und Franken in der Ahnentafel ausgemacht. Schon bevor ich die erste eigene Wohnung in Berlin bezog, bin ich gut ein Dutzend Mal umgezogen. Einerseits lag das an dem unsteten Lebenswandel der Mutter, doch auch die dörferfressenden Braunkohlebagger trugen dazu bei, ebenso wie die Sportkaderförderung der DDR, die ich kurzzeitig am eigenen Leib erfahren durfte, und der Auslandsaufenthalt der Eltern.
Deshalb war der anstehende Umzug eigentlich kein Problem für mich. Über politische Theorien zum Thema Verdrängung machte ich mir damals noch keine grossen Gedanken, wenn, dann nur am Rande und ohne das, was um mich herum passierte, konkret in diese Überlegungen einzubeziehen. Ich war jung, und Jugend braucht Veränderungen, auch räumliche. Ärgerlich war lediglich die Arbeit, die wir liebe- und mühevoll in Bad und Küche, Stuck, Dielen und Türen gesteckt hatten. Als Trostpflaster gab es immerhin 2.500 Mark, womit das nächste halbe Jahr Miete und Leben gesichert war. Der Norma in dem Zelt vorne an der Prenzlauer war zwar unsagbar hässlich, aber auch unschlagbar billig.
– Kreuzberg! –
Inzwischen – das nahm noch in der Christburger seinen Anfang – war ich mit besagter Blicke werfenden Frau zusammen gekommen, ohne viel eigenes Zutun. Sie, ein radfahrverrückter halbniederländischer Friese und ich bildeten die eingeschworene norddeutsche Aussenstelle, später kamen noch ein Schweriner und ein Bremer dazu.
Dieses Mal war es auf Kuba – der erste grosse gemeinsame Urlaub – als uns die Nachricht erreichte, dass der Friese eine sehr schöne, sehr grosse, sehr preiswerte und etwas ungünstig geschnittene Wohnung in der O-Strasse aufgetan hatte. Zwar direkt über einer Kneipe, aber was soll’s, wir waren Studenten, es gab ein paar interessante gewerblich genutzte Hinterhöfe samt ständig präsentem Haus-Hof-Meister mit Schnauzer über der Berliner Schnauze – und eben: Kreuzberg!
Madame wohnte damals noch in Moabit, Beusselkiez. Ihre Berliner Verwandtschaft, die tief im Westen neben Grönemeyer residierte, hatte das organisiert. Zu dieser Zeit war diese Gegend ein grauer Fleck auf allen Stadtplänen, die man als frischer Student so im Kopf hatte – abgesehen von den Nazis der gleichnamigen Kameradschaft, von denen hatte man sehr wohl schon was gehört. Es war nicht ganz so billig wie im Prenzlauer Berg, dafür in den 80ern saniert, halbwegs zentral zu allen drei Unis gelegen und mit vernünftiger Heizung.
Wenn ich mir (was ich oft tat) spätnachts von der Uni, aus der Christburger oder irgendeiner Kneipe in der Nachbarschaft auf wackeligen Rädern den Weg Richtung Westen bahnte und der Morgen irgendwo zwischen Tiergarten und kleinem Tiergarten zu dämmern begann, dann konnte ich mir, trunken und liebestrunken wie ich war, kaum vorstellen, glücklicher zu sein. (Manchmal stieg ich vom Rad – manchmal fiel ich – und legte mich einfach auf den taunassen Rasen zwischen die vorsichtig aus ihren Löchern lugenden Kaninchen, blickte in den Himmel, war überrascht, dass die Siegessäule an einer ganz anderen Ecke auftauchte als gedacht und genoss den Moment, die Gegenwart, das Leben und den ganzen Rest.) Bis sie mir die Tür öffnete, verschlafen und wunderbar.
Und nun also Kreuzberg. Der Weg nach Moabit war ähnlich weit, der zur Uni sogar kürzer und überhaupt: Es war fantastisch.
Als ich in die Christburger einzog, ging in der gesamten Strasse nur das Haus direkt gegenüber als saniert durch. Als ich nach einigen Jahren dort wieder vorbei schaute, gab es noch ganze zwei unsanierte Häuser. In Kreuzberg dagegen schien die Zeit mehr oder weniger stillzustehen seit den 80ern. Sicher, es war viel passiert – und es würde noch viel mehr passieren! – aber als wir hier ankamen, schien es sich nur sehr, sehr langsam zu verändern. Ausgehen, falls man das denn so nennen kann – fand jedenfalls noch lange überwiegend eher in Mitte, Friedrichshain oder Prenzlauer Berg statt.
Allerdings hatte auch Madame langsam, aber sicher Gefallen an dem Kiez gefunden; jenseits der Legenden und des stetigen Studentenzuflusses war es hier auch einfach sehr schön: Bunt, grün, zentral, Kanal. Und immer mehr Bekannte, die in der Gegend wohnten.
Ein paar Häuser die O-Strasse rauf zum Beispiel zwei, die bald zu unseren engen Freunden zählen sollten, erstaunlicher- und erfreulicherweise beides geborene Westberliner und keine Studenten. Dafür aber in der Punk- und Skinkultur grossgeworden und dort noch tief verwurzelt. Wieder so viele neue Erfahrungen und Einblicke! Und ein Hund: Wie sich das für ordentliche Potse-Punks gehörte, hatten die beiden einen Hund. Besser gesagt eine Hündin, die beste, die man sich vorstellen konnte. Sie sollte nun geplanterweise die Berliner Hundebevölkerung um weitere anarchistische Racker bereichern. Was ich wieder viel zu spät registrierte war, dass Madame auch hier schon längst was ins Auge gefasst hatte.
Lass uns doch einfach mal ganz unverbindlich die Welpen angucken gehen, meinte sie. Es bedurfte aber ehrlich gesagt auch keiner grossen Worte, mich davon zu überzeugen, diesem kleinen, braunen, erst ein paar Tage alten Fellknäuel zukünftig ein zu Hause zu bieten.
Das sollte Madames neue Kreuzberger Wohnung werden: Knapp ein halbes Jahr nach unserer WG-Gründung, wieder war es Sommer, begab sie sich auf Wohnungssuche in 36 und 61, was damals noch gemütlich war, wenn man die heutigen Zustände betrachtet. Als wir bei der ersten Besichtigung eintrafen, fand keine 15 Minuten entfernt gerade die letzte Loveparade des Jahrtausends statt; gleich um die Ecke lag der geographische Mittelpunkt Berlins.
Zu dieser Zeit gingen wir noch davon aus, dass ich erst mal in der O-Strassen-WG bleiben würde, trotzdem suchten wir – gerade auch wegen der niedrigen Preise – grosszügig. So rutschte die eigentlich für eine Person viel zu grosse 3-Raum-Wohnung in die Auswahl: Vorderhaus, Ofenheizung, Balkon mit Blick auf die Hochbahn.
– Das Haus –
Die Vormieter, eine Kleinfamilie, wollten wegen des demnächst anstehenden Schulbeginns ihres Kindes dann doch in eine eher ruhigere Gegend ziehen. Sie hatten immerhin ordentlich selbst Hand angelegt: Küche und Bad sahen ganz passabel aus, erstere recht gross, letzteres in der üblichen Altbau-Schlauchform, aber zumindest gekachelt und mit vernünftiger Duschkabine. Die Öfen störten nicht weiter, kannten wir ja von vielen Bekannten – eigentlich waren wir damals eher die Aussenseiter: Studenten, die nicht mit Kohlen heizten.
Dadurch, dass ich aber auch früher schon längere Zeit in der Wohnung des grossen Bruders in der Senefelder zubrachte, war ich mit Kohleöfenbefeuerung recht vertraut und versprach Madame, dass ich ihr das gerne beibringen würde.
Als wir bei der Besichtigung dann schliesslich auf dem schönen grossen Balkon standen (von dem wir bei dieser Gelegenheit erfuhren, dass er eigentlich Loggia hiess), sahen wir direkt unter uns ein paar recht punkig daherkommende Nachbarn das Haus verlassen. Sie bekamen trotz des Strassenlärms mit, wie die Mitbewerber und wir uns über die Brüstung gebeugt laut unterhielten, und schauten zu uns nach oben, wobei sie freundlich grüssten, indem sie mit den Äxten winkten, die sie in den Händen hielten: „Willkommen, neue Nachbarn, wir gehen jetzt zur Loveparade!“ Das gefiel uns.
Nachdem die Besichtigung vorbei war, gingen wir Richtung U-Bahn, unten am Kanal lang. Madame sagte, sie müsse sich erst mal auf eine der Bänke setzen und durchatmen, zur Ruhe kommen. Sofort hätte sie sich in die Wohnung verknallt, sie wollte sie unbedingt haben. Das wunderte mich dann doch ein wenig: Sicher, wir waren in den gleichen Kreisen unterwegs, und sie war mir in manchen Belangen weit voraus, nicht nur mit ihrer Bongsammlung und ihrer Wagenburgvergangenheit. Trotzdem steckte ihre wohlbehütete westdeutsche Obere-Mittelschicht-Herkunft tief in ihr drin, wozu sie auch stand, was unsere Beziehung ab und an recht interessant machte und wofür ich sie auch liebte, unter anderem.
Deshalb überraschte es mich ein kleines bisschen, dass ihr weder die über die letzten Jahre gesammelten und im Hausflur angeklebten Revolutionäre-Erste-Mai-Aufrufe noch die sonstigen, teilweise durchaus sehr ansprechenden Kunstwerke an den Hauswänden etwas ausmachten. Ganz zu Schweigen von der Ofenheizung, der Sperrmüllsammlung im Hinterhof oder der aufgerissenen, notdürftig mit einer Hühnerleiterkonstruktion ersetzten Treppe im Vorderhaus. Das Haus hatte nämlich Schwamm, wie wir später erfuhren. Ach was: das Haus – der gesamte Block!
Doch ganz im Gegenteil, es gefiel ihr sehr, gerade auch weil es von aussen daherkam wie eins der damals noch existierenden besetzten Häuser. Ich hatte noch viel über sie zu lernen, das begriff ich langsam.
Gut einen Monat später war es soweit. Madame hatte gegen die für damalige Verhältnisse riesige Anzahl von sieben Mitbewerbern den Zuschlag bekommen. Am Tag der Sonnenfinsternis war der Umzug, beides gute Anlässe für die Party danach. Auf den obligatorischen „Es könnte etwas lauter werden, ihr könnt gerne vorbei kommen“-Zettel hin fand sich – bis auf wenige Ausnahmen – die gesamte neue Nachbarschaft ein.
Die nächste gute Überraschung, die das Haus barg, auch wenn sie uns zuerst ein wenig überforderte. Partys sollte es in den nächsten Jahren hier noch unzählige geben: Komplette Hauspartys, das jährliche Hoffest mit Livebands im Sommer, Silvester auf dem Dach, Grillpartys ebenda, und natürlich die obligatorischen Privatfeiern in den Wohnungen, geplante zu Geburtstagen oder ähnlichem wie auch spontane, weil plötzlich so viel Besuch auf einmal da war oder die ganzen guten Clubs und Kneipen schon geschlossen oder zu weit weg waren.
– Einleben –
Wir fühlten uns alle drei sehr wohl in der neuen Wohnung: der rasant wachsende kleine Hund, Madame und auch ich. So war es kein Wunder, dass die gemeinsame WG mit dem Friesen für mich nach und nach nur noch die Funktion einer Abstellkammer hatte, trotz der netten Gesellschaft und der vorzüglichen Lage, die uns zum ersten Mai immer ein paar Kamerateams im Wohnzimmer bescherte. Aufrecht, wie wir waren, versuchten wir nicht, von dieser privilegierten Situation zu profitieren, sondern vergaben die Fensterplätze an diejenigen, die dann im Nachhinein nachweisen wollten, wie die schlecht getarnte Staatsgewalt die brennenden Mülltonnen aus den Hinterhöfen zog und mit welchen Codes sie sich verständigten.
Uns das einzugestehen, war auf die eine Art unschön, da die gemeinsame Zeit nun wohl vorbei war. Andererseits hatten Madame und ich in der Gitsch gut zusammen gefunden und auch so viele neue Leute kennen zu lernen – da lagen alte Kontakte durchaus mal eine Weile brach.
Der Balkon wurde bepflanzt, die Wände gestrichen und die Zimmer eingerichtet. Wir waren begeistert von dem professionell gezimmerten Podest im Schlafzimmer und genervt von den morschen 80er-Jahre-Kindersicherungen an den Steckdosen.
Als Überraschungsgeschenk zur Einweihung besorgte ich zusammen mit dem Schweriner nach durchzechter Nacht eine spezielle Hängematte: Er wohnte noch im Prenzlauer Berg und dort sprossen auf nahezu jedem freien Stück Land Kinderspielplätze aus dem Boden, die oft mit sehr grossen und stabilen Kletternetzen ausgestattet waren. Eins davon hing dann – nachdem ich lange die dicken Holzbalken in der Altbaudecke gesucht habe – mitten in unserem Kreuzberger Wohnzimmer, mit halbwegs professionellen Seilzügen ausgestattet. Als nächstes galt es, die Nachbarschaft zu erkunden, ehrlich gesagt konnten wir nach der Party kaum einen Namen oder ein Gesicht zuordnen, es war einfach ein zu grosses Gewusel.
Der Nachbar direkt nebenan war mit allerlei Technik ausgestattet: Zum Musikschrauben, wie er es nannte. Sein Hauptberuf bestand aber darin, Haschplatten mit dem Zug in die westdeutsche Provinz zu schaffen. Manchmal, wenn er zu faul war, schickte er sie auch einfach per Post. Dank dieser Tätigkeit konnte er sich auch das ganze Equipment leisten, ein Apple-Fanboy der ersten Stunde. Wir lernten uns näher kennen und schätzen, als ich kurz nach Madames Einzug in seinem Studio – die guten alten Zeiten – von den auf VHS-Bändern gesammelten Simpsons-Episoden alle Itchy-und-Scratchy-Parts rausschneiden wollte.
Bevor wir uns an die Arbeit machten, musste er erst einmal auf Betriebstemperatur kommen: Die Rechner wurden hochgefahren und die schlichte, doch trotzdem imposante Glasbong gestopft. Aus falschem Stolz heraus lehnte ich sie nicht ab und nahm einen tiefen Zug. Madame berichtete mir später, dass sie etwas überrascht war, mich mitten am Tag im Tiefschlaf auf der Couch zu finden, auf die ich mich wohl noch irgendwie hinüber gestohlen hatte. Die beiden lachten sich über mich kaputt, als er nach ein paar Stunden mit dem fertigen Zusammenschnitt bei ihr an der Tür klingelte. Immerhin hatte ich jetzt eine vorzügliche Haschquelle.
Direkt über uns wohnte der einzig normal scheinende Typ, er war circa zehn bis fünfzehn Jahre älter als wir und arbeitete seinem Äußeren nach auf dem Bau. Deswegen bekam man ihn wohl auch so selten zu Gesicht, die Tagesrhythmen waren doch sehr verschieden. Die Wohnung neben ihm stand leer. Im dritten Stock lebte eine Architektin, die eine Gasetagenheizung und häufig sehr lauten Sex hatte. In der anderen Wohnung auf dieser Etage befand sich die Drogenhölle.
Ich war nicht oft dort, letztendlich aber doch zu oft. Von hier bezog der Nachbar seine Platten, und meine paar Krümel bekam ich wohl fast zum Einkaufspreis von ihm. Die aus dem Dritten wollten mit solchem Kleinkram nichts zu schaffen haben, ihre Dimensionen waren, schon alleine wegen ihrer Kokserei, ganz andere.
Ab und zu verirrte man sich dann aber doch mal hier her: Wenn es etwas Besonderes und Seltenes zu verkosten gab, wenn eine Party gegeben wurde oder wenn man dem Notarzt mit dem Ersatzschlüssel die Tür öffnen musste, weil man einen panischen Anruf von oben bekommen hatte („Ich kann meine Beine nicht mehr bewegen, da muss irgendein Scheiss drin gewesen sein…!“).
Meist waren es allerdings die Gäste, die Grauzone, die um diese Wohnung herumwaberte, die dringend ärztlicher oder psychologischer Hilfe bedurften. Mickey Mouse zum Beispiel. So stellte sie sich debil grinsend vor, als sie mal versehentlich bei uns, zwei Treppen zu tief, klingelte. Und so stand sie in der Tür, bis wir sie auf die Idee brachten, vielleicht weiter zu suchen, wo sie hier doch falsch war. Ein paar Wochen später flog nachts um drei die komplette Kücheneinrichtung aus dem Fenster der Drogenhölle in den Innenhof. Erst der Inhalt des Kühlschranks, dann der Kühlschrank. Erst das Besteck, dann die Besteckschubladen und der klapprige Schrank. So ging das eine halbe Stunde: Wenn die zierliche, apathische Mickey Mouse Ärger mit ihrem Freund, einem der drei Höllenbewohner, hatte, konnte sie auf einmal ungeahnte Kräfte freisetzen.
Zusammen genommen waren das allesamt recht traurige und fahle Gestalten dort oben, sowohl die Kundschaft als auch die Bewohner. Trotzdem wuchsen sie uns mit der Zeit ans Herz, denn es waren eigentlich recht nette Zeitgenossen, keine Gangster-Dealer, eher welche von der Hippie-Fraktion. Deshalb war es auf eine Art auch schade, dass sie eines Tages ganz in ihre umgebauten alten Mercedesbusse und mit diesen dann gen Marokko zogen. Als sie ein paar Jahre später wieder auftauchten, zeigte ihre gesunde Gesichtsfarbe allerdings, dass das eine gute Entscheidung war.
Ganz oben, im Vierten, über der Drogenhölle, wohnten die – im Gegensatz zu unserem direkten Nachbarn – richtigen Musiker. Wie das in der Branche so üblich ist, gingen auch hier viele Leute ein und aus: Groupies, Freunde, Fans und Kollegen.
Aus dieser Masse schälte sich dann ein Kern von vier, fünf Leuten, die – als die Drogenhölle frei wurde – auch in das Haus zogen. Die WG im Vierten bestand aber eigentlich nur aus zwei Typen: Das verpeilte Genie mit dem markanten Lachen und der Keyboard- und Synthiebastler. Wir kamen gut miteinander aus und hofften für die damals mehr oder weniger erfolglos, aber enthusiastisch aufspielenden Jungs, dass sie irgendwann den Erfolg haben würden, den sie dann Jahre später auch hatten. Mindestens.
Neben ihnen wohnte eine weitere alleinstehende Frau, Künstlerin, die das halbe Jahr über in Goa oder auf Gomera oder sonst wo verbrachte. Sie war gut befreundet mit der Architektin aus dem Dritten, zu deren Schreiorgien sie auch gerne dazu stiess.
Abgesehen von uns im Vorderhaus gab es noch zwei Hinterhäuser – für uns hiessen sie Nummer eins und Nummer zwei, im Berliner Vermieterdeutsch aber wohl Quergebäude und Gartenhaus. Wie auch immer. Die allgemeine Pauschalisierung lautete: in Nummer eins wohnt die aktuelle Revolutionärsgeneration, in Nummer zwei die, die sich aufgrund der anstrengenden Kämpfe der 80er Jahre bereits in den Vorruhestand begeben hatten. Letztere bekam man auch seltener zu Gesicht – aus den Augen, aus dem Sinn – aber doch mindestens einmal im Jahr zum von ihnen ins Leben gerufenen und immer noch organisiertem Hoffest.
In Nummer eins hatte, wie auch an der Hausflurdekoration zu erkennen war, der örtliche Antifavorstand in einer heruntergekommenen WG mit unüberschaubarem Mitgliederbestand seine Zelte aufgeschlagen. Wenn man die Leute aus Nummer zwei sehen wollte, ging man zum alljährlichen Hoffest. Bei denen aus Nummer eins brauchte man nur die Pressekonferenzen nach den 1.Mai- oder sonstigen obligatorischen Kreuzberger Demos anschauen und schon sah man sie auf dem Podium, da half auch kein Dreieckstuch vorm Gesicht, selbst mit der Sonnenbrille und dem Basecap waren sie gut zu erkennen. Vor allem, da sie das Haus auch fast immer derart gekleidet verliessen.
Unter den Antifas wohnte die Säuferin, und zum Erstaunen aller lebt sie (dort) noch immer. Auch in ihrer Wohnung gab es ein reges Kommen und Gehen, zwangsläufig wechselte man ein paar Worte, wenn man sich im Hof beim Müll- oder Asche-Runtertragen begegnete. So lernten wir also auch die lokale Alkoholiker-Gang kennen, die sich meist vorne am U-Bahn-Kiosk draussen auf den Bänken traf und dort ihrem Tagesgeschäft nachging. Sie soffen so lange es ging unter freiem Himmel und immer in einer großen Gruppe.
Irgendwann wurde offensichtlich, dass der Typ, der gleichzeitig in zwei Richtungen schaute, und das fast immer mit einem irren Blick, wohl mehr mit der Säuferin teilte als nur den Schnaps. Dummerweise gehörte auch bei diesen Alkoholikern Gewalt zum Habitus, sie schwankte jetzt öfters mit einem blauen Auge durch den Hof. Wir schauten uns das eine Weile mit an, befragten sie in ihren seltenen lichten Momenten und als es einmal im Flur kräftig krachte – er schlug wohl erst sie, und dann vor lauter Wut die Glasscheibe der Hoftür aus dem Rahmen – sprinteten wir runter und machten ihm klar, dass er mit dieser Attitüde hier nichts mehr zu suchen hat.
Anschliessend nahmen wir sie erst mal mit nach oben, setzten einen Kaffee auf und unterhielten uns eine Weile mit ihr. Dabei stellte sich heraus, was sie uns mehrfach wortreich bestätigte: Ihr ist sowieso nicht mehr zu helfen. Sie war vor Jahren zum Kunstgeschichtsstudium nach Berlin gekommen und eben leider in falsche Gesellschaft geraten. Bei ihr war es halt der Alkohol, von dem sie nicht loskam, ebenso wenig wie von den falschen Typen. Ihre Saufkumpane begaben sich auch gerne mal in die Wattewelt, die Schore einem so vorgaukelt. Therapien hatte sie einige erfolgreich abgebrochen. Nach zwei Stunden aufwärmen und Kaffeetrinken liess sie sich immerhin darauf ein, uns wirklich Bescheid zu geben, wenn es brenzlig werden würde. Erschüttert und irgendwie hilflos mit der Einsicht in die Ausweglosigkeit des Säuferdaseins liessen wir sie wieder gehen.
Last but not least gab es dann noch den sympathisch durchgeknallten Polen und seine Freundin, die in Nummer eins unter dem Dach wohnten: Er war einer von den Axtträgern, die uns schon bei der ersten Wohnungsbesichtigung so positiv auffielen, und sie waren vom Äußeren her vielleicht Punks – die polnischen Punks waren damals in Berlin eine nicht zu unterschätzende Gruppe – aber musikalisch eher in der Elektroecke unterwegs. Das betrieben sie auch aktiv irgendwo im RAW-Tempel-Umfeld im Friedrichshain. In unserem Haus bauten sie sich später die ehemaligen Kugellager-Lagerräume aus und versuchten, mit einem Verein die Kids aus der Nachbarschaft von der Strasse und vor die Drumcomputer zu bekommen. Meistens war deren Terminkalender aber schon mit Drogen nehmen und verkaufen, Leute in der U-Bahn abziehen und im Familienunternehmen aushelfen ausgebucht.
Und mit der Wohnung der Polenpunks hat auch eines der denkwürdigsten Ereignisse in der Hausgeschichte unmittelbar zu tun:
Eines Tages wachte er mal wieder nach einer langen Partynacht auf, vielleicht war sein Hund schuld – den hatte ich ja noch gar nicht erwähnt, ein sehr netter Schäferhundmischling namens Albert, soweit ich mich erinnere, der für unseren Nachwuchs gern mal den grossen Bruder spielte. Jedenfalls tropfte etwas auf seinen Arm.
Nun war das Haus wie gesagt ziemlich runtergekommen und genau in der Ecke direkt unter dem Dach ergoss sich bei kräftigem Regen sowieso immer ein veritabler Wasserfall in den Innenhof. Es hätte also auch einfach Regenwasser sein können.
War es aber nicht. Das merkte er spätestens, als sich die Stelle, auf die die Tropfen gefallen waren, rot verfärbte und heftig anfing zu jucken. Er rief sofort Hausverwaltung, Arzt und schliesslich auch die Feuerwehr an.
Als ich an diesem Tag nach Hause wollte, war an der Strassenecke erst mal Schluss. Ich muss mit der U7 gekommen sein, sonst wäre es mir schon vorher aufgefallen: die U1 fuhr nämlich schon längst nicht mehr. Erst als ich dem Polizisten hinter dem Flatterband meinen Ausweis zeigte und schon allein wegen dem Hund, der alleine in der Wohnung war, unbedingt darauf bestand, noch mal ins Haus zu gehen, sagte der nur kurz „Na gut, aber schnell“ und schien wirklich besorgt dabei. Ich durfte den Spruch noch an drei weiteren Sperren aufsagen, bevor ich schliesslich vor unserer Tür stand. Dort war mit Kreide ein weisses Kreuz draufgemalt, dazu noch das Wort „Hund“ mit Ausrufezeichen. Etwas sehr Ernstes schien im Gange zu sein, denn sonst kümmerten sich die Cops einen Scheiss um unser Haus, seit ihnen bei den Hoffesten mehrmals die Reifen durchgestochen wurden.
Ich packte den Hund und ein paar willkürlich für wichtig erachtete Unterlagen und ging in die Eckkneipe, die es damals noch gab. Vorher gab ich noch Madame bescheid, die auch arbeiten war und bei der es wie immer spät werden würde.
Wie sich herausstellte, war die komplette Hausgemeinschaft erst mal für einen Schnaps auf den Schreck bei Charly gelandet, selbst der Bauarbeiter. Der erzählte uns an diesem Abend, der noch sehr lang werden sollte, auch eine Menge interessanter alter Geschichten aus dem Haus – er war hier in den 80ern eingezogen, es war seine erste Wohnung.
Just zu dieser Zeit gab es gerade in dieser speziellen Ecke von Kreuzberg wohl ein paar komische Nazi-Gestalten. Und wie es der Zufall so wollte, legten die ihr Waffenlager auf unserem Dachboden an: Granaten, Schwarzpulver aus Weltkriegsmunition, Batteriesäure oder ähnliches, was dem polnischen Punk schliesslich auf die Arme tropfte.
Irgendwann durfte die U-Bahn dann wieder fahren, das Sprengstoffräumkommando machte seinen Job und kurz nach Mitternacht konnten wir endlich nach Hause. Die Wohnung der Polen wurde notdürftig instandgesetzt, die Hausverwaltung machte nie mehr als sie musste, aber sie nervte halt auch nicht: Das Glück einer seit Jahrzehnten zerstrittenen Erbengemeinschaft. Die beiden Polen suchten sich was im Friedrichshain und standen bei der alljährlichen Gemüseschlacht auf der Warschauer Brücke jetzt eben auf der anderen Seite. Die Friedrichshainer konnten die Verstärkung gut gebrauchen.
[2]
Midtro:
Für das Wahre, Schöne, Gute
Will jeder gerne bluten
Und fühlen
Was es zu fühlen gibt.
– Alltag –
An dem Abend bei Charly in der Kneipe erfuhren wir auch, was es mit dem alten Mann auf sich hatte, der so gut wie jeden Morgen pünktlich um neun mit seinem Uralt-Kadett ankam und in dem kleinen Kabuff im Erdgeschoss verschwand. Der hatte dort nämlich mal einen Laden, der längst verriegelt und verrammelt war, und wohnte bis kurz nach dem Krieg auch in dem Haus. Er war locker über 80 und wurde mit der Zeit auch immer wackeliger auf den ohnehin schon durch Krücken verstärkten Beinen. Ab und zu kamen wir ins Gespräch und eines Tages brachte er diesen Riesenstapel Fotos und Postkarten mit – unser Kiez zwar, aber so kannten wir ihn nicht, dafür waren wir viel zu jung: Wasserwege, die längst zugeschüttet sind, Gasometer, die nicht mehr existieren und Kirchen, die zerbombt wurden. Irgendwann kam er dann allerdings nicht mehr so regelmässig, und dann gar nicht mehr.
Mit Kleingewerbe sah es in unserem Block auch sonst eher schlecht aus. Ein paar Häuser weiter gab es mal einen schlechten Pizza-Lieferservice, der schnell wieder zumachte. Einige Monate später eröffnete ein Videospielverleih in denselben Räumen, der sich erstaunlich lange hielt und von den ortsansässigen Jugendlichen begeistert frequentiert wurde, bis er einem Bäcker weichen musste. Dieser wiederum kam uns sehr entgegen: Wir konnten endlich mal ausprobieren, wie es aussehen würde, wenn der Hund wie im Klischee die Brötchentüte nach Hause trägt, es waren ja nur ein paar Meter. Dann wurde aber der Schwamm unter dem kompletten Häuserblock entdeckt, und eben auch im Gemäuer des Bäckerkellers, und das ging natürlich gar nicht. Dafür trat der Puff, der fünf Häuser weiter in der anderen Richtung lag und über den schon lange gemunkelt wurde, den offensiven Weg nach vorne an und hängte neben dem verstohlen blinkenden Herz im Fenster auch eine Leuchtreklame über die Tür. Die Geschäfte schienen gut zu laufen, nur der Kronleuchterladen hält sich genauso lange.
So zogen die Jahre auch in unserer immer weniger neuen Kreuzberger Heimat ins Land und neue und alte Hausbewohner ein und aus. Nach den Polen war es unser direkter Nachbar, der nach Connewitz zog, was eine zeitlang sehr angesagt war unter Berlinern: die Flucht aus der grossen, hässlichen Stadt nach Sachsen. Kurz darauf verschwanden dann wie schon erwähnt die Dealer aus dem Dritten. Dafür kam ein sehr angenehmer Münchener dazu, der später mit seinem kleinen Bruder dort eine WG aufmachte. Madame und ich holten die Hundegrosseltern aus der O-Strasse ins Haus, später zog noch ein weiteres befreundetes Pärchen in die Wohnung der Musiker-WG.
Wir studierten mehr oder weniger vor uns hin, machten mehr oder weniger gute Nebenjobs und genossen so gut es ging unsere besten Jahre. Der Hund war viel zu schnell erwachsen geworden. Irgendwann fanden wir sogar – nach ein paar handvoll Versuchen – für den mindestens jährlichen Dänemark-Hundeurlaub im stürmischen Februar den idealen Ort im Nirgendwo inmitten der Dünen. Natürlich hatten wir den Fiesta inzwischen standesgemäß durch einen schönen alten eckigen Volvo ersetzt, der Dicker hieß. Schon allein wegen dem Hund, ohne den bräuchte man in Berlin sowieso kein Auto (und keine Urlaube in Dänemark). „Oh, die Dame hat extra Lippenstift für mich aufgelegt!“ spottete der Tierarzt süffisant, als wir ihn im ersten Kohleofenwinter besuchten, weil der Hund unbedingt die heisse, gusseiserne Ofentür beschnuppern musste.
Die Kreise, in denen wir uns bewegten, wurden immer kleiner, der Kiez und auch Berlin sind irgendwann durcherkundet, was eher daran liegt, dass man genügend angenehme Orte gefunden hat, als dass es nichts Neues mehr geben würde.
Jedenfalls lagen die Koordinaten unseres gedanklichen Stadtplans inzwischen zum größten Teil in Kreuzberg, aber auch die althergebrachten in Mitte und Prenzlauer Berg wurden noch regelmässig besucht. Ansonsten kamen auf dem Berlin-Plan in unserem Kopf nur noch sporadisch neue dazu: Der Kickermeister aus dem Bandito machte eine neue Kneipe drei Strassenecken weiter auf. Zwei andere Leute zogen noch drei Ecken weiter ihr „Wie verprass ich mein Erbe“-Experiment noch eine Nummer grösser auf. Der Eimer hatte dafür längst zu. Dann noch der Grunewald –so oft wie es ging für den Hund und wegen des jährlichen Kistenrennens der Potsepunks. Durch Madames Job natürlich alles, was irgendwie mit dem wunderbaren alten Kino in der Nähe vom Zoo zu tun hatte, und das war eine Menge: Premierenfeiern hier und da, obskure Festivals und Privatvorführungen diverser cineastischer Raritäten, nicht zu vergessen der hundertste Geburtstag des Chefs, der noch jeden Tag ins Büro kam, und zum Leidwesen seiner Angestellten auch regelmässig ans Telefon ging.
Stattdessen fuhren wir in der Weltgeschichte umher, sobald sich die Möglichkeit dazu bot: Kuba wie gesagt war die erste gemeinsame Reise, Dänemark jedes Jahr nach der Berlinale, mindestens. Der Band, in der Madame Schlagzeug spielte, ging die Gitarristin in Richtung Südafrika abhanden, was uns ein paar schöne Zeiten in diesem tollen Land bescherte. Der ehemalige Mitbewohner aus der O-Strasse hatte sich und seinen berechtigten Ärger gefangen und arbeitete inzwischen in Amsterdam, was uns als Stadt ebenso begeisterte wie Tel Aviv. Kurz gesagt: Es war eine tolle Zeit, aber es war klar, dass es nicht ewig so weitergehen konnte.
Doch bevor es sich richtig änderte, wurde es erst noch mal richtig besser: Madame steckte mitten im Examensstress, als ich mich entschied, vielleicht doch zurück an die Uni zu gehen und die letzten Scheine zu machen, die Umstände boten diesen Schritt geradezu an. Das Problem war allerdings, dass wir recht schnell bemerkten, dass ein gemeinsam genutztes Arbeitszimmer keinem von uns gut tat, und uns zusammen erst recht nicht. Es sah so aus, als ob wir uns nach etwas Neuem umsehen würden müssen. Obwohl wir doch eigentlich – trotz all der Jahre und all der Veränderungen – dieses Haus und diese Wohnung immer noch sehr mochten.
Sicher, viele Leute waren ein- und ausgezogen in der Zeit, und zugegeben: es hat sich nicht unbedingt nur zum Besseren gewandt. Irgendwann hörten die Hofpartys auf, irgendwann zogen neue Nachbarn ein, die selbst wir „die Jugendlichen“ nannten. Von den ursprünglichen Bewohnern – denen, die da waren als wir hier einzogen – waren nicht mehr viele übrig, und vor allem wenige, die zu richtigen Freunden geworden sind.
Darüber hinaus, wenn man ehrlich ist: Nach zehn Berliner Wintern, einige davon mit sibirischen Ausmaßen, reicht es auch mal mit der Kohlenheizung. Wobei es gar nicht die Öfen oder das Heizen oder das Kohlen-aus-dem-Keller-schleppen war – das Nervigste war die Asche, die überall rumfliegt. Die Kombination aus der flauschigen und unglaublich dichten Husky-Unterwolle des rekordverdächtig haarenden Hundes und der feinen Asche killte ungefähr einen Staubsauger pro Jahr. Und ausserdem wurde in der letzten Zeit ständig die Strasse aufgerissen und mindestens zur Hälfte gesperrt, oder ein geplatztes Wasserrohr aus dem vorletzten Jahrhundert erledigte diesen Job, oder die BVG erneuerte die Hochbahnschienen. Irgendwas war immer.
– Durchbrüche, Umbrüche –
Erstaunlicherweise gab es – wir sind irgendwo in der ersten Hälfte der sogenannten 00er Jahre – selbst zu dieser Zeit Wohnungen, die unseren Vorstellungen von Grösse, Lage und Bezahlbarkeit entsprachen, sogar in der Nähe, denn den Kiez wollten wir eigentllich nicht verlassen. Allerdings schafften wir es nicht, auch nur einen einzigen Besichtigungstermin zu absolvieren, vielleicht hätten wir ansonsten damals schon die Vorläufer der inzwischen berühmt-berüchtigten Wohnungscastings hautnah erleben können.
Der Grund dafür war recht simpel: Wir blieben doch im Haus. Überraschenderweise zog die WG aus dem Musikerumfeld, die sich nebenan eingerichtet hatte, nachdem der Nachbar gen Sachsen aufbrach, in die ehemalige Drogenhölle. Der Münchner war dabei, der Frankfurter, der manchmal nachts auf dem Balkon Kontrabass spielte auch, insgesamt also alles nette Leute. So nett, dass sie uns fragten, ob wir nicht die Wohnung haben wollten – sie hatten von unseren Plänen gehört und sie nicht gerade goutiert. Nun hatte ihre Wohnung aber auch nur 3 Zimmer und eine etwas größere Abstellkammer, ausserdem war der Grundriss eigentlich ziemlich ungünstig. Es war schlauchig, das Bad war auch nicht so dolle, bis auf die Wanne, die hätten wir schon ganz gerne wieder mal genossen. Von der Küche ganz zu schweigen, die war im Grunde nicht vorhanden. Okay – zwei Arbeitszimmer wären drin gewesen, aber dafür auf unsere inzwischen optimal eingelebte und viel besser geschnittenere Wohnung verzichten?
Andererseits: Mit dem Budget, das wir für eine neue Wohnung eingeplant hatten, konnten wir uns auch beide Wohnungen zusammen leisten, wir würden damit sogar entscheidend unter der vorher festgelegten Schmerzgrenze liegen. Nachdem uns diese Idee kam, mussten wir nicht mal eine Nacht drüber schlafen – konnten wir vor lauter Begeisterung auch gar nicht – um eine Entscheidung zu treffen. Kurzerhand stellte mich die WG bei der Hausverwaltung als Nachmieter vor und wir begannen, im Kopf schon mal die neuen Räume aufzuteilen: Zwei Bäder können nie schaden, wir waren längst in der Beziehungsphase, in der man das sofort einsieht. Aus dem grossen langen Balkonzimmer würde die Bibliothek werden, mit den Flügeltüren zu meinem neuen Arbeitszimmer. Dahinter dann das zweite Wohnzimmer mit Kicker, und ganz hinten das Gästezimmer. Und als Krönung zwei Balkone! So standen meine Graspflanzen Madames Tomaten nicht mehr im Weg. Am nächsten Morgen klopften wir die Wand ab, um eine geeignete Stelle für den Durchbruch zu finden.
Allerdings leisteten wir uns diesen Luxus keine drei Jahre. Immerhin gab es so noch zwei legendäre Partys, eine zum Einzug und eine, als wir die zweite Wohnung wieder aufgaben und den Durchbruch wieder zumachten. Madame war mit dem Studium fertig und fing an, sich einen Referendariatsplatz zu suchen, was aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in Berlin passieren würde. Und ich war mal wieder in einer veritablen Krise: Wie befürchtet ging es für sie ins tiefste Westdeutschland, während der Hund und ich zusahen, wie wir alleine in Kreuzberg und vor allem auch mit der Pendelei klarkamen. Es war keine Frage, dass der Hund erst einmal bei mir blieb, schon allein, weil ich viel mehr Zeit hatte, und die Ein-Zimmer-Einliegerwohnung irgendwo auf dem Acker kurz vor Holland wäre für die Hundedame auf Dauer auch nicht so toll gewesen. Obwohl die frisch mit Mist gedüngten Felder ihr ausserordentlich gut gefielen.
So richteten der Hund und ich uns neu in Berlin ein, aber trotzdem wurde ich den Eindruck nicht los, dass etwas fehlte, dass etwas weg war, dass das Leben in der halben, ganzen Wohnung ab und zu mal einen Phantomschmerz-Stich verteilte, wie es nach einer Amputation nun mal oft so ist. Und das lag nicht nur daran, dass uns ein paar Zimmer abhanden gekommen waren. Wir schlugen die Zeit in Kneipen und den wenig übrig gebliebenen Hausprojekten tot, gingen stundenlang am Kanal und fast täglich im Grunewald spazieren, aber eigentlich warteten wir nur darauf, dass Madame uns besuchen kam. Da dies immer seltener passierte, liess ich den Hund immer häufiger übers Wochenende bei ihren Großeltern, die inzwischen längst in den Wedding gezogen waren, und fuhr mit der Bahn gen Westen. Berlin war selten so uninteressant für mich wie in dieser Zeit, obwohl ich tun und lassen konnte, was ich wollte. Überhaupt etwas zu tun war aber in dieser Zeit das Schwierigste für mich, zum Glück war der Hund da, der seinen geregelten Tagesablauf einforderte, und ihren braunen Kindchenschema-Augen konnte ich selbst im dunkelsten Tal keinen Wunsch abschlagen. Als ich dann anlässlich irgendeines Jubiläums an die Uni geladen wurde, um von der guten alten Zeit zu erzählen, merkte ich, dass eine Veränderung jetzt vielleicht nicht das schlechteste wäre. Obwohl es mich natürlich freute, die ganzen anderen Veteranen mal wieder zu sehen.
Es wäre uns trotzdem nie in den Sinn gekommen, damals, die Berliner Wohnung aufzugeben. Aber sie hiess eben inzwischen auch nur noch „die Berliner Wohnung“. Nachdem Madame die Qualen des Referendariats hinter sich gelassen hatte und sogar übernommen wurde, machten wir uns wieder mal auf Wohnungssuche – oder besser gesagt: Mal wieder sie alleine, obwohl wir wenig später gemeinsam einziehen würden. Da Madame in Berlin Jahre auf eine Stelle hätte warten müssen, die dann auch noch viel miesere Konditionen gehabt hätte – dit is Balin! – war klar, dass unsere Zukunft woanders stattfinden würde. Ich war zu dieser Zeit sowieso mal wieder viel flexibler als mir lieb war, und so suchten wir uns eine passende Grossstadt – das musste schon sein, das brauchten wir beide – in der Gegend aus, die Auswahl war hier zum Glück recht gross. Ausserdem konnten wir so aus Jux Briefköpfe mit zwei wichtig klingenden Adressen anlegen, genau wie diese ganzen wichtigtuerischen Jungliteraten der Jahrtausendwende, die wir halb verachteten und halb bewunderten.
In der Gitsch räumten wir zwei Zimmer komplett leer und packten alles, was übrig blieb, in das dritte, das eheamlige Schlafzimmer mit dem Podest, was nach hinten raus ging. Dazu holten wir noch ein paar Bohlen und Bretter von Holz-Possling und bauten ein Hochbett – ausreichend für ein paar (hoffentlich regelmässige) Stippvisiten in der alten Heimat, dachten wir. Ausserdem hatte ich noch einige Termine im nächsten Jahr in der Stadt zu absolvieren – aber unser neues, gemeinsames Zuhause war jetzt definitiv woanders. Es stimmte schon, tief im Westen, wo die Sonne schon lange nicht mehr verstaubt (und ausserdem um einiges später versinkt und es im Winter sehr viel milder ist), ist es viel besser, als man glaubt. Madame hatte grosse Freude daran, das Nest zu bauen: Es war alles perfekt aufeinander abgestimmt und kam ganz ohne Ikea aus. Selbst der Hund gewöhnte sich, trotz ihres Alters, erstaunlich gut an die vielen Treppen – dafür wartete oben ein schöner flauschiger Teppich, so was gab es in der Kreuzberger Studentenbude natürlich nicht.
Bei der machte sich wiederum der gute Schnitt bezahlt: Wir hatten zwei separate Zimmer, die wir untervermieten konnten, noch dazu mit guten Kachelöfen (in den meisten anderen Wohnungen im Haus waren die inzwischen mit preisgünstigen, blöden Allesbrennern ersetzt) und einer komplett eingerichteten Küche samt Geschirrspüler und Waschmaschine, natürlich ganz zu schweigen von dem trotz allem immer noch angenehmen Haus. Weil Madame in der Ferne den Neustart organisierte, übernahm ich die Hin- und Herfahrerei und das Casting. Dummerweise hatten wir die Entscheidung recht spontan getroffen und keiner unserer Berliner Bekannten hatte jemanden zur Hand, der gerade eine Wohnung suchte. Jedenfalls nicht so eine, wir waren schliesslich alle älter geworden und die Leute arbeiteten inzwischen zum Teil im Bundestag oder ähnliches. Da will man nicht mehr mit dem Ofen heizen, den hat man höchstens noch als nostalgische Reminiszenz in der Ecke stehen. Das ging uns nicht anders. Aber wir hatten ja keine Ahnung, auf was wir uns da eingelassen hatte.
– Neustart, abgewürgt, Neustart –
Sicher, auch wir hatten inzwischen im Freundes- und Bekanntenkreis hier und da mal eine Geschichte mitbekommen, die von absurden Wohnungsbesichtigungen handelte. Wo der Geruch der zuvor Verstorbenen buchstäblich noch in der Luft lag, während sich dutzende Leute durch die Bude drängelten: So lange die Lage stimmte, konnte man sich so was scheinbar erlauben. Aber das waren doch irgendwie so Lagerfeuer-Schauergeschichten aus Mitte. Dachten wir. Uns war klar, dass die Zeiten längst vorbei waren, in denen eine riesige Studenten-WG mit einer unvorstellbar hohen Summe aus ihrer sehr schönen Wohnung in der Torstraße rausgekauft wurde. Die Zeiten, in denen wir Studenten-WGs in der Torstraße kannten, allerdings ebenso.
Trotzdem: Madame hatte schliesslich gerade erst eine mehr als passable Wohnung auf einem der teuersten Pflaster Westdeutschlands gefunden. Teuer, das muss man zugeben, in Berlin bekommst du dafür doppelt so viele Quadratmeter. Dachten wir.
Am Mittwoch gab ich die Annonce auf, ich sass mit dem Laptop auf dem Balkon, in der Ferne blinkte der Rheinturm in der Abendsonne und ich überlegte noch, ob es wirklich reicht, nur auf einem einzigen Portal zu inserieren, und vor allem, ob der Besichtigungstermin am Wochenende nicht zu knapp gewählt war. Die nächsten Tage verbrachte ich dann damit, stündlich mein Postfach zu leeren und unzählige Mails zu beantworten, die meisten davon auf Englisch, aber nicht wenige waren auch gleich auf Spanisch geschrieben. Am Samstag durfte ich an die 50 hellauf begeisterte Interessenten durch die Wohnung lotsen und jedes Mal den gleichen Text aufsagen, obwohl ich die Anzeige schon nach einem Tag wieder aus dem Netz genommen hatte.
Die Auswahl war also recht gross, und am Ende ist es dann doch die sprichwörtliche Schwäbin geworden, man mag es kaum glauben. Ihr Argument war – neben ihrer sympathischen Art an sich – allerdings auch schlagend, bei uns jedenfalls: Sie suchte schon seit Monaten, allein der Hund, dieser wirklich freche (sprich nicht erzogene) Australian Shepherd, den sie im Schlepptau hatte, machte es ihr recht schwer. Da wollten wir nicht im Weg stehen, Madame hatte ja auch einige Schwierigkeiten gehabt, unsere alte Hundedame in der neuen Heimat mit ins Boot zu holen. Die Sache wurde mit einem formellen Untermietvertrag offiziell gemacht, alle waren überglücklich und am Montag war ich wieder zurück am Rhein.
Das nächste halbe Jahr verbrachten wir damit, uns einzuleben und die neue Stadt – ach was sag ich – die neue Welt kennen zu lernen. Ein Ballungsraum ballte sich an den nächsten, von Ort zu Ort veränderte sich der Menschenschlag und die Grenzen der Nationalstaaten, die hier teilweise mitten durch die Dörfer verliefen, nahm man wirklich nur beiläufig wahr. Wir begannen, uns wohl zu fühlen und einzufügen. Gut – Karneval ging für uns Norddeutsche gar nicht, und das war ein grosses Hindernis bei der Assimilation. Aber ansonsten klappte es meistens ganz gut.
Doch ab und zu gab es einen empfindlichen Stich, vor allem, da ich in den ersten Monaten noch wirklich oft nach Berlin fuhr, zumal mittlerweile die komplette Familie hier wohnte, über die ganze Stadt verstreut. Was für eine Ironie: Endlich waren wieder mal alle zusammen, da ziehe ich so weit weg, wie es in diesem Land nur geht.
Richtig schmerzlich bewusst wurde uns die Entfremdung von der alten Heimat, als wir einmal mit Auto und Hund herkamen für ein paar freie Tage – Pfingsten – und uns zuerst noch wunderten, dass wir keinen Parkplatz fanden und die Zufahrtsstrassen gerade abgesperrt wurden. Ist ja wie zum Karneval der Kulturen, dachten wir. Und genau so war es dann auch, das hatten wir nur absolut nicht mehr auf dem Schirm, die Verknüpfung Pfingsten-Karneval der Kulturen existierte schon nicht mehr.
Nach nichteinmal sechs Monaten wurde unserer schwäbischen Untermieterin dann langsam bewusst, dass sie das Berliner Nachtleben, was sie in vollen Zügen auskostete, am Ende viel zu vieler Nächte meist im Trinkteufel, ihre Verantwortungen als Hundebesitzerin und ihren Hammeraltenpflegejob nicht unter einen Hut bekommen würde und leider wieder zurück ins beschaulich-ländliche Baden-Württemberg gehen müsste. Was wir komplett einsahen. Da war es uns – gerade nach den Erfahrungen des letzten Castings – auch egal, dass wir eigentlich eine Kündigungsfrist von drei Monaten und eine Mindestmietdauer von einem halben Jahr ausgemacht hatten. Also spielten wir das Spielchen einfach noch mal durch, die Schwäbin hatte auch drei Interessenten an der Hand und so wurden wieder dutzende Leute durch die Wohnung bugsiert. Madame deutete an – es war ja ihre Wohnung, immer noch – dass sie im Hinblick auf die Auswahl der neuen Untermieter hoffte, dass wir uns jetzt nicht alle halbe Jahre einen Kopf um die Kreuzberger Wohnung machen müssten. Denn um ehrlich zu sein, wenn wir wieder nach Berlin zurück gehen würden, was immer noch vage im Raum stand, dann bei aller Liebe wohl nicht zurück in diese Wohnung. Sagte sie.
Von den beiden Münchenern wohnte keiner mehr wirklich im Haus, aber sie hatten es so gemacht wie wir und noch ein Zimmer in der Hinterhand behalten. Der Frankfurter wohnte inzwischen im Vierten zusammen mit einer Kanadierin und erzählte davon, dass er nach Uruguay auswandern wollte. Wir hatten eine neue Nachbarin, die wir nicht kannten und die tagelang scheinbar selbst ihre Wände verputzte, so hörte es sich an. Der Bauarbeiter wohnte immer noch über uns und lebte inzwischen ein befreites, offen schwules Leben samt Rockerkumpels. In der Wohnung der Hundegrosseltern wohnte die nächste Musiker-WG, allerdings aus einer Generation, für die Nirvana das ist, was für uns Janis Joplin und Bob Marley waren: Hätte man gerne noch selbst erlebt. Dafür kehrten die mittlerweile halbwegs berühmt-erfolgreichen Musiker aus dem Vierten ab und zu wieder zurück, oder wenigstens ein paar angenehme, altbekannte Gesichter aus ihrem Umfeld. Die hatten die Wohnung also auch noch gehalten. Die Neuigkeiten aus dem Hinterhaus waren gemischt: Einiges blieb ganz beim Alten, der Juraprof mit dem alten Benz war leider gestorben und die Antifa war mit dem studieren fertig und schwanger. Das war der Stand der Dinge, als ich mich nach einem neuen Untermieter umsah.
Auch Berlin hatte sich verändert. Das lag nicht nur daran, dass ich jetzt quasi von aussen kam und mir der Dreck und die Hundescheisse wirklich auffielen. Denn auf der anderen Seite sah es so aus, dass die halbmeterdicken Plakatschichten in den Hauseingängen in der O-Strasse inzwischen noblen Granitschildern gewichen sind, auf denen „Plakate ankleben verboten“ eingemeisselt war. Bei uns in der Strasse hatte neben dem Puff eine recht populäre und stark frequentierte Ferienwohnung aufgemacht. Und das, was da auf der Admiralsbrücke und im Görli, in den ganzen kleinen Seitenstrassen jenseits des Kanals passierte, damit hatten wir nichts mehr zu tun. Vor Jahren kannten wir die Leute hier noch und feierten zusammen mit dem Musikschrauber-Haschplattenverkäufer-Nachbarn die Eröffnung seines T-Shirt-Ladens (seine neue Berufung!), den er sich mit einem buddhistischen Kumpel teilte, der dort Räucherstäbchen, Bambuskerzen und Batikklamotten vertickte. Ihre Ladeneröffnung hatten sie günstig auf das Graefestrassenfest gelegt, so fanden sie vom ersten Tag an eine treue Kundschaft. Der Laden ist dann später in den Prenzlauer Berg gezogen, irgendwo am Eingang vom Mauerpark lief er noch eine ganze Weile ganz gut.
Wir machten uns einen Spass daraus, die Gegend neu zu erkunden, so als ob wir auch Touristen wären, vom Kanal über die kanadische Pizzeria in der keiner Deutsch spricht bis hoch zum frisch eröffneten Tempelhofer Feld. Hätte ich noch ernsthaft studiert, wäre das eine lohnende Feldstudie wert gewesen. Dazu kamen im Stadtbild merklich mehr offensichtlich arme Menschen, übrigens selbst an den noblen Ufern des Rheins in unserer neuen Heimat. Flaschensammler. In Berlin konzentrierte sich das alles wie unter einem Brennglas. Auch wenn andererseits einige althergebrachte Ecken nicht mehr existierten: Die Abkürzung entlang der S-Bahn-Bögen, die Madame vom Zoo zu ihrem Kino immer nahm und die von den ansässigen Junkies zur Verrichtung aller möglichen Geschäfte genutzt wurde, die gab es längst nicht mehr. Dafür hatten wir jetzt ein Flüchtlingscamp vorm Brandenburger Tor und eins auf dem O-Platz.
Am Ende des zweiten Castings blieben zwei mögliche Kandidaten übrig, die es unserer Ansicht nach am ehesten verdient bzw. nötig hatten und auch gut in Haus und Wohnung passten. Auf der einen Seite zwei niedliche Nachwuchspunks, die wie alle anderen Bewerber die beiden Zimmer zu diesem Preis in dieser Lage natürlich sofort haben wollten. Als Sicherheit hatten sie sogar einen von Mutti abgeschlossenen Bausparvertrag oder etwas in der Art dabei. Das interessierte uns jedoch nicht so sehr, wir hatten das ja alles schon mal durch und der Hausverwaltung war sowieso immer noch alles egal, solange sie keinen Finger krümmen musste. Aber dafür hatten die beiden Punkerjungs zwei Trümpfe, von denen sie gar nichts wussten: Erstens erwähnten sie am Rande, dass sie sich im Tommihausumfeld rumtreiben würden. Und dort waren ja auch die Hundegroßeltern aktiv, die uns auf eine kurze Nachfrage sehr nahelegten, die beiden putzigen Kerle aufzunehmen. Und außerdem erinnerten sie uns an den anderen Jungpunk, der hier kurzzeitig im Haus wohnte.
Der hatte nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit den Kreis zu unseren Anfangstagen im Bandito geschlossen und daher muss das noch kurz erwähnt werden: Als die Bindungen im Haus schon nicht mehr so eng waren, zog er irgendwann bei dem Frankfurter in die WG. Und kurz danach sprach mich der alte Kickerkumpan auf ihn an, mit dem ich früher den Prenzlauer Berg unsicher machte und der – bevor er mit seiner Freundin über Neukölln weiter nach Tempelhof zog und ein Kind bekam – auch kurzzeitig in der Gitsch wohnte. Er meinte, dass das ja ein dolles Ding sei, was aus dem geworden ist. Zuerst hatte ich keine Ahnung, wovon er redete. Dann aber fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Der kleene Punk, der inzwischen gut und gerne in seinen Mittzwanzigern war, hat uns als vierzehn- oder fünfzehnjährige Jugendantifa-Thresenkraft regelmässig beim Kickern über den Tisch gezogen. Ganz selten sogar unter ihn durch kriechen lassen. Damals, vor über zehn Jahren. Das durfte und konnte sonst nur der Meister. In der WG übte er sich dann leider hauptsächlich in Selbstmitleid und dem Verfassen von Songtexten, meist gleichzeitig.
Daher hatten die beiden Punks also eigentlich gute Karten. Doch da war auch noch der zweite Kandidat, einer von den Empfehlungen der Schwäbin. Alle anderen waren raus, die bekamen auch woanders Wohnungen und konnten sich das vor allem leisten. Sie war ihm im Hinterhof über den Weg gelaufen, als er gerade mit einer Rikscha durch die Einfahrt fuhr und sie sind ins Gespräch gekommen, was schliesslich auch bei den freiwerdenden Zimmern landete. Er wohnte gerade notdürftig auf der Couch der Antifa, suchte aber eigentlich was anderes. Und er war Musiker, natürlich! Da würden ihm die zwei Zimmer gut passen, könnte er in einem ein Studio einrichten und überhaupt: Das wäre die Chance für ihn.
Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass ich auch ihn eigentlich schon kannte. Er erzählte mir von seiner Hip-Hop-Karriere, dass er mal illegal gewesen und überhaupt einiges schief gelaufen wäre, inklusive an die Wand gefahrener Ehe. Aber er hat sich endlich gefangen, macht mit den Kids aus der Nachbarschaft im Statthaus irgendwelche Workshops und schaut, dass er ansonsten das mit den Rikschas auf die Reihe bekommt. Nebenbei hatte er noch eine Ausbildung und einen Halal-Lammwürstchen-Fliegenden-Imbiss im Görli zu laufen, und nun ja, der lief wie geschmiert, den neuen Zeiten sei dank. Ihm würde halt nur eine richtige Bleibe fehlen, und diese Möglichkeit im gleichen Haus wäre ja fast schon ein Wink Gottes, Allahuakbar.
So sass ich dann also an diesem Abend wieder da und wusste nicht, wie ich mich entscheiden sollte. Madame hatte nach langen Beratungen per Skype die Segel gestrichen und alles in meine Hand gelegt. Die Schwäbin war zwar die ganze Zeit vor Ort dabei, aber auch heilfroh, dass die Sache überhaupt so glatt über die Bühne ging – letztendlich war sie auch bei den beiden Finalisten gelandet. Wenig überraschend kannte sie sogar die beiden Punks aus einigen Absturznächten in der Tommihauskneipe. Und dann stolperte ich beim Nachdenken und Rumsurfen doch noch mal über den Stagename, den mir der Rapper am Nachmittag bei der Besichtigung nannte.
Da ich mit dieser Musikrichtung nicht allzu viel am Hut habe – oder nur sehr speziell, sagen wir es mal so – hatte es mich schon gewundert, dass mir der Name doch irgendwie bekannt vorkam. Und richtig, es lag nicht an seiner Musik: Vor Jahren gab es mal eine Anti-Abschiebungs-Kampagne für ihn, die relativ breit aufgezogen wurde und mir im Gedächtnis geblieben ist, in einer schummerigen Ecke. Der war jetzt also auf dem Sofa der Antifa-WG gelandet.
Letztendlich beschlossen wir, er hätte die Chance verdient, und die beiden Nachwuchspunks würden mit ihrem Bausparvertrag bestimmt leicht etwas anderes finden. Am Sonntagabend sass ich mit einem weiteren unterschriebenen Untermietvertrag wieder im Zug Richtung Westen, während die Schwäbin mit dem Rapper klären sollte, wer welche Möbel behielt.
– tick, tick, tick … –
Die Pendelfrequenz ging vom Zweiwochenrhythmus in der Fernbeziehungszeit jetzt stark gegen Null. Keine ausgebuchten Wochenenden mehr, weil man alle und alles sehen will und muss. Nicht mehr suchen, ob ein Flug vielleicht billiger wäre als das Bahnticket, was unverschämt ist, und unverschämt oft der Fall war. Mit der 50er Bahncard, wohlgemerkt. Die jetzt nach jahrelangem Abo auch gekündigt werden konnte. Selbst Weihnachten und Silvester fanden nicht mehr in Berlin statt, sondern im neuen Zuhause und am Mittelmeerstrand. Da waren wir also: Angekommen?
Immerhin konnte ich inzwischen ganz gut abschätzen, wann das Hochwasser den recht idyllischen Strand und die unteren Wiesen überfluten würde und man zum Hundespaziergang besser die Gummistiefel mitnahm. Ganz wie im Grunewald, obwohl die hohe Kunst dort darin bestand, im Winter zu wissen, ab wann man die Spikes brauchte, weil der Weg um den See mal wieder glatter war als das Eis auf ihm. Solche Überlegungen konnten wir im milden Klima der neuen Heimat allerdings getrost vergessen; ich begann allmählich zu verstehen, warum für Adenauer hinter Braunschweig die sibirische Steppe begann.
Trotzdem fehlte mir Berlin immer wieder mal ein bisschen, auch wenn wir in der neuen Heimat inzwischen nicht nur eine Stammkneipe, sondern mehrere wirklich gute Punkschuppen ausgemacht hatten. Und uns selbst mit dem lokalen Fussballverein halbwegs arrangieren konnten, vor allem, weil der aktivistische Teil seiner Anhängerschaft uns an die alten Zusammenhänge erinnerte: Sie veranstalteten zum Beispiel ein sehr spassiges antirassistisches Freizeitfussballturnier mit Gästen aus dem ganzen Bundesgebiet. Es gab leckeres Essen und beste Stimmung, inklusive Mini-Ultra-Block für jedes Team und den obligatorischen Pyro-Zwischenfällen. Dank der dazu scheinenden Sonne und der reichlich vorhandenen Zeit war das einer der schönsten Tage seit langem. Irgendwann war es nach einer längeren Pause dann aber doch mal wieder an der Zeit, in der alten Wohnung und der alten Stadt nach dem Rechten zu sehen.
Ein wirklich trauriger Anlass gab dann den letzten Anstoss. Leute sterben, und es war beileibe nicht das erste Mal, dass es jemanden aus meinem direkten Umkreis traf. Trotzdem war es überraschend, und vor allem ein fatales Signal: Das Herz. Ich machte Madame Vorwürfe wegen ihres stressigen Jobs und mich auf den Weg zur Trauerfeier nach Berlin. Viele alte Bekannte fanden sich ein, man war sich einig, dass es nicht so weit hätte kommen dürfen, dass man sich erst zu solch einem Anlass wieder zusammen findet. Das alles und noch viel mehr wurde am Abend ausführlich in der alten Stammkneipe diskutiert, zum Bier gesellten sich mehr und mehr Mexikaner und vernebelte Erinnerungen an die alte Zeit.
Ich hatte dem neuen Untermieter nur kurz vorher per SMS mein Kommen angekündigt. Er antwortete ebenso kurz, dass er gerade leider gar nicht da wäre, dafür aber ein Kumpel von ihm. Dazu noch ein paar unverständliche Hip-Hop-Floskeln. Alter, Digga usw. Als ich nach Hause – also in die Kreuzberger Wohnung – kam, war der Flur ziemlich zugestellt, doch ich war ja auch ganz schön voll, und ausserdem genug damit beschäftigt, das Vorhängeschloss zu meinem Zimmer aufzupfriemeln und meinen betrunkenen Arsch unbeschädigt auf das Hochbett zu bekommen.
Am nächsten Morgen lernte ich dann mit etwas dickem Schädel den schüchternen Mitbewohner vom Rapper kennen. Denn das schien er zu sein, er machte nicht den Eindruck, als ob er nur kurz übers Wochenende hier wäre. Die beiden Zimmer waren auch dementsprechend aufgeteilt, soweit ich das erkennen konnte. In dem einen schien sich darüber hinaus aber wirklich noch ein Tonstudio zu befinden. Gut: Er meinte, dass er vielleicht ab und zu mal einen Freund aufnehmen wollen würde, er bewegte sich schliesslich immer noch in Sans-Papiers-Kreisen. Ich entgegnete damals, dass das prinzipiell kein Problem sei, er aber auch an seinen eigenen wackeligen Status denken sollte. Trotz alledem hätte ich es schon nett gefunden, wenn er uns über die neue Aufteilung der Wohnung vorher informiert hätte.
Egal – Küche und Bad sahen halbwegs in Ordnung aus, auch wenn eines der kleinen Fenster der Badtür kaputt war. Kann passieren, musste repariert werden. Das alles sprach ich dem Rapper auch gleich auf die Mailbox, ich hatte es schliesslich eilig und musste zum Bahnhof, Madame hatte Geburtstag. Irgendwo zwischen Porta Westfalica und Hamm rief er dann zurück und entschuldigte sich wortreich. Kein Thema, sagte ich; ich muss auf alle Fälle wieder öfter nach Berlin, dachte ich. Beim Nachgeburtstagsfrühstück am nächsten Morgen sprach ich das Thema vorsichtig an und Madame machte ein skeptisches Gesicht.
Ein paar Wochen später, wir hatten endlich mal wieder etwas mehr Zeit und den Kopf frei, machten wir uns an die Urlaubsplanung für das Jahr. Zwischendurch stattete ich dem neuen Mitbewohner noch einmal einen Besuch ab, diesmal war ich fair genug, einige Tage im Voraus Bescheid gesagt zu haben. Das sah man der Küche und dem Bad auch an.
Er hatte es sich in der Küche gemütlich gemacht und dort einen kleinen, wackeligen Schreibtisch aufgebaut. Auf dem war gerade mal Platz für den Laptop, einen Ascher und das Tabakpäckchen nebst ein paar losen langen Blättchen. Daneben breiteten sich über den gesamten kleinen Tisch unzählige Papierschnipsel, Visitenkarten und Bierdeckel mit Songtextfragmenten, oder Rhymes, wie er später mal sagte, aus.
So sass er mir gegenüber auf dem winzigen, ächzenden Stuhl – massig und gutmütig, fast kindlich – wie ein Maghreb-Buddha, und erzählte begeistert von seinen letzten Erlebnissen in der Hip-Hop-Welt, und wie es auch bei ihm vorangehe. Just in den kommenden Tagen wolle er ein paar Aufnahmen machen, ein Soli-Ding für die O-Platz-Leute. Aber eigentlich war er auch erst gestern aus der Stadt zurück gekommen, in der Madame und ich uns gerade versuchten heimisch zu fühlen. Zufälle gibt’s! Dort musste er eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Crews schlichten, richtig heftiger Scheiss mit ernstgemeinten Morddrohungen und so weiter. Das war das, was ich verstanden habe, dann zeigte er mir noch ein paar ziemlich grässliche Youtube-Videos auf dem Laptop, dazu schepperten die Aktivboxen, die sich unter dem Schreibtisch versteckt hatten.
Eine weitere Parallelwelt, von der man keine Ahnung hatte, böse Hip-Hop-Gangster, die sich wirklich für solche halten, und das selbst in der neuen Heimat. Aber gut – bevor die 36 Boys in Berlin zum Modelabel wurden, wie ich bei einem meiner vorherigen Besuche erstaunt registrierte, kam man in Kreuzberg um die ja auch nicht rum. Am Abend erzählte der Rapper dann bei ein paar Tüten noch einige interessante Geschichten von früher, bevor seine Brüder kamen und sie im Home Studio verschwanden.
Als ich nach ein paar Stunden die Tour durch das Haus beendet, alle Nachbarn abgeklappert und damit noch einiges mehr intus hatte, waren die Aufnahmen weiter in vollem Gange und die Künstler einige mehr geworden. Ich kletterte auf das Hochbett und erinnerte mich mit Grausen daran, wie früh ich am nächsten Morgen raus musste, nur weil ich den billigen Flug genommen habe. Doch wir wollten ja schliesslich noch den Sonntag zusammen verbringen. Das, was ich von der Musik nebenan unvermeidlicherweise beim Einschlafen mitbekam, war zwar ziemlich laut, aber streckenweise auch überraschend gut.
Urlaubsplanung also. Viel war nicht drin dieses Jahr, schon rein zeitlich. Schliesslich waren wir auch vor ein paar Wochen erst – zwischen den Jahren, für zehn Tage – weit weg gewesen, inklusive einer einsamen, angenehm lauen Silvesternacht am Mittelmeerstrand und einem Schlamm- und Salzbad im Toten Meer am Neujahrstag. Vielleicht ja in den Herbstferien wieder dorthin, meinte Madame, und ich war froh, dass es ihr immer noch so gut gefiel wie mir. Kein Dänemark dieses Jahr, das würde wohl wieder mal nichts werden. Aber wenigstens Ostsee im Sommer, sagte ich. Vielleicht sollten wir das dieses Mal etwas verkürzten, meinte sie, und dafür länger nach Berlin.
– … boom! –
Madame hatte gekündigt. Die Kreuzberger Wohnung. Wir hatten oft und lange darüber diskutiert, und irgendwann habe ich wohl mal gesagt, dass sie es entscheiden soll, schliesslich war es ja ihre Wohnung. Ich konnte ihre Argumente rational komplett nachvollziehen: Es brachte schon immer mal wieder etwas Stress mit sich, Strom, Gas, Telefon, DSL, Reparaturen, Hausverwaltung, kontrollieren ob die Miete auch bezahlt wird (was der Rapper in den letzten beiden Monaten irgendwie vergessen hatte, er war halt so viel unterwegs…)
Andererseits merkte ich bei den Diskussionen, dass ich immer noch verdammt an der Stadt hing, dass es da etwas gab, was mir die Neue nie geben können würde, das war mir inzwischen klar geworden. Also klammerte ich mich an den Strohhalm der alten Studentenbude, beschrieb ihr die Situation, die – ohne dass ich dabei übertreiben musste – in Berlin ja wohl jede Wohnung von jetzt auf gleich vermietbar sein lässt. Und außerdem würde ich mich gerne weiter darum kümmern, wenn mal wieder jemand ein- oder ausziehen müsste. Doch Madame hatte ihre Entscheidung getroffen. Und irgendwie hatte sie ja Recht: War es nicht langsam an der Zeit, die Taue ganz zu kappen?
Das bedeute also, dass wir dem neuen Untermieter schonend beibringen mussten, dass er sich in einem halben Jahr etwas Neues suchen und die ausstehende Miete demnächst mal bezahlen müsste. Da er verständlicherweise sehr gerne in der Wohnung bleiben wollte, setzten wir zusammen mit der Kündigung ein entsprechendes Schreiben an die Hausverwaltung auf. Normalerweise, meinte der Rapper, hätte er mit seiner Geschichte bei solchen Sachen sowieso keine Chance. Andererseits – so versuchten wir ihm etwas Hoffnung zu geben – war unserer Hausverwaltung bisher eigentlich alles ziemlich egal.
Wir hofften auch auf eine Übernahme, da wir so im Sommer mehr Zeit an der Ostsee und weniger Zeit mit Renovieren, Aus- und Aufräumen verbringen müssten. Klar war jedenfalls schon mal, dass wir einige Flohmärkte zu absolvieren hätten, bei dem ganzen Kram, der trotz alledem noch von uns in der Wohnung stand. In der neuen Wohnung in der neuen Stadt waren sowohl Keller als auch Abstellkammer und Dachboden schon komplett vollgestellt, und bis auf die Bücher und ein paar Erbstücke wollten wir wirklich nichts mitnehmen. Eigentlich wäre es auch mal wieder an der Zeit für einen Hausflohmarkt, hatte es schon lange nicht mehr gegeben sowas. Und eine endgültige Abschiedsparty stand dann im Sommer wohl auch noch an.
Also fuhr ich in den folgenden Wochen häufiger nach Berlin, um die ganze Wohnungsauflösungsgeschichte vorzubereiten. Was mir ganz gelegen kam, da ich – nicht nur, aber auch wegen der ganzen Diskussion darüber – unbedingt Ablenkung brauchte. Und ich noch soviel von Berlin mitnehmen wollte, wie ich konnte.
Da nun aber dummerweise die Bahncard gekündigt und spontane Flüge nicht ganz so billig zu haben waren, liess ich mich seit langer Zeit mal wieder auf das Abenteuer Mitfahrgelegenheit ein. Das letzte Mal, ich konnte mich noch gut erinnern, hatte ich die noch bei der Mitfahrzentrale gebucht. In der Manteuffelstrasse, nicht im Internet.
Vollbeladen donnerten meine Schicksalsgenossen und ich in einer losen Kolonne aus drei schrottreifen Kleinbussen unter ständiger Ausnutzung aller Spuren, die die A2 hergab, gen Osten. Im 50-Kilometer-Rhythmus rauchte der Fahrer kunstvoll aus dem Fensterspalt. Doch die Geruchsbelästigung und der Lärm, den das Ganze bei 160Km/h machte, waren unsere geringste Sorge.
Die drängendere war die Todesangst, die einigen ins Gesicht geschrieben stand. Dummerweise war ich fast der letzte, der am Morgen den Transporter bestieg. Deswegen bekam ich den Kopilotenplatz vorne – und vieles mit, was ich besser nicht hätte sehen wollen. Nach mir kam nur noch eine propere alte türkische Mama, die von ihrer Tochter bis zum Einstieg begleitet wurde. Ich bot ihr den freien Platz neben mir an, und sass dann dank meiner Höflichkeit die nächsten viereinhalb Stunden auf dem Notsitz zwischen Gangschaltung, Lüftungsschacht und der Mama. Neben dem Rauchen und dem die komplette Fahrbahn Ausnutzen war der Fahrer auch noch damit beschäftigt, per Headset ständig auf Polnisch Rücksprache mit seinen anderen beiden Kollegen und der Frau von der Zentrale zu halten, die mir am Tag zuvor in akzentfreiem Deutsch Treffpunkt und Zeit mitgeteilt hatte. Diesmal verstand ich allerdings nicht sehr viel von den Gesprächen, aber als wir in der 130er Zone kurz vor Berlin geblitzt und sogleich alle anderen informiert wurden, lernte ich einige neue polnische Schimpfworte.
Der Rapper war natürlich nicht begeistert, doch ich versuchte ihn (und mich) zu überzeugen, dass das mit der Übernahme schon klappen würde. Er versprach, so schnell wie möglich die fehlende Kohle aufzutreiben, aber erst mal müsse er nach Hause: Schon seit zwanzig Jahren hatte er seine Leute dort nicht mehr gesehen, jetzt hatte er die Gelegenheit, günstig hin zu kommen, er hätte da jemanden bei einer Fluglinie kennengelernt.
Bevor ich mich auf den Weg nach Berlin machte, versuchte ich Madame noch mal umzustimmen. Wir hatten bisher keine Bestätigung von der Hausverwaltung bekommen, ich machte mir immer noch leise Hoffnungen. Doch es half alles nichts. Überhaupt: Die Stimmung im ganzen Haus war irgendwie seltsam und es gab wieder einige neue, unbekannte Gesichter. Wenigstens stellte sich die vor kurzem eingezogene Nachbarin bei genauerem Hinsehen als ganz passable Zeitgenossin heraus, mit ihrem kleinen Knall passte sie ganz gut hier rein.
Auch der Kiez, selbst unsere hässliche Ecke davon, wurde mir immer fremder. In der alten Fabrik um die Ecke wurde jetzt Kunst ausgestellt und der Club daneben gehörte inzwischen zu den angesagtesten der Stadt, mit dementsprechendem Publikum. In der Seitenstrasse hatte eine Anwaltskanzlei aufgemacht, vielleicht angelockt von dem Büromöbelladen, der sich dort schon so erstaunlich lange hielt. Kurz darauf bekamen die Anwälte ihre Kantine: Ein kleines Bistro öffnete im Nebenhaus, und das Eckhaus zur Hauptstrasse, wo Charly, der schon lange tot war, seine Kneipe hatte, schien recht aufwendig saniert zu werden.
Andererseits: Zeiten ändern sich nun mal; bei den ganzen Berlin-Diskussionen hatten Madame und ich gerade überrascht festgestellt, dass da mal eine uralte Reifenwerkstattbretterbude stand, wo seit gar nicht so vielen Jahren jetzt der Getränkesupermarkt ist. Die hatten wir fast vergessen, obwohl wir dort die ersten Winterreifen für den Dicken besorgten.
Aber der Tabakladenverkäufer, der seinem Imperium gerade im Nebenraum einen Backshop hinzugefügt hatte, erkannte mich trotzdem noch nach jeder längeren Abwesenheit wieder. Ein paar Sachen blieben also doch, die Hochbahn-Baustelle schien da inzwischen auch dazuzugehören. Und an dem Haus neben der Parkimitation hing immer noch das „Farbfernseher ab 98,-DM“-Schild.
Am Montagmorgen machte ich mich auf den Heimweg, nicht ohne vorher noch ein paar ernsthafte Gespräche zwischen Tür und Angel über den Auszugstermin mit dem Rapper geführt zu haben, beziehungsweise was er noch alles tun und für Unterlagen besorgen müsste, um in der Wohnung zu bleiben. Das Mitfahrgelegenheitsexperiment wurde abgerundet und komplettiert, nachdem ich eine geschlagene Stunde an der hässlichen Gesundbrunnenbaustelle in der Kälte wartete – vergeblich, wie sich herausstellte. So fuhr ich um ein sehr teures Bahnticket ärmer Richtung Westen, das erste mal fast froh, das alles und diese Stadt hinter mir zu lassen.
Abends erzählte mir Madame, dass Post gekommen wäre. Die Hausverwaltung sei nicht mehr zuständig, das Haus verkauft. Schlechte Nachrichten für den Rapper, denn sie blieb bei ihrer Meinung.
Madame hatte also gekündigt. Und wo sie schon mal dabei war, nahm sie sich einige Wochen später als nächstes unsere Beziehung vor. Ich bot ihr an, um Zeit, Raum, Abstand und einen klaren Kopf zu gewinnen, erstmal nach Berlin zu fahren, dort war ja sowieso noch einiges zu erledigen. Jetzt wohl erst recht.
Wir hatten eine Woche Bedenkzeit ausgemacht. Eine Woche, nach fünfzehn Jahren. War es wirklich soweit? Kein „Ist es eigentlich kalt draussen?“ mehr nach dem Aufstehen? Waren wir eines der Paare geworden, die sich eine Zeit lang in den deutschen Berlinale-Forum-Beiträgen tummelten, die wir uns trotz allem immer wieder gerne zusammen anschauten? Die aus der Grossstadt meistens an irgendeinen verdammten See fuhren, merkten, dass sie sich nichts mehr zu sagen hatten, sich also nicht mal aussprechen konnten und einander deshalb den ganzen Film über nur anschwiegen? Wo wir doch mal so gut zusammen schweigen konnten?
Als sie nach einer Stunde von ihrer Freundin aus anrief und meinte, vielleicht wäre mein Vorschlag mit dem Rückzug nach Berlin keine so schlechte Idee, gab ich dem Hund, den ich nur ungern zurückließ, einen Knochen, suchte ein paar Sachen zusammen und einen Zug aus dem Fahrplan. Sie hatte mal um mich gekämpft, jetzt gab sie uns auf.
Komplett neben der Spur fiel ich in den ICE-Sessel und blickte stumpf in die Nacht, die sich über den ostwestfälischen Äckern breit machte. Ich war wie betäubt, so dass es mir herzlich egal war, was der werte Herr Zugbegleiter dauernd erzählte, ich schaltete ab. Meine Mitreisenden allerdings wurden von Durchsage zu Durchsage ungehaltener, so dass ich irgendwann die Ohrstöpsel rausnahm, mich räusperte und fragte, was denn los sei. Normalerweise waren die Spätzüge – dieser sollte um Mitternacht in Berlin ankommen – durch meist angenehm ruhige und zurückhaltende Passagiere gekennzeichnet. Jetzt aber wurde mir aufgeregt erzählt, dass wir nicht nur diese blöde Umleitung wegen der Flut nehmen mussten, sondern auch noch an irgendeiner Weiche stehen und warten. Mich liess das ziemlich kalt, ich schaute nach, in welchen Abständen die Nachtbusse fuhren und schrieb dem Mitbewohner eine Nachricht. Und Madame ungefähr dreissig, wovon ich drei abschickte.
Irgendwo auf der Ausweichstrecke hinter Wolfsburg meinte der Sturm dann, einen Baum auf die Oberleitung schmeissen zu müssen. Der ICE fuhr also im Schritttempo über Nebengleise, vermutlich durch Sachsen und Polen, um schliesslich nach acht Stunden kurz vor vier in Berlin anzukommen. Die Revolution im Zug war vor zwei Stunden in allgemeine Ermattung umgeschlagen und der menschenleere, abweisend triste Berliner Hauptbahnhof passte wunderbar zu meiner Stimmung. Bis mir einfiel, dass das früher hier der Lehrter war, an dem ich immer mit dem Rad vorbei fuhr, wenn ich zu ihr nach Moabit wollte: Nur noch am Knast vorbei, dann würde bald der kleine Tiergarten kommen und die Thusnelda-Allee…und dann wäre ich gleich da. Gewesen.
Um kurz vor Fünf schloss ich die Wohnungstür auf, als im selben Moment jemand von drinnen raus wollte. Ich hatte ihn noch nie gesehen, und er schien aufgrund seiner Aufmachung einen wichtigen Termin zu haben, weisses Hemd, geputzte Schuhe, schnieker Anzug. Wir musterten uns einen Moment lang gegenseitig, aus dem Nebenzimmer war ein Schnarchen zu hören. Ich fragte nach dem Rapper, auf die Tür deutend. Non, meinte er, dans la cuisine.
Der Buddha sah etwas durch den Wind aus, wie er da nur mit Shorts und Bong bekleidet vor dem Laptop saß. Seinen dicken Kopfhörern sei dank hatte er mich nicht kommen gehört. Aber an diesem Abend – bzw. Morgen – war ich der ungeschlagene Meister im Scheisseaussehen. Auf meine mürrische Frage, wer das denn eben gewesen sei, erzählte er, nachdem er sich etwas gesammelt hatte, irgendwas von seinem Cousin, der jetzt, wo er doch in ein paar Stunden losfliege, ab und zu mal vorbeischauen würde. Diesen verdammten Heimatbesuch hatte ich ganz vergessen. Ich erklärte ihm kurz die Situation, von der ich selbst ja eigentlich gar nichts wusste, und kletterte todmüde auf das Bett. Grandioses Timing, alles in allem.
Die nächste Woche war die Hölle: Langeweile besäuft sich, meilenweit.* Ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Und das lag nicht daran, dass der Rapper wie es schien zwei neue Untermieter aufgenommen hatte, während er bei seiner Familie weilte. Denn als ich nach einigen unklaren Tagen dem Cousin wieder über den Weg lief, hatte der eine Begleitung und Einkäufe dabei . Von Verwandschaft konnte auch keine Rede sein: Der Rapper hatte die beiden zwischen O-Platz und Görli aufgesammelt, so weit so gut. Allerdings hatte er ihnen den Schlafplatz für zwei Monate versprochen und darüber hinaus auch dementsprechend abkassiert. Pro Nase ungefähr den Betrag, den wir von ihm bekamen. Oder bekommen sollten, eigentlich.
Natürlich waren die beiden Jungs alles andere als begeistert. Doch nach einer langen, teils ziemlich agressiv (vermutlich wegen neumodischer Drogen) und verzweifelt geführten nächtlichen Diskussion war ihnen klar, dass wir in vier Wochen hier raus mussten. Alle. Was mir auch langsam bewusst wurde, wenn ich mal nicht auf eine wie auch immer geartete Nachricht von Madame wartete oder mir die Birne wegknallte, oder beides. Meist beides. Zum Glück waren noch ein, zwei Nachbarn übrig, die mir die Katastrophe an der Nasenspitze ansahen und mich erstmal auffingen. Bis dann pünktlich nach einer Woche der Anruf kam, der das aussprach, was sowieso klar war.
Outro:
Dry your eyes mate
I know it’s hard to take but her mind has been made up
There’s plenty more fish in the sea.
Dry your eyes mate
I know you want to make her see how much this pain hurts
But you’ve got to walk away now
It’s over.
http://www.youtube.com/watch?v=TpyQi3SEuuY
[Und ich hatte nicht einmal den Hund…]
– Epilog –
Ich wurde dankenswerterweise unter diverse Fittiche genommen, verbrachte die Tage mit Sachen räumen und packen, trug unzählige Müllsäcke aus der Wohnung und einige Biere zum Kanal. Zum Glück war Sommer in Berlin, sagte ich mir immer wieder, und nicht November. Viel geholfen hat es nicht. Im Gegensatz zu den Nachbarn, die anboten, mich gerne auch für länger aufzunehmen.
Zwei gleich, ohne langes Gerede. Der Frankfurter zog tatsächlich nach Südamerika, wenigstens für ein halbes Jahr. Er freute sich regelrecht, dass ich in dem Monat, in dem er seine Abschiedstournee bei Freunden und Familie gab, auf die Pflanzen aufpassen konnte. Und er hatte sowieso schon das kleine Zimmer hinten leer geräumt, was er für das halbe Jahr vermieten wollte. Mein Leben und alles, was ich mitnahm, passte also tatsächlich in einen so kleinen Raum, gestapelt bis unter die Altbau-Decke.
Im Haus flogen die Gerüchte geschwaderweise umher. Fest stand, dass ein exotisches Gastronomie-Imperium das Haus gekauft hatte. Angeblich im Paket mit ein paar anderen, sie hatten es sich wohl noch nicht einmal angeschaut. Bei der Erbengemeinschaft waren in den letzten Jahren immer mal wieder Leute weggestorben, bis sich schliesslich diejenigen durchsetzen konnten, die verkaufen wollten.
Dann hieß es, dass der alte Mann von dem verrammelten Laden ganz unten dagewesen wäre. Er war gar nicht tot, wie alle dachten, sondern nur fast. Er lag für ein paar Jahre oder so im Koma und tauchte plötzlich wieder auf, der zähe Kerl! Über die Miethaie konnte er nur lachen: Er hatte sich schliesslich weder vom letzten Krieg, noch von Blockade oder Teilung und schon gar nicht von den Bonnern aus diesem Kiez vertreiben lassen, wie er stolz sagte. Immerhin hatte er schon in den 20ern mit dem späteren Verursacher der Erbengemeinschaft im Sandkasten gebuddelt und von ihm dann ein lebenslanges Nutzungsrecht für die inzwischen wieder sehr attraktiven Gewerbe- und Lagerräume im Erdgeschoss zugesichert bekommen.
Als Madame dann schliesslich mit dem Hund kam, war ich überrascht, wie sehr ich mich doch noch über die beiden freuen konnte. Also: überhaupt. Insgesamt verbrachten wir noch mal eine erstaunlich gute Zeit, auch wenn es darum ging, die Wohnung aufzulösen, die in den letzten 14 Jahren einen Großteil unseres gemeinsamen Lebens bestimmt hatte, das jetzt ja sowieso in Trümmern lag.
Aber das Haus verlassen wollte ich auf gar keinen Fall. Es wäre auch keine gute Idee gewesen, mir in meinem Zustand diesen Wohnungssuchwahnsinn anzutun. Zum Glück – und das war trotz allem in den letzten Wochen nicht das erste – entschied sich die Untermieterin des kleinen Bayern, eine Praktikums- oder Aussteigerstelle bei einer Kommune irgendwo in Niedersachsen anzutreten.
So kam es, dass ich jetzt seit einem guten halben Jahr in der ehemaligen Drogenhölle wohne. Die Spuren sämtlicher Vormieter und ehemaliger Mitbewohner sind hier noch deutlich zu erkennen, was mich gleich heimisch fühlen liess: lateinische Zitate, mit Bleistift an die Wände gemalt, wahrscheinlich von den Dealern („Nulla hora sine linea“); linksradikalaktivistische Spuckis mehrerer Jugendantifa-Generationen; Bayernpropaganda-Postkarten („Gute Menschen kommen aus Bayern“). Ich fügte ein bisschen was hinzu, und habe das auch weiterhin vor. Unsere alte Telefonummer, die mit roter Farbe neben den Flurspiegel gepinselt wurde („First Floor: 615….“) habe ich bewusst noch nicht übergemalert.
Es ist nicht gut, aber es ist besser geworden. Könnte ich erzählen und es fast selber glauben. In unserer alten Wohnung, an der ich relativ schnell ohne Bauchschmerzen vorbeigehen konnte, wohnen längst die Tellerwäscher aus den Restaurants. Mal so ins Blaue geraten. Oder die Verwandtschaft ist einfach nur nachgezogen, oder beides. Mit Teppichboden und Gasetagenheizung.
Selbst der Hund, im Herbst auf Scheidungskindbesuch in der neuen WG, blieb nur zwei, drei mal länger schnuppernd vor der alten roten Türe stehen, um sich dann die weiteren zwei Treppen hochzumühen. Inzwischen kann ich auch zur morgendlichen Lektüre wieder Deutschlandfunk hören, obwohl dort in den Verkehrsmeldungen immer die vertrauten Autobahnnummern zwischen Wuppertal und Aachen vorkommen, die jetzt für mich in einer Welt liegen, zu der ich keine Beziehung mehr habe. Wortwörtlich.
Ansonsten: Ich habe ich mich monatelang abgeschossen und verkrochen. Ab und zu überreden lassen, rauszukommen. Inzwischen vielleicht wieder ein ganz klein wenig Glück & von mir selbst gefunden. Und ja, ich bin froh, wieder hier zu sein: zurück in Berlin.
[Stimmt: Das ist keine lustige Geschichte. Deshalb tut mir der kitschige Soundtrack auch gar nicht leid. Exit:
Stell dir vor, du wärst wieder allein unter Leuten
Sängst traurige Lieder vom Sein und Bedeuten
Vom Schreien und Sich-Häuten
Vom Wollen und Nicht-Kriegen
Von Kriegen und Frieden
Vom Niemals-Zufrieden-Sein]
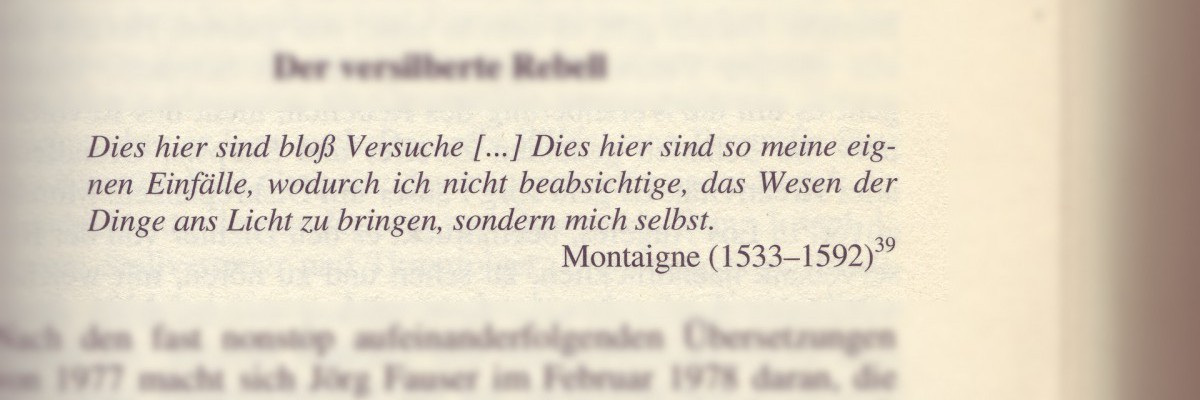
Ach, ach, und ach.
Jetzt bin ich traurig.
Schön, dass du wieder zurück in Berlin bist und hier so herzergreifend schreibst.
‚tschuldigung! 🙂 Naja, es muss wohl auch manchmal traurige Geschichten geben. Wie sagt der Bayer: passt scho’…
Mit Glück und Trauer verhält es sich wohl so, wie mit Hoch und Tief. Das eine kommt ohne das andere nicht aus.
Entschuldige dich bitte nicht, ich habe gerne mitgelitten. 🙂