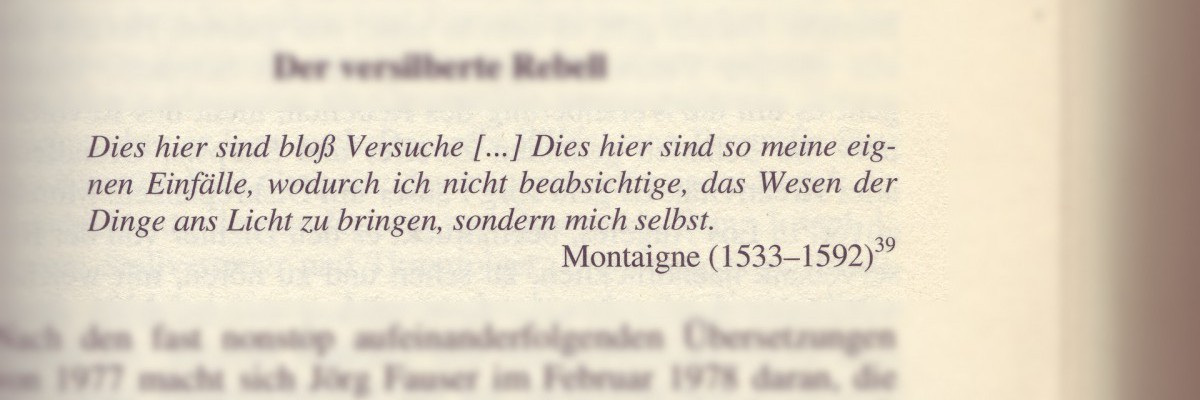(via)
Ich werde durch einen schmalen Spalt gezerrt. Das massive Stahltor – eines von so vielen in dieser Stadt, an denen man achtlos vorbeigeht und sich nie fragt, was sich wohl dahinter verbirgt – bewegte sich kurz davor wie von Geisterhand gesteuert um dreissig oder vierzig Zentimeter nach rechts, gerade breit genug, um nacheinander durch die Öffnung hindurchzuschlüpfen. Oder gestossen zu werden.
„Bitte kommen Sie mit, zur Klärung eines Sachverhalts!“ sagte die zierliche Frau, bevor sie mich am Arm packte und in eine kleine Nebenstrasse manövrierte, Richtung Stahltor, wie ich jetzt weiss. Berlin Mitte, es ist der 11. Oktober 2014, vielleicht halb elf abends, die Nacht liegt dunkel und nasskalt über der Stadt. Oder war es doch schon Wedding? Ich habe die Orientierung verloren, kein Wunder, so wie ich in den letzten Stunden durch die Stadt geirrt bin.
Schweigend gehen wir nebeneinander die Auffahrt hinunter. Meine Frage nach dem Wohin wurde mit einem spöttischen Lächeln ignoriert, also werde ich keine weiteren Kommunikationsversuche unternehmen, denke ich mir. Schweigen ist Gold. Das Tor schliesst sich hinter uns und die Frau lässt jetzt wenigstens meinen Arm los. Unten angekommen werden wir von einer weiteren Person empfangen: strenger Blick, der Griff nach meinem Rucksack. Wir befinden uns in einem Krematorium.
Wenige Augenblicke zuvor, als wir auf das sich öffnende Tor zusteuerten, brüllte noch jemand von der Strassenecke ein paar Meter weiter: „Was ist das denn für eine Scheisse, Verfassungschutz oder was? Fangt ihr die Leute jetzt schon von der Strasse weg oder wie?!“ Wohl eine der wenigen nicht kalkulierbaren Aktionen an diesem Abend, aber es machte nichts, es war nur ein einsamer Rufer. Ich hatte keine Zeit, mich umzudrehen, sein Gesicht zu erkennen oder einen Hilferuf abzusetzen. Ich war schon längst in den weissgekachelten Räumen.
Noch vor einer Stunde hatte ich Angst, meinen Kontakt zu verpassen. Ich wartete an der Tram-Schleife vor dem Jahn-Stadion auf einen Anruf, doch das Feuerwerk dort war so laut, dass ich fürchtete, das Klingeln des Telefons nicht zu hören. Nur wenige Minuten später war mir jedoch klar, dass Sie mich im Blick haben, ständig. „Warten Sie, bis der Mann in der schwarzen Jacke aufsteht, dann dürfen Sie weitergehen.“ sagte die Stimme am Telefon.
Es war nicht weit entfernt von einem relativ belebten Platz, als die kleine Frau meinen Oberarm ergriff. Irgendein türkisches Fest wurde dort gefeiert, Kinder standen in einem Kreis und tanzten, die Erwachsenen klatschten den Rhythmus dazu. Die Lichter der Spielotheken, Kneipen und Spätis beleuchteten die breite Strasseneinmündung; kein Zwielicht, nichts, wovor man Angst haben müsste, eigentlich. Ich war gerade dabei, das Vermissten-Plakat mit dem Antlitz von Murat Kurnaz, das an einem Stromverteilerkasten hing, etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, im Begriff, es abzureissen, auf der Suche nach einem Hinweis. Ich dachte, das wäre mein Auftrag gewesen. Dann der Griff, das Tor, der Spalt und die Kacheln.
Inzwischen sitze ich auf einem unbequemen Hocker in einem langen, schlauchigen Raum. Vor mir ein Schreibtisch, darauf ein Stapel Papier und eine Lampe, die mich blendet. In meinem Rücken wäscht sich die zierliche Frau gerade die Hände, dann raschelt etwas. Eine Tüte? Für meinen Kopf? Ich will mich nicht umdrehen, sondern mustere lieber so unauffällig wie möglich meine unmittelbare Umgebung.
So oft habe ich darüber gelesen, und immer wieder hiess es: Anna und Arthur halten das Maul. Nach allem, was ich an diesem Abend erlebt habe, scheint mir das auch die beste Lösung zu sein: Keine Spielchen spielen, kein Kräftemessen mit der älteren Frau, die mir, inzwischen auf dem viel bequemeren Stuhl auf der anderen Seite des Tisches sitzend, schweigend in die Augen starrt. Stattdessen versuche ich, das „Kein offenes Feuer“-Schild zu fixieren, das ein paar Zentimeter über ihrem Kopf an der Wand hinter ihr auf den weissen Kacheln klebt, möglichst unverkrampft. Was folgt, ist das grelle Licht. Und Schweigen: Ihres und meines.
Ich beginne, Kacheln zu zählen und Szenarien durchzuspielen. Auf dem Tisch liegt meine Akte, eine stumme Anklage, doch sie genügt vollkommen, bedarf keiner Worte. Ich bemerke, dass eines der Oberlichter in dem langen, schmalen Raum blank liegt, seine Verkleidung heruntergeklappt wurde. Die zwei Neonröhren, auf halbem Weg zwischen mir und dem Schreibtisch an der Decke hängend, scheinen selbst ausgeschaltet angriffslustig in meine Richtung zu zwinkern. Schräg hinter mir höre ich auf einmal Wasser tropfen.
***
Als ich mit dem Freund und Mitbewohner auf der Suche nach ein oder zwei OZ we miss you-Stickern für unseren Kreuzberger Kühlschrank durch Hamburgs Straßen lief, erzählte er mir von einer Idee für das folgende Wochenende: Sie würden beide nach Berlin kommen und es gäbe da ein Projekt von ihren Münchener Leuten, das ziemlich aufregend und spannend klang. Und das mich letztendlich auf den unbequemen Hocker in dem stillgelegten Krematorium gebracht hat.
Nachdem ich dort ungefähr 15 Minuten hin und herrutschte und mit den Händen rang (meine Variante des Vorhabens, keine Nervosität zu zeigen), hörte ich hinter mir die Tür klappen. „Okay, es ist vorbei. Du bist erlöst, S. ist schon hier und wartet nebenan auf dich, A. braucht noch eine dreiviertel Stunde, ungefähr.“ Die Stimme gehörte Christiane Mudra, und es war mein Schlusssatz in ihrem Überwachungsexperiment YoUturn.
Sie und ihr Team haben mich in den gut zwei Stunden davor quer durch Mitte und Wedding gelotst – eine von mehreren möglichen Routen, in meinem Fall auf den Spuren der deutsch-deutschen Teilung und ihrer Konsequenzen.
Anfangs glich es einer Schnitzeljagd: In Mauerspalten oder unter Weinranken galt es, verborgene Botschaften zu finden. Neben dem Hinweis auf das nächste Versteck befand sich auch immer eine Stasi-Akte, ein NSA-Dossier oder ein Vernehmungsprotokoll in den Unterlagen. Während man sich von Station zu Station vorarbeitete, dabei das Papier in der Hand, die Informationen überfliegend, kam immer mehr ein Gefühl von Gehetztsein auf. Dazu dann noch die Anrufe, die einen durch die Stadt dirigierten und Anweisungen gaben: „Spielen Sie jetzt Track 3 ab!“ Oder der erschütternde Brief einer Mutter, deren Sohn von der Stasi umgebracht wurde, weil die Eltern ausreisen wollten. Handgeschrieben, mit einer Blume auf dem Gedenkstein an der Bernauer Strasse abgelegt. Spätestens, als ich zögerte, ihn von dort wegzunehmen – das musste ja meine Botschaft sein – begann es, ernst zu werden; begann ich, mich darauf einzulassen.
Nach ungefähr einer halben Stunde war der Kloss im Hals verschwunden, der Druck auf der Brust konnte mit großen Schlucken aus der Augustiner-Flasche bekämpft werden (richtig verschwunden war er aber erst am nächsten Morgen). Bis die letzten „Zuschauer“ angekommen waren und wir die gelungene, von uns allen für großartig befundene Vorstellung feiern konnten, war noch etwas Zeit für die Dokumentation des Stückes: Aufgebaut neben dem improvisierten Verhörraum, stilgerecht dort untergebracht, wo man nun mal die Leichen im Keller hat – im Kühlraum des Krematoriums, gegenüber der Wand mit den Reihen quadratischer Türen, die allerdings alle verschlossen waren.
Später, in irgendeiner Weddinger Kneipe, wurde noch viel über das Stück, dessen Entstehung, die hunderten geführten Interviews und die verschiedenen Erfahrungen damit in München, Potsdam oder eben jetzt in Berlin geredet. Natürlich gab es dabei auch immer unverhofft komische Situationen, etwa, als die Akteure in einen Polizeiaufmarsch gerieten und das Ganze für Kulisse hielten. Oft waren die Erlebnisse aber erschreckend: Wie einfach man Menschen von der Bildfläche verschwinden lassen kann, am helllichten Tag. Wie wenig Einsicht es gibt – damals ja … aber jetzt doch nicht, nicht bei uns… Viel zu selten regt sich Widerstand.
Hoffnung? Nun ja, eine ganze Weile nach dem Ende des Stückes kamen wir nochmal auf meine „Verhaftung“ zu sprechen. Bis dahin hatte ich fest angenommen, der einsame Rufer gehörte zur Crew. War aber gar nicht so. Immerhin…
* Auf die Überschrift bin ich natürlich nicht von alleine gekommen….