



Protokoll eines ständig scheiternden Lebens
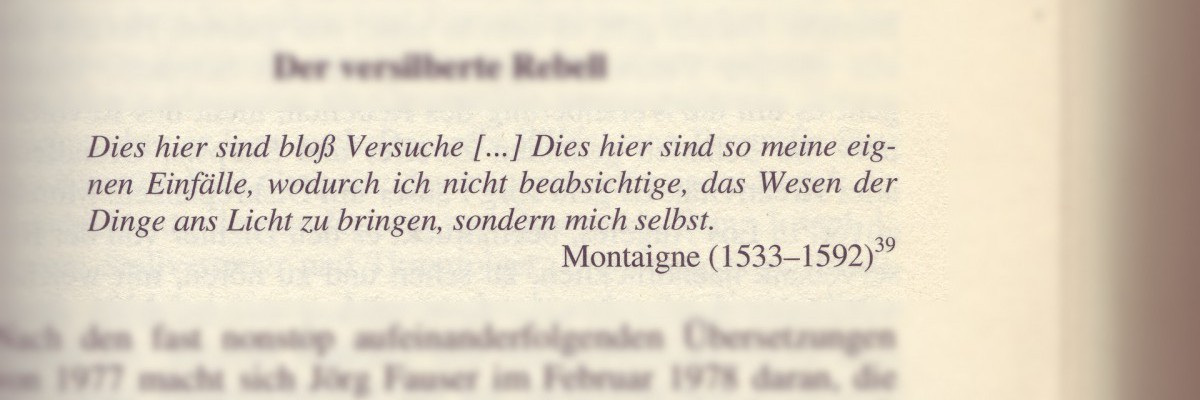
Über Inspiration, das Schreiben, das (Vor)Lesen, Bücher, Filme, Musik und den ganzen Rest: Von Kriegen und Frieden, und auch vom niemals zufrieden oder je ganz fertig genug sein. Kann Spuren von Drogen enthalten.
Ein einseitiger Briefroman in Fortsetzungen
(2002-2004)
(Zur Vorrede und Teil I hier entlang.)
Datum: [Juni 2003]
Betreff:
Hallo M.,
jetzt endlich komme ich erst dazu, dir zu schreiben, dabei bin ich schon fast wieder eine Woche hier. Naja, viel zu tun, du kennst das ja ;). also: vielen aufrichtige Dank noch mal für die nette unterkunft & gesellschaft, ich habe das echt sehr genossen. da bin ich auch gar nicht traurig, dass ich mein shampoo vergessen habe *g*. siehe meine hinterlassenschaften einfach als zeichen meiner gastfreundschafts-dankbarkeit…
ich hoffe, dass n. einigermassen wohlbehalten zurückgekommen ist, ich habe ja schlimme sachen gehört, mal wieder. aber andererseits behauptete die ard auch etwas von 100.000 demonstrierenden, und das fand ich ziemlich beeindruckend.
natürlich habe ich es noch nicht geschafft, wieder etwas zu schreiben, obwohl ich es fest vor hatte, meine reise müsste auf alle fälle einen text wert sein – aber bisher war das wetter zu gut, und das meine ich wörtlich, denn in der hitze kann man wirklich nichts produktives tun, leider auch nichts für die uni, weder das referat mit der blöden referatsgruppe noch meine hausarbeit sind nennenswert vorangekommen.
Dafür wurde aber reichlich auf dem hof gegrillt *g* – und k.[Hund] wurde mit sehr viel aufmerksamkeit für meine abwesenheit entschädigt. zur zeit sind wir gerade dabei, die nebenwohnung zu okkupieren und durchbrüche durch alte berliner altbauwände zu machen, was bei dem wetter auch ziemlich blöd ist. und das alles nur, weil ich im sommer hochgeschätzte gäste aus wiesbaden erwarte…. :). aber auch dafür ist es eigentlich zu warm.
am montag war ich dann übrigens doch arbeiten, und morgen werde ich wohl auch dem kapitalismus meine dienste erweisen müssen, obwohl heute abend eine hof-geburtstagsparty des netten nachbarn ist. was für eine grausame welt. kann nicht jemand erwerbsarbeit gesetzlich verbieten?
so, bevor ich jetzt noch mehr schriftliche beweise dafür erbringe, dass mein gehirn inzwischen geschmolzen ist, höre ich lieber auf. vernichten sie diese nachricht nach dem lesen, sie ist nämlich eigentlich nicht existent.
grüsse alle anderen, vor allem l.[Hund].
bis zum nächsten mal, ich hoffe dann bin ich wieder etwas besser beieinander.
ciao
s.
ps. ich bin trotz aller widrigkeiten (wetter, möllis tod) dabei, das wort meckes (wie wird das eigentlich geschrieben?) hier einzuführen, allerdings stosse ich auf enormen widerstand – später mehr dazu….
Datum: [Juni 2003]
Betreff:
Hallo M.,
endlich habe ich mal wieder ein bisschen zeit gefunden, zufällig in einer ecke beim aufräumen, dir zu schreiben. also:
erst einmal noch eine entschuldigung für das mail-mißverständnis. ich hoffe, du hast das nicht wirklich ernst genommen, dass ich deine gastfreundschaft auskoste und dann eine komische mail schicke und mich dann nicht wieder melde. ich bin zwar ein vielleicht etwas komischer typ, aber doch nicht so! :- )
es freut mich, dass n. wohlbehalten angekommen ist, und ich hoffe, er ist inzwischen wieder genesen. viele grüße auf alle fälle an ihn, und wo wir gerade dabei sind, auch an u., a., m. und l.[Hund] nicht zu vergessen. sei mal ehrlich, was wurde denn so über mich getuschelt, als ich weg war? : )
es hat mir echt ganz gut gefallen bei euch (es war nett… *g*) & auf euerm dach. und sag u., wir können die lesung ja nachholen.
schön, dass dir das seyfried-buch gefallen hat, ich hoffe der geheimauftrag hat dich dazu gebacht, die ganzen witzigen kleinen details zu finden.
wer ist thomas meinecke? der name sagt mir irgendwas – kannst du das stilistisch einordnen? haben wir uns über ihn unterhalten? nein, oder? kurzzeitgedächtnis, wo bist du hin…
na ja, rave habe ich auch mal angefangen, ist doch von alexa h. von l., oder? hast du es weiter gelesen? habe ich irgendwann nicht mehr, lag aber daran, dass ich zu viele kritik und häme darüber gelesen habe. von wegen pop und ficken und pillenschmeissen und schluss.
wo wir beim thema sind: bücher. schreiben. bücher schreiben : )
im rahmen meiner arbeit habe ich ja auch dieses buch mit dem inhaltsverzeichnis hinten, so wie in russischen büchern hast du glaube ich gesagt, lesen müssen. ich bin inzwischen fertig damit (leider noch nicht mit der hausarbeit, aber vor drei stunden habe ich beschlossen, dass ab sofort rechercheschluss ist und ich mit der ausarbeitung anfangen sollte). und dieses buch mit namen „kaltland beat“ hg. von boris kerenski und sergiu stefanescu ist wirklich sehr sehr gut. wenn mich noch mal fragt „hausarbeit über social beat, wat is denn dat fürn scheiss“ dann kann ich sagen „hier, wenn es dich wirklich interessiert, dann lese das und du weißt so gut wie alles.“ meist gute texte von den protagonisten, halbwissenschaftliche (szene-interne) bis wissenschaftliche (z.b. von dem prof, bei dem ich die ha schreibe …) betrachtungen über das thema und untergrund-literatur im allgemeinen und sehr viele seiten –
lass dich nicht von dieser subjektiven beweihräucherung beeinflussen – lese es einfach selbst : )
du siehst, der aufenthalt in wiesbaden hat mir doch einiges gebracht. ich kann jetzt in meine künstlerbiographie schreiben „trat im berühmten cafe che in wiesbaden auf“. aber im ernst, das war schliesslich meine erste „auswärtslesung“. und das thema, über das ich gerade lese ist eigentlich auch ganz karriereförderlich, weil es lust macht, zu schreiben, doch da komme ich gerade deswegen nicht zu – paradox, was?
nun ja, und auch dein rat habe ich beherzigt – ich habe so ziemlich alle meine texte von der [Literatur-Website]-seite genommen, das hat ganz schön gedauert mit meinem blöden 56k-modem. und das werde ich auch mit meiner homepage tun. durch das vorbereiten auf das lesen in wiesbaden habe ich gemerkt, dass einige texte einfach noch nicht fertig geschält sind, so wie ein apfel – es muss einfach noch was weg. da bin ich begeistert von kerouacs stil des unmittelbaren schreibens und mache dann doch genau das gleiche wie er und verändere die texte doch im nachhinein…
übrigens, als ich meine texte bei der [Literatur-Website] gelöscht habe, merkte ich, dass erstens ein völlig falscher text von mir als „anthologie-text“ angegeben ist, und ich den zweitens nicht löschen kann – mafia *g*
doch durch mein mangelndes zeitvolumen bin ich sowieso nicht auf dem laufenden, was die [Literatur-Website] angeht. du hast es gut, du hattest pfingstferien! übrigens, fällt mir gerade ein, ich habe bei meinen recherchen auch einiges über dr. treznok gelesen, der scheint ja ziemlich aktiv zu sein und gibt wohl auch eine ganz geachtete literaturzeitschrift heraus. wenn du ihn kennst, frag ihn doch mal, was er von deinen texten hält, wenn es eine möglichkeit der veröffentlichung gäbe, dann bestimmt bei ihm. oder hast du das schon versucht?
zum thema wanddurchbruch: meine nachbar-wg zieht aus, und da habe ich mit meiner freundin überlegt, ob wir nicht einfach die wohnung noch dazu nehmen sollen, und nach viel hin – und herrechnen haben wir uns entschlossen, das zu tun, müsste knapp klappen vom geld her, und schließlich muss ich ja mein bild vom „komischen typen“ aufrecht erhalten – das ist eigentlich eine super yuppiemäßige geschichte, so eine große wohnung nur für zwei leute, aber eben unverschämt billig, du weißt ja, ofenheizung. und da haben wir halt schon einen durchbruch gemacht (obwohl wir noch keinen mietvertrag unterschrieben haben *g*) und sind fleißig am malern. die hälfte der wg, zwei typen, sind schon ausgezogen, in den dritten stock in unserem haus, und die andere hälfte, ein typ, der ins hinterhaus zieht, ist de facto noch da, also habe wir jetzt quasi eine große wg. aber unser neuer mitbewohner ist für zwei wochen nach frankfurt/ bei wiesbaden, gefahren, weil er da auch eigentlich herkommt, und arbeitet bei einem freund von ihm in einem second-hand-laden. deswegen haben wir einen neuen neuen mitbewohner, der ein freund von einer polen-wg aus dem hinterhaus ist und eigentlich in einem besetzten haus wohnt, was aber geräumt wurde. er spricht ein wenig deutsch und mag hunde. hat diese beschreibung die situation „durchbrochene wand“ für dich ein wenig aufgehellt? : )
übrigens, so groß meine künftige wohnung auch ist, ich würde nie auf die idee kommen, dort hornissen aufzunehmen. das geht in geschlossenen räumen und mit marmelade im kühlschrank nie gut!
der grund übrigens für mein langes nicht-antworten ist nicht nur die uni, sondern auch das festival, auf dem wir letztes wochenende waren. kurz zusammengefasst: nett. (du weißt, dass das bei mir so einiges heisst). und gerade richtig dosiert, nette bands und nicht zu lange, du weißt ja, ich bin alt, und vier oder fünf tage festival-müllberg-schlachten und dixiklos muss nicht mehr sein. drei tage aber waren völlig ok. könnte ich nächstes jahr wieder hin, vor allem weil es nur 85km von berlin weg war.
zu deinem religiösen erlebnis fällt mir weder ein reim noch eine erklärung ein, da bleibt mir nur den mund offen stehen und zu sagen: jooo, sowat kommt schon mal vor. ansonsten verbleibe ich mit freundlichen grüßen.
bis denne
s.
ps1. wenn ich in 2-3 wochen nicht über nennenswert neue texte bzw. wenigstens überarbeitete [Literatur-Website]-seiten verfüge, tritt mir doch bitte in den arsch!
ich bin zur zeit nämlich eigentlich voller tatendrang und schreibenslust, doch bisher konnte noch nichts umgesetzt werden.
ps2. was hälst du von dem künstlernamen „boleslaw beirut“? sollte ich punk-texte schreiben und unter diesem namen auftreten?
ps3. du siehst, ich verändere vielleicht meine texte im nachhinein, aber sie, frau m., werden trotzdem, wie sie sehen, weiterhin in den genuss nicht nachträglich manipulierter und deshalb verworrener mails kommen. viel vergnügen & gute nacht!
Datum: [Sommer 2003]
Betreff:
Hallo M.,
ich lebe noch, falls du dich das in der letzten zeit gefragt haben solltest. : ) Aber es ist viel passiert.
Aber auch deine mail hörte sich ja so an, als ob du viel zu tun hättest. unangekündigte klausuren gehören verboten!
Also, das baustellenleben hier ist so gut wie vorbei, ein grossteil der neuen wohnung gemalert & eingerichtet. Juhu! und morgen zieht a., unser derzeitiger mitbewohner, wohl aus. obwohl ich mir da noch nicht so sicher bin, gestern war nämlich das alljährliche hinterhaus-hoffest, was ziemlich geil war, und auch lange ging. mal schauen. eigentlich wollte ich dir schon vor einer woche schreiben, mit dem stolzen betreff: hausarbeit fertig! (ich hab sie dir übrigens hinten angehängt). na ja, aber dann kamen eben diverse handwerkliche tätigkeiten dazwischen, dann musste ich noch dreimal zur hausverwaltung laufen, um endlich den mietvertrag unterschreiben zu können, und dann haben wir auch noch entdeckt, dass unser guter volvo zum tüv muss. unser autoschrauber meinte, das wird teuer. und die uni will auch schon wieder 215 euro haben. ALLE WOLLEN NUR DAS EINE – mein geld. aber das kriegen sie nicht, denn ich habs ja auch nicht *g* dann wollte ich dir eigentlich vorgestern antworten, doch ein treffen mit dem mitbewohner a. verhinderte das. wir haben uns bis um drei uhr nachts über alles mögliche unterhalten, und als ich ihm von meiner schreiberei erzählte, wollte er was vorgelesen haben, und er hat auch was vorgelesen. ich gehe inzwischen offensiver damit um, „verstecke“ es nicht mehr so. na ja, aber du weißt ja, die meisten leute sagen als antwort auf „ich schreibe“ „ah ja“.
meine texte bei der [Literatur-Website] habe ich wie gesagt runtergenommen, um sie ein wenig zu überarbeiten, war doch dein vorschlag *g*[…]
jedenfalls hoffe ich, dass es dir jetzt besser geht, so langsam nahen die ferien ja auch. ich hoffe, dass ich dann weiterkomme mit meinen texten und auch vielleicht mal wieder ans vorlesen denken kann. ich habe schon ein paar texte fertig und werde demnächst wohl wieder was zu der [Literatur-Website] stellen und meine homepage neu gestalten. habe auch schon ein, zwei neue sachen geschrieben und noch einiges im kopf.
Gratulation übrigens zu dem absatz der […]-exemplare. was macht die kunst eigentlich bei dir? rumwandern in schweden hört sich gut an, aber auch nach vielen mücken, glaube ich. mir wird dieses jahr wohl nur eine woche an der ostsee bleiben, das wars. mal schauen, was berlin so zu bieten hat im sommer. daher müsste ich in der letzten septemberwoche auf alle fälle auch da sein und würde mich natürlich freuen, wenn ich mich für eure gastfreundschaft revanchieren könnte. Habt ihr irgendwelche besonderen vorstellungen, was ihr machen wollt?
Übrigens hörte sich deine mail so an, als ob du wenigstens dazu kommst, einiges zu lesen, das habe ich nicht geschafft, ich muss meine bücher erst mal neu sortieren, nach dem umlagern. und eine sache ist mir noch dazwischen gekommen: die nachbarn, die uns ihre wohnung überlassen haben und in den vierten gezogen sind, haben sich jetzt eine dsl-flatrate geholt, und da hängen neben uns inzwischen noch drei andere wohnungen dran. das bedeutet surfen ohne ende für nen zehner im monat oder so. doch ich computer-laiendarsteller brauchte erst mal zwei tage, bevor ich das netzwerk auf einen computer eingerichtet habe. jetzt warten noch zwei laptops darauf, mitverkabelt zu werden, und ehrlich gesagt denke ich, dass diese aufgabe meinen fähigkeiten übersteigt. aber andererseits „übung macht den meister“. jedenfalls ein weiterer umstand, der mir zeit rauben wird. aber vielleicht fange ich dann doch noch mit film- und musikdownload an, kannst mir ja dann nachhilfe geben. das gute daran ist aber auch, dass das homepage bauen und [Literatur-Website]-texte bearbeiten schneller geht, das ist cool.
Also, das soll es gewesen sein. viel spass beim lesen meiner arbeit und ehrliche kritik ist erbeten. : )
demnächst hoffentlich mehr unterhaltsameres von mir
bis dann
s.
ps: meine eine schule in der ddr hieß boleslaw bierut, das war wohl ein polnischer kpd-chef, und ich fand den namen ganz cool. man braucht halt bloss noch zwei buchstaben vertauschen.
Datum: [19. Juli 2003]
Betreff:
Hallo M.,
Gestern hatte nelson mandela 85. geburtstag, habe ich gelesen. Und dass er für mr bush nicht zu sprechen war, als dieser seine afrika-werbe-tour machte. Fand ich gut. Das nur kurz vorweg.
Danke für deine kritik an meiner hausarbeit. Nun ja, ich fand sie auch sehr essayistisch, aber irgendwie versuche ich immer, den stil auch ein wenig dem thema anzupassen. Diese umschreibung trifft es zwar nicht ganz genau, aber das war der grund, warum ich die arbeit so geschrieben habe. Naja, und es ist schließlich für ethno, da denke (und hoffe) ich, kann man so einen stil in der hausarbeit bringen. Obwohl ich mir nicht sicher bin, und die prof lässt sich auch ganz schön lange zeit mit dem durcharbeiten, langsam werde ich nervös :).
Zum Thema Kohleöfen:
Mama, der mann mit dem koks ist da. So hiess es früher auf den Straßen Berlins, und bis heute ist dieser brauch erhalten geblieben. Bloss dass mit dem koks nicht mehr geheizt wird, das wär auch zu teuer.
Heutzutage heizt man den Kohleofen mit Briketts, teilweise auch mit Schüttbriketts, das sind dann die billigen, kaputten Teile. Es gibt übrigens unterschiedliche Arten von Öfen, die auch in der Haltung und Pflege verschiedene Ansprüche stellen.
Zum einen wäre da der klassische Kachelofen, der bekannteste Vertreter seiner Gattung. Schon oft in Film und Fernsehen zu sehen gewesen, besonders in älteren Produktionen, eignet er sich für die Präsentation seiner Gattung vor allem dadurch, dass er über ein ansprechendes Äusseres verfügt. Auf einem meist quadratischem Grundriß erhebt sich circa 2m ein regelrechtes Kunstwerk der Kachel- und Ofensetzerkunst. Teilweise sind die Keramikziegel äusserst stilvoll gestaltet und mit Ornamenten verziert.
An der unteren Frontseite des Kachelofens befinden sich zwei Klappen, die Zugang zum Inneren verschaffen. Die obere Klappe dient zum Befüllen des Ofens, die untere zum Entnehmen der Asche. Kachelöfen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine angenehme, langanhaltende Wärme verbreiten. Ihr Inneres ist mit sogenannten Schamottsteinen verkleidet, welche sehr gut Wärme speichern können. Als Brennstoff eignen sich vor allem Briketts. Kachelöfen können auch größere Zimmer beheizen.
Ihr Nachteil ist allerdings, dass sie nicht schnell Wärme abgeben. Kommt man also beispielsweise nach einer woche skiurlaub in st. Moritz zurück in die heimische villa, dann dauert es circa 4-5 stunden, bis die bude eine annehmbare temperatur hat. Doch wenn der Ofen erst mal in Gang ist und durchschnittlich mit ca. 5 Briketts gefüllt ist, dann vergehen durchaus 5-6 stunden, bis man nachlegen muss. Das ist immer davon abhängig, ob der ofen auch dicht ist.
Um den Kachelofen über nacht in gang zu halten, kann man einerseits clever stapeln, so ungefähr 6-7 briketts reichen da vollkommen aus, oder man beherzigt die ratschläge der altvorderen.
Großmütter erzählen zum beispiel gerne, dass sie früher, als es an allem knapp war, die kohlen mit nassem zeitungspapier eingewickelt haben, um sie länger am glühen zu halten. Die Frage, die sich hier stellt, ist, woher es damals so viel zeitungspapier gab.
Eine andere Variante des Kohleofens ist der sogenannte Allesbrenner. Dieser ist nur circa einen meter hoch. Seine Aussenhülle ist nicht aus Kacheln, sondern aus Gußeisen. Seine Qualität ist die sehr schnelle Wärmeabgabe. Wie sein Name verrät, lässt er sich auch mit den vielfältigsten Brennstoffen befeuern, ideal sind allerdings die sogenannten eierkohlen. Sie unterstützen die extrem schnelle Wärmeverbreitung optimal.
Der Allesbrenner ist zwar von innen auch mit wärmespreichernden Material ausgestattet, erreicht aber lange nicht die leistung eines kachelofens. Große Räume sind für ihn ebenso ein Handicap wie längere pausen im nachfüllen. Länger als 3-4 stunden sollte man die geschehnisse innerhalb des allesbrenners nicht aus den augen lassen. Es sei denn, man hat ihn mit in nassen zetiungspapier eingewickelten briketts eingepackt, dann geht natürlich alles. Doch die Glut eines Allesbrenners übersteht selten die nacht.
Der Preis des Kohleofenheizens ist natürlich in erster linie unsere arme, verpestete Luft. Ansonsten entsprechen 25 € im Monat bei einer Heizperiode von ca. 4-5 monaten ja 100-125 €. Das ist ausreichend für ca. 1 tonne briketts, wenn man sie billig bekommt. Eine Tonne dürfte bei sparsamen heizen für zwei öfen (= 2zimmer) locker reichen. Kohlen kaufen sollte man übrigens im sommer und zusammen mit anderen, das bringt rabatte.
Bei der anlieferung der kohlen ist es in berlin inzwischen tradition geworden, die kohlenpacker genau zu beobachten und mitzuzählen, was sie einem da reinbringen. Es soll auch schon vorgekommen sein, dass einer der kohlenpacker das aus dem keller rausgetragen hat, was sein kollege reinbrachte.
Soviel zum thema kohlenöfen.
Herzlichen Glückwunsch zur Entdeckung des Sportsgeistes! Vor allem mit der Disziplin „Mit A. Sofas durch die Gegend schleppen“ kannst du dir gute Chancen zur Teilnahme an den olympischen Spielen 2043 in Castrop-Rauxel machen, würde ich sagen. Ich verzichte übrigens seit mindestens drei wochen auf meine unisport-tennisstunden. die handwerkliche betätigung in der erweiterten wohnung forderten ihren tribut. aber inzwischen sind wir so gut wie fertig. alle zimmer geweisst, möbel reingestellt, elektroleitungen verlegt, sachen gebaut, wasserhähne angeschraubt usw. jetzt steht nur noch als langzeitprojekt eine baderweiterung an. das muss allerdings noch warten, da wir inzwischen total pleite sind :-). aber glücklich. ich kenne weder einen meiner yuppie-bekannten, geschweige denn einen studenten, der so eine riesenwohnung zu zweit bewohnt. das ist echt dekadent, du wirst mich zu recht verachten ;- )
Naja, und zwischen all dem heimwerkern und auch anwachsender erwerbsätigkeit bleibt kaum mehr zeit zum freizeitsport. doch in einer woche fahren wir mit hund an die ostsee, meine mutter fährt für eine woche in den urlaub und wir besetzten so lange ihre wohnung. mein einziger urlaub dieses Jahr! nix mit in schweden wandern : ( .Aber auch bei euch scheinen sich ja dramatische ereignisse abzuspielen! ich wusste gleich, dass diese hornissensache ein böses ende nimmt *g*. das sind echt gefährliche viecher. hatte ich schon erwähnt, dass ich, als ich mal bei uns auf dem dach saß, beobachtete, wie dort in einen toten schornstein lauter bienen reinflogen? da ist im inneren unseres hauses inzwischen bestimmt der geheime mega-bienenstaat entstanden und bereitet sich darauf vor, die weltherrschaft zu übernehmen.
Entschuldige bitte, dass ich schon wieder so abschweife, aber daran ist das gute k2 schuld, und ein bisschen beaujolais. ich habe dieses wochenende das erste mal ein wenig zeit zu entspannen, und das tue ich grade auch. habe eine interessante ddr-biographie über hans fallada gelesen, ein paar texte von mir überarbeitet, die ich nachher noch ins netz stellen werde. Und auch, wenn du es genau wissen willst, einige zeit bei kazaa-lite verbracht *g*. Und ich habe vor einiger zeit einen text geschrieben. du wirst es nicht glauben, aber ist dadurch entstanden und auch sehr davon beeinflusst, dass ich mir auf 3sat 3 tage lang live die verleihung des ingeborg-bachmann-preises anschaute. ich hänge ihn dir an die mail ran. und bin auch gespannt auf deine texte, ichperspekektive ( – hey, das sieht so geschrieben nach einem coolen kraftwerk-revival-bandnamen aus, oder?) hin oder her.
allerdings habe ich diese kritik auch vernommen, und habe drüber nachgedacht. du hattest ja schon zu meinem letzten text bemerkt, dass er eine andere perspektive hätte, und der neue, soviel vorweg, ist auch nicht aus der ichperspektive. aber dann habe ich diese fallada-biographie gelesen, und in einer kritik an ihm (so um 1915-20) wurde hervorgehoben, dass er nicht wie seine literarischen zeitgenossen in der ichperspektive schreiben würde. das scheint also ein jahrzehntealtes thema in den feuilletons zu sein.
Generation Golf 2 habe ich noch nicht gelesen, werde ich aber bestimmt. auch weil ich gespannt bin, wie diese generation, zu der illies ja gehört, damit umgeht, dass sie tot ist. die popliteratur a la kracht (was macht der eigentlich?) und stuckrad-barre (und der?) scheint ja vorbei zu sein. und dieses generation golf 2 muss das ja irgendwie behandeln.
Ich finde jedenfalls, das beweist einmal mehr, dass man nicht irgendwie einem literarischen trend hinterherlaufen sollte, sondern das und so schreiben, wie man sich fühlt, wie man ist. vielleicht haben die popliteraten das ja sogar gemacht.
deine uni-erfahrungen tun mir leid. die heutigen stundenten sind echt ganz schön eingebildet, was handgeschriebene handouts und einiges andere betrifft. ehrlich gesagt zähle ich mich nicht mehr so sehr selbst als student wie ich es noch vor jahren tat. obwohl ich noch einige semester vor mir hab :- ). die lebensweise finde ich schon cool, aber viele dieser leute sind mir unangenehm. du weißt ja, früher war alles besser *g*.
Was euren Berlin-besuch angeht, auf den ich schon sehr gespannt bin, kann ich euch dsl-nutzern einen Tipp geben: schaut mal unter folgenden seiten nach: stressfaktor.squat.net – das ist DER terminkalender für die linke berliner szene. dort gibt es auch ganz viele links zu den einzelnen projekten und läden. dann vielleicht noch zitty.de, das ist die offizielle programmzeitschrift, die ursprünglich auch aus der linksalternativen ecke kam, wovon aber nicht mehr viel zu merken ist, und zum thema slam vielleicht noch spokenwordberlin.net (oder mit einem bindestrich irgendwo dazwischen), da gibt es auch noch ein paar weiterführende links. und ansonsten hast du natürlich vollkommen recht, was das chillen angeht. das sollte auch sehr gut möglich sein, wenn das wetter stimmt.
Bei mir kommen schon ab und zu leute vorbei, allerdings weiss ich nicht, ob sie erwarten, dass ich mich darüber freue. das tue ich aber dennoch meistens. und bei euch auf alle fälle.
soviel dazu, ich beende hiermit diesen brief und versuche noch ein paar sätze zu schreiben, in einem anderen word-dokument.
grüsse an alle anderen
s.
ps. wie hältst du es aus, eine so verworrene mail bis hierhin zu lesen? ;- )
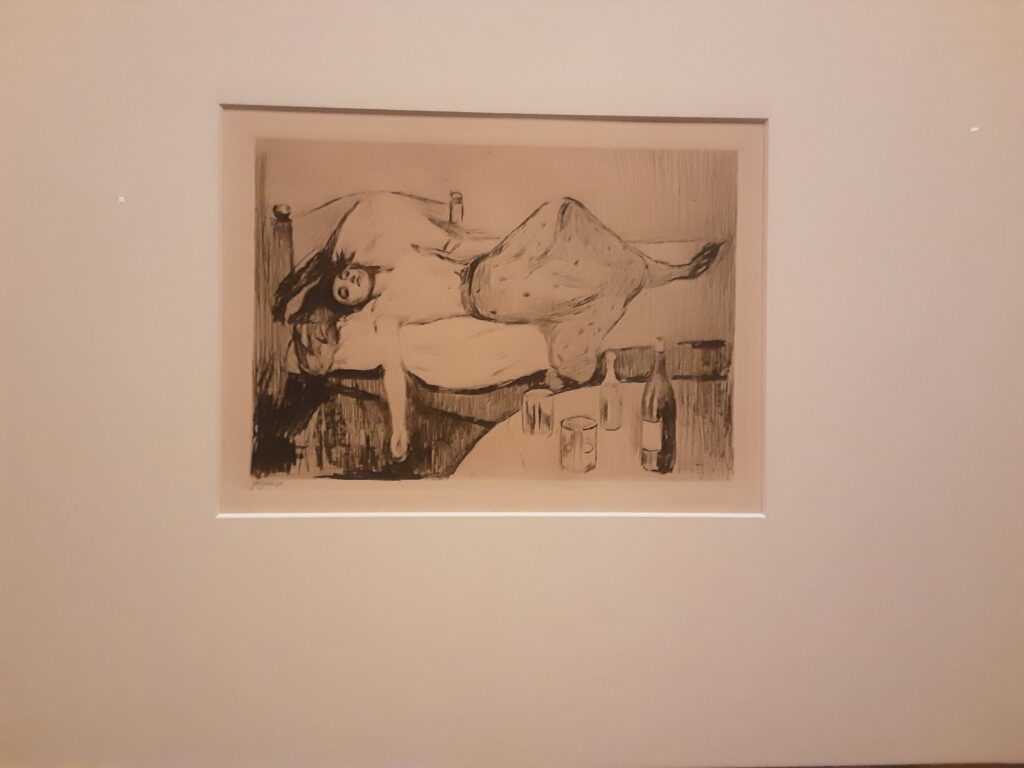
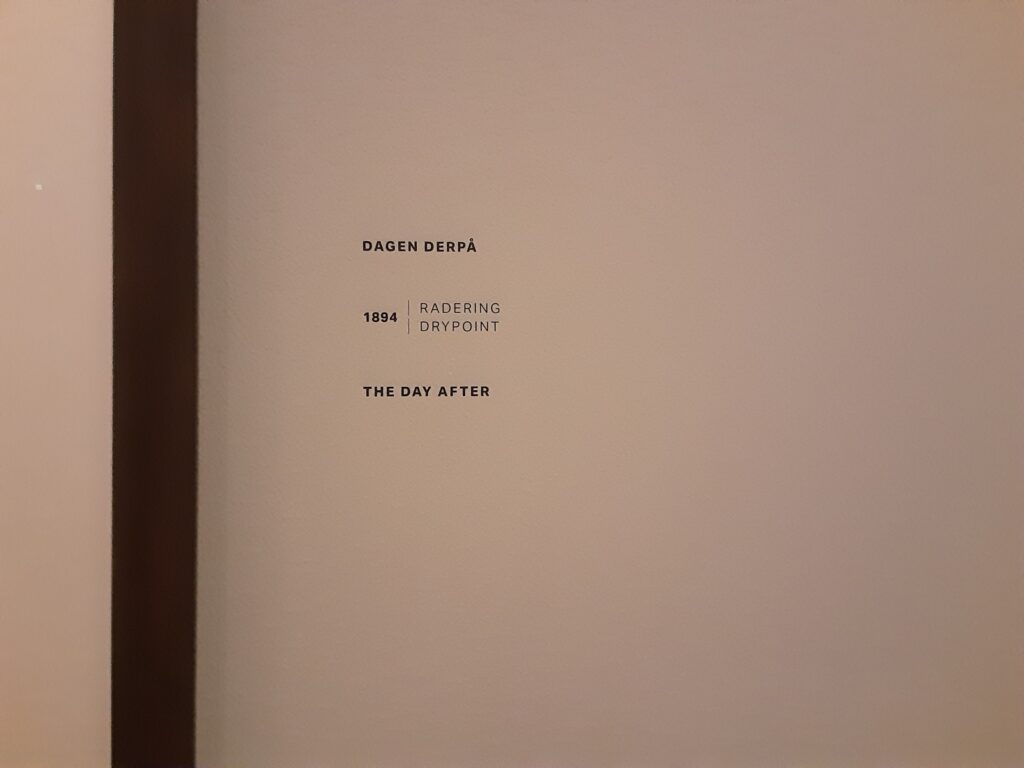


@ Munchmuseet + Vigelandsanlegget
(1.09.25)
Den Kindern und den Betrunkenen sagt man nach,
sie könnten unbescholten die Wahrheit sprechen.
Sie hätten einen Schutzengel,
wo sie so oft instabil auf den viel zu wenigen
zwei Beinen sind.
Und nur die Kinder und die Betrunkenen wissen,
dass die zweite auf Säule machende Strebe im Treppengeländer
mindestens so wackelig unterwegs ist,
wie sie selbst.
20.02.2024
Seit über einer Woche
habe ich einen vorzüglichen
Camenbert im Kühlschrank.
Begeistert entdeckt in der
Feinkostabteilung,
und voller Vorfreude
nach Hause getragen.
Dann war ich eine Weile
abgelenkt und habe
nicht mehr dran gedacht.
Und immer wenn ich mir
jetzt vornehme, ihn endlich mal
zu genießen, dann schrecke ich
ob des heftigen Gestanks
zurück, trotz des köstlich-zarten
Inneren.
Und traue mich nicht mehr ran.
Im Grunde genau so
wie es mir ganz allgemein
mit meinem Leben
auch so geht.
Über Inspiration, das Schreiben, das (Vor)Lesen, Bücher, Filme, Musik und den ganzen Rest: Von Kriegen und Frieden, und auch vom niemals zufrieden oder je ganz fertig genug sein. Kann Spuren von Drogen enthalten.
Ein einseitiger Briefroman in Fortsetzungen
(2002-2004)
(Zur Vorrede und Teil I hier entlang.)
Datum: [Mai 2003]
Betreff:
Hi M.,
danke für die schnelle antwort, hat mich sehr gefreut. Ich sitze gerade im büro und gehe der kapitalistischen verwertungslogik nach. Das sieht im moment so aus, dass mein chef im urlaub ist und ich hier den laden-hüter spiele. Nachdem alle arbeit getan ist, die ich für heute geplant habe, und ich schon ewig im netz gesurft bin, mir u.a. die neue [Literatur-Website]-seite angeschaut habe und 13 von circa 800 google-seiten zum thema social-beat gelesen habe, dachte ich mir, schreibe ich doch mal der m. eine antwort, sie hat`s verdient, die fleissige.
Um mein gehirn zu trainieren und dich an meinem leben teilhaben zu lassen, werde ich jetzt mal versuchen, meine letzten tage zu rekapitulieren. Wenn dich das nicht interessiert, überspringe einfach die nächsten absätze.
Am ersten mai war ich gewohnheitsgemäß nicht in kreuzberg. Ich habe mir das ein paar mal angeschaut, bin dann aber dazu übergegangen, ein straßenfest zu besuchen, welches von einer mir bekannten antifa-gruppe organisiert wird (bandito-clan). Letztens kam ein western im fernsehen, der im originaltitel „support your local sheriff“ hieß. Im rahmen meiner neuen tätigkeit als titel-erfinder fordere ich nun „support your local antifa“-bis zu einem gewissen grad und alter. Dort war es ziemlich lustig, erstaunlicherweise trocken (zumindest was den regen betrifft) und es gab mittelmäßige musik, bier und sehr leckere falafel. Da wir keinen bock hatten, ständig nach den hunden zu schauen und eine der sachen, die k.[Hund] relativ sicher beherrscht, das „nicht über die straße gehen“ ist, dachten wir uns, lass sie laufen.
Und sie lief und lief. Hundeparadies. Ab und zu habe ich sie an einem würstchenstand gesehen, und ab und zu kam sie auch mal vorbei um uns zu sagen, dass es ihr ganz gut geht. Interessanterweise stellte sich auch am nächsten tag keine magenverstimmung, auf die ich hunderte euro gesetzt hätte, ein. Deine ersten-mai-erfahrungen passen übrigens ins bild (aus wiesbaden kommen diese steinewerfer also immer *g*) ich hatte den eindruck, dass der erste mai relativ harmlos war im vergleich zu den jahren davor. Natürlich nicht für die, die festgenommen wurden, und je nach haarfarbe in bestimmten stadtgebieten wieder freigelassen wurden (ein freund von mir, mit einem kunstvoll aufgerichteten bunten Iro wurde mal nach einer demo mitten in der nacht in hohenschönhausen ausgesetzt, ost-plattenbauten, nazis usw.) es gab auch gefühlt weniger bullenpräsenz in der stadt, früher fuhren die ausländischen wannen immer schon eine woche vorher mit stadtplan durch kreuzberg, um sich zu orientieren (die bayern hatten natürlich in ihren heckfenstern blau-weiße fahnen). Und es sind immer die gleichen orte: mauerpark, rund um die o-strasse. Na ja, dann gab es noch eine sehr coole party von leuten aus meinem haus, die in einem kunstverein sind und gute kontakte zu einem hausverwalter haben. Der sagt ihnen bescheid, wenn ein haus zwecks sanierung leer ist, und dann haben sie zwei monate zeit, dort projekte zu machen. Der hauptact war am wochenende nach dem ersten mai, und die leute haben sich echt mühe gegeben. Jedes wohnung wurde von einem anderen team gestaltet, meist sah das so aus: großes zimmer party- und auftritts bzw. -legraum, kleines zimmer zum chillen, küche als bar. Aber da gab es je nach team eben auch andere präferenzen. Kombiniert wurde das ganze „hotel stundenglück“ mit ausstellungen, videoprojekten und einem bereich wo man sich zurückziehen konnte und stundenweise selbst die macht über die zimmer bekam. […]
Das dumme an der ganzen sache war nur, dass die veranstalter eine recht gute pressearbeit gemacht haben, um zehn, ankunftszeit, standen circa 150 menschen vor dem haus, zum glück war die strasse vorher abgesperrt. Die türsteher machten ihren job, sie standen die meiste zeit und ließen keinen rein. Das fand ich erst gut, als ich drin war und merkte, dass es draussen voller war. Im nachhinein eine gute entscheidung mit den türstehern, da man sich dadurch drinnen bewegen konnte.
Um halb drei, zeitpunkt des verlassens der party, standen circa 300 menschen auf der straße, und mindestens genauso viele kamen uns entgegen vom u-bahnhof. Das war übrigens das erste mal seit langer zeit (du erinnerst dich vielleicht an die „ich geh nicht weg“-phase, – sie wurde jäh unterbrochen, doch jetzt ist sie aufgrund verstärkter arbeitszeiten und der benötigten erholung wieder da), dass ich mal wieder „downtown prenzlberg“ war. Dort laufen in einer Samstag nacht wirklich unglaublich viele jugendliche rum, von nah und fern. Tja.
Als nächstes stand ein weiteres kicker-turnier an, in einem ziemlichen punkerschuppen, wo sehr gute freunde von mir, die die auch in meinem haus wohnen und k.s[Hund] großeltern sind, sozusagen, ihre jugend verbracht haben. Ein „selbstverwaltetes jungendzentrum“, das älteste berlins. Und ich bin vierter geworden, so weit war ich noch nie. So kanns kommen. Glück im los, sozusagen.
Dann kam der tag mit dem picknick, davon habe ich ja glaube ich schon erzählt, und vorgestern war ich auf einer sehr netten privaten geburtstagsparty, sehr laut, sehr viel bier & andere rauschmittel, und sehr viele schwule kölner, das geburtstagskind kam aus köln. Dazu dann noch ein paar französische juden und russische liedermacherinnen. Manchmal frage ich mich, in welchen katalogen sich bekannte von mir ihren freundeskreis aussuchen, das wirkt sehr erlesen. Zwischen dem Picknick und dem Kickerturnier kam irgendwann noch mal mein direkter nachbar vorbei und fragte, ob wir lust hätte zu grillen, natürlich hatten wir. Das entwickelte sich dann zu einer hinterhof-hausparty mit einer netten anekdote: wir heizen in berlin ja teilweise noch mit kohlen, und es gibt nicht nur briketts, sondern für sogenannte „allesbrenner“ auch sogenannte „eierkohlen“. Da die grill-idee eine spontane war, wurde beschlossen, mit diesen eierkohlen zu grillen. Das war keine gute idee, binnen minuten war der kleine enge hof blau, man hörte nach und nach energisches fensterzuklappen und murren. Dazu kam noch, dass es einen sehr eifrigen grillmeister gab, der die ganze zeit mit einer bierpalettenpappe das feuer wedelnder weise anfachte. Kennst du auch so typen, die mit wahrer begeisterung bei solchen party-aktivitäten aufgehen? Es fand sich dann auch recht schnell jemand, der noch fahren konnte und von der tanke holzkohle holte.
Dieses erlebnis brachte mich zu dem vorhaben, mehr über kohle rauszufinden. Bisher ist es nur ein vorhaben, aber diese steinkohle-braunkohle-holzkohle-eierkohle-brikett-Thematik ist glaube ich gut geeignet, um bei der nächsten party mit unnötigem Halbwissen leute zu langweilen. Nach dem picknicken habe ich mir übrigens noch mit einem freund mal wieder lammbock angeschaut, und während der film im hintergrund lief, haben wir uns, beide SEHR gut mit gras versorgt, mal darüber unterhalten, wie man sich selbst so sieht, wenn man bekifft ist. Laberflash, um nur ein thema anzuschneiden… Und jetzt sitze ich also im büro. Das gute daran ist, dass inzwischen das wetter auch nachgelassen hat, wobei es immer noch nicht wirklich geregnet hat. Das ist ein insider-gag hier, seit wochen werden im wetterbericht gewitter oder mindestens regenschauer angkündigt, aber die finden woanders statt.am rande habe ich gehört, dass es münchen wieder erwischt haben soll.
Jetzt aber mal zum ernsten teil: ich bekomme langsam ein wenig angst, was die ähnlichkeit deiner gedanken mit meinen betrifft. So geht das nicht weiter! Eine hausaufgabe für frau m.: be different. Diese hausaufgabe wird in zwei wochen kontrolliert. Denn ich glaube, ich werde mich nach wiesbaden/mainz aufmachen. Und da ich auch angst vor deinen kontakten zur russischen mafia und irgendwelchen mongolengangs, deren ideologie du scheinbar anhängst, habe, nehme ich dein angebot an :). Ich werde auch brav versuchen, mit tapeten und zimmerpflanzen zu assimilieren, um das biotop kleiststrasse nicht durcheinander zu bringen. Noch bin ich am überlegen, ob ich mich am mittwoch, 28. mai, aufmache, oder erst am Donnerstag. Für den Mittwoch würde sprechen, dass abends im rahmen der minpresmes im schlachthof ein slam ist! Und da mir jemand mal erzählte, dass man dort hingehen sollte….
Kommt natürlich auch darauf an, wie es dir passt, und bei dieser aussage verlange ich jenseits der gastfreundschaft auch ehrlichkeit. Den rückweg wollte ich dann am Sonntag antreten. Hätten wir also vier tage, wo wir uns anschweigen können, denn so viel, wie wir uns schon gesagt haben (60 seiten, nicht schlecht. Da hinterlassen wir den zukünftigen ambitionierten germanisten, die den legendären briefwechsel der in nur einem kleinen kreise bekannten aber dennoch genialen literatin m. editieren wollen, einen haufen arbeit. Weiter so! (ich wollte es ja nicht zugeben, aber auch ich hab`s aufgehoben) War hier eine klammer? : -)
Ich bin echt ziemlich gespannt auf diese begegnung. Der hund bleibt hier in berlin, ich bin ja nicht der einzige (hab mich eben voll verschrieben, und beim anblick der verschreibung fiel mir ein künstlernamen ein, den ich schon so lange gesucht habe: Der 1 ziege. Was hälst du davon?) erziehungsberechtigte dieses hundes. Wie du vielleicht aus schriftlichen äußerungen von mir schon entnehmen konntest, lebe ich in einer stinknormalen langzeitbeziehung, sogar mit zusammen wohnen und so.
Falls du da sein solltest, wenn ich komme, musst du mir erzählen, wie es kommt, dass die leute dich für ein sicherheitsrisiko halten (wer sich selbst zum sicherheitsrisiko für den jeweiligen staat erklärt hat angst vor dem sicherheitsrisiko m. – sei stolz! *g*).
Die sachen mit dem strebertum ist bei mir nicht ganz so ausgeprägt wie du vielleicht denkst, eigentlich reicht es mir meist auch, durchzukommen, aber wenn ich ein gutes gefühl bei einer sache habe, und das dann nicht in erfüllung geht, dann ist`s doof. Und wenn ich mir eine 2,0-hausarbeit aus meinem sagen wir mal vierten semester anschaue, dann finde ich schon, dass die arbeit, die ich jetzt geschrieben hatte, mehr verdient hätte. Aber eigentlich ist die aufregung darum auch schon lange vergessen, schnell kam die einsicht, dass man sich immer irgendwelchen subjektiven meinungen unterordnen muss, meist leider nur nicht den eigenen.
So, ich gehe jetzt nach hause. Ich hoffe der kuchen hat dir geschmeckt und dein wochenende war gut & erholsam. Wenn nicht, das nächste wochenende kommt bestimmt.
Bis bald
S.
Ps. Ist deine [Literatur-Website]-diskussion ein versteckter hinweis auf dein neues schreib-projekt?
Datum: [Mai 2003]
Betreff:
Hallo M.,
sorry, ich bin kein geheimverschwörungsfantiker-rekrutierer, der mit hilfe versteckter codes neue anhänger wirbt, deren eignung mit hilfe des lösens des codes geprüft wird. (das ist übrigens die standard-ablehnungsphrase für die bewerber, die es nicht geschafft haben *g*).
ich hatte die mail ja im büro geschrieben, und für dieses vergehen bin ich damit gestraft worden, dass die anführungszeichen – richtig geraten – in komische zahlenkombinationen umgewandelt wurden. Irgendwelche kompatibilitätsprobleme, vermute ich mal laienhaft. aber ich denke eigentlich, du müsstest bei solchen problemen bescheid wissen, schließlich kennst du geheime orte im internet, wo es anagramm-generatoren gibt. das finde ich ja supergut, ANAGRAMM-EDITOREN. gib mir mal einen tipp, wo ich die finden kann. was ich ja noch besser finde, sind die wörter, die von vorne und hinten gelesen das gleiche ergeben. und da sieht man, dass fernsehen bildet, es gab mal eine simpsons-folge, in der lisa in so einem streberclub ist… brauch ich dir wohl nicht weiter zu erzählen, kennst du bestimmt. ich sage nur: reliefpfeiler! ob es dafür auch generatoren im internet gibt?
zu meinen super-freizeitaktivitäten(langsam wird das übrigens ein wenig viel, aber jetzt komm ich da nicht wieder raus, morgen feiert eine freundin einweihungsparty, dann kommt ein freund aus hamburg vorbei…, späte rache): neeee, das war nicht alles an einem abend, obwohl man, und da hast du recht, das in berlin auch alles an einem abend machen könnte, rein theoretisch, aber dazu müsste der abend so circa 48 stunden lang sein, oder das klonen wäre billiger. andererseits aber hast du in berlin zwar sehr viele möglichkeiten, was zu tun, aber erstens hast du nicht die kohle, alles zu machen was du willst, und zweitens wird man auch ganz schön faul, oder ist es von vornherein schon. ich mache jetzt rein quantitativ auch nicht mehr, als ich in meiner kleinstadt-jugend gemacht habe.
Also, keine Angst, enttäuscht werde ich nicht sein, solange man nette gesellschaft hat, ist der abend gerettet. und außerdem habe ich ja auch noch zu tun, wenn’s gar nicht anders geht :). um auf deine frage zu kommen (jetzt komm ich wohl nicht mehr drum rum): wenn du den stress auf dich nehmen willst und alle anderen auch, dann würde ich schon lesen (hatte eine ziemlich lange pause, muss ich wohl jetzt anfangen zu üben). aber nur wegen mir brauchst du es echt nicht übers knie brechen, es ergibt sich bestimmt später auch noch mal was. keine hektik. falls es allerdings stattfinden soll, kannst du gerne irgendwelche präferenzen äußern, irgendeinen text, den du hören willst oder so. sag bescheid. Ich beglückwünsche dich zu deinem perfekten tag und gratuliere dir zur baumstammsurfen-meisterschaft. allerdings finde ich deine individualismusfeindlichkeit etwas zu schroff. *g*. manchmal gehen mir zu viele leute auch auf die nerven, aber ich weiss, was du meinst, wenn man selbst irgendwie verschwindet, ist das schon ein nettes gefühl. ich habe als kind irgendwann mal so ein propaganda-buch gelesen über den abwurf der atombombe über hiroshima, und in dem buch stand, dass die piloten, um nicht zu realisieren was sie tun, trainiert haben, an gar nichts zu denken. das fand ich damals irgendwie lustig und habe es auch versucht, sozusagen meditationsversuche verursacht durch sozialistische propaganda. das hätten die wohl auch nicht gedacht. als es das erste mal geklappt hat, fand ich war das sehr cool.
Du bekommst übrigens ein fleißbienchen für die vorbildlich gemachten hausaufgaben. und jetzt wird’s kniffliger, da fällt mir nämlich gerade ein film-zitat ein, mal schaun ob du es kennst: „willst du jetzt ein fleißkärtchen haben?“ ich bin gespannt.
übrigens, von wegen schräge leute kennen lernen: dieser eine typ, von dem ich im zusammenhang mit der party geredet habe, ist, wie mir die partyveranstalterin nach der party erzählte, ein filmproduzent, der in la sein office hat und u.a. triple x produziert hat (hab ich zwar nie gesehen, hört sich aber schon ziemlich protzig an). gestern waren die beiden mit sönke wortmann essen. sachen gibt’s…
ich denke, dass ich mich dann auch schon am mittwoch auf den weg machen werde. parkplatzprobleme sind allerdings eine dumme sache, vor allem mit einem volvo. ist in berlin aber generell auch so, hier ist nur das glück, das direkt vor meinem haus ja die hochbahn fährt, und da drunter kann man gut parken. allerdings wäre es schon gut zu wissen, ob es eine realistische chance gibt, irgendwo in der näheren umgebung zu parken, oder ob man erst drei stationen mit dem bus fahren muss. und ist es dann vielleicht sinnvoll, wenn ich mein fahrrad mitnehme? ich weiss ja nicht, wie man sich normalerweise in wiesbaden fortbewegt.
es gibt zwar keine eifersuchtsdramen hier, da mache ich mir keine sorgen, allerdings bekomme ich ein wenig angst, wenn ich mir die berufsqualifikationen deines freundes anhöre *g*. na ja, schaun mer mal.
also, bis bald
s.
ps. ein ziegenbart – nähäähää.
Datum: [Mai 2003]
Betreff:
Keine Begrüßung, direkter Einstieg: Ein schöner Text. Es wurde mir wieder bewusst, was ich an deinem Stil mag. Dieses leicht absurde, selbst bei sich klingeln und dann angst haben, dabei beobachtet zu werden: herrlich, weil es ja genauso ist. wenn man bei sich selbst klingelt, dann macht man anderen leuten, die einen dabei sehen, keinen vorwurf, wenn sie mal eben bei den herren mit den jacken, die zu lange ärmel haben, anrufen. wir leben in einer komischen welt, und sind selbst komisch.
übrigens, mal kurz vom thema abschweifend: als ich noch ziemlich neu in Berlin war, fragte mich jemand in der U-Bahn, ob „Bonnys Ranch“ schon vorbei war. Ich kombinierte ziemlich schnell, dass dieser Mensch eine Station meinte, und schaute auf den Plan, der in der Bahn hing. Ich fand aber beim besten Willen kein Station mit dem Namen „Bonnys Ranch“ und zuckte mit den Schultern. Dann blickte mich der Typ an und sagte „Na du bist wohl nicht von hier, wa?!“. Als ich dann die Karte näher betrachtete, wusste ich, was er meinte: die Dietrich-Bonhoeffer-Nervenklinik. Bonnys Ranch!
Aber weiter im Text, oder mit ihm: Auch das fiese-Bemerkungen-unter-dem-Tisch-austragen und diese Klingelgeschichte ist so WAHR – es ist ja nicht für einen persönlich, wenn dieser blöde Werbeprospektverteiler klingelt. Ich hoffe, dass diese Berufsgruppe auch unter die Kategorie „Postbote“ fällt und häufig von Hunden gebissen wird ; -)
Ein wirklich schöner Text mit einer Thematik, die mir sehr bekannt vorkommt, ich habe auch oft überlegt, diese Paranoia mal irgendwie zu verarbeiten. doch bevor wir zu den hausaufgaben kommen, wollte ich noch kurz abschließend zu dem wirklich guten text sagen, weiterschreiben wäre interessant, und meine favorite-formulierung ist: „niemals nicht“. Also, mein Zitat war aus Snatch. Kennst du bestimmt, oder? Aber „Draußen ist feindlich?“ Ehrlich gesagt, da fällt mir nichts ein. Ist aber auch schon spät. Also, auch ich habe verkackt. Es steht 1:1. Aber dafür hat mich das lesen deines Textes dazu bewegt, auch endlich mal wieder mit dem arsch hoch zu kommen und was zu schreiben. ich habe nämlichen ein wenig befürchtet, dass dieser kleine Schreibblockadenkobold wieder unter meinem Bett eingezogen ist. Und irgendwie wurde ich wohl auch angehext, denn zuerst kamen zwei komische Gedichte aus mir raus. Und so was mache ich ja nicht. Früher mal, klar, als man noch jung und naiv war. Aber das ist doch schon Jahre her. Würde ich auf Papier schreiben, hätte ich es zerknüllt.
Also habe ich mir verstört erst mal noch eine Tüte gebaut, ein paar alte Sachen von mir gelesen, deinen Text noch mal gelesen und mich noch mal hingesetzt. Es war nämlich echt komisch, ich hatte in letzter Zeit wirklich oft viele so kleine Ideen, aber fast nie was zu schreiben dabei, und dann habe ich auch selten das richtige Gefühl, nach dem Motto: Ja, jetzt könnte da was draus werden.
Naja, und dann kam, sogar durch einen kleinen Aufhänger aus deinem Text, eine winzige ans Licht gekrochen. Ich überleg mir noch, ob ich sie dir gleich schicke, mal schauen. Muss es mir selbst erst noch mal durchlesen.
Also, jetzt wird’s ernst. Texte aussuchen. Uiuiui, auf was hab ich mich da eingelassen – wiesbadener hardcorepublikum. was für einen dialekt spricht man dort eigentlich? ist man sauer, wenn über bestimmtes bier gelästert wird? verstehen die mich überhaupt? Mann, Mann, Mann (auch ein Filmzitat *g*). Aber ich werde versuchen, mein bestes zu geben, das muss allerdings nicht viel heißen :).
Gibt es einen Bierflaschen-Abwehrzaun so wie bei den Blues-Brothers? Oder strikten Pappbecher-Ausschank? Falls du noch für eine Anekdote Zeit hast:
Einmal, als ich in Roskilde war (dort bin ich in meiner Jugend fünf aufeinanderfolgende Jahre lang gewesen, Festivals, ach war das schön! und das beste: Ich werde dieses Jahr wieder auf ein Festival fahren. Mein letztes war 98. Und bei diesem Festival spielen auch Tomte. Kannte ich noch gar nicht, bis ich heute auf Fritz einen song von ihnen hörte. Respekt, Putzfrau M., da kann man auch mal seine Berufsehre zusammen mit dem Besen in die Ecke stellen, nachwuchs-tocotronic, und gar nicht schlecht, doch doch.) Abschweifen innerhalb einer Anekdote – entschuldige: also Roskilde-Festival, wir wollten um ein uhr (nachts) zum ministry-konzert. hatten noch zeit und kamen an der größten bühne vorbei. dort spielten- man glaubte es nicht, die sex pistols und versuchten ein comeback. und sie wurde wie wahre punks empfangen – mit bierflaschen. die alten herren zogen es dann vor, das konzert abzubrechen. so siehts mit den legenden aus. das nur kurz dazu. danke.
Drei Texte also gleich, okay, mal schauen. und dann erzählst du mir so nebenbei, dass ein 21jähriger berliner mich nachmacht und damit geld verdient! na ja, aber ich will ja auch gar kein pop sein, obwohl ich spiegel lese *g*.
übrigens, falls du einen bestimmten artikel suchst, sag bescheid, ich habe ein ganz ansehnliches archiv inzwischen…. Ich finde übrigens 11% ist doch schon ganz gut, obwohl ich echt nicht verstehe, wie eine roland-koch-cdu überhaupt noch stimmen bekommen kann, das ist doch echt traurig. wie kommt der überhaupt nach amerika? hihi, das war aber schon eine coole aktion. na ja, bei uns gibt es auch immer so lustige spassparteien fürs landesparlament: Zum beispiel KPD/RZ – Kreuzberger Patriotische Demokraten/Realistisches Zentrum, oder FAZ, als Gegenpartei zur KPD/RZ gegründet, weil Kreuzberg und Friedrichshain zusammengelegt wurden. FAZ heißt Friedrichshainer Amorphe Zentralisten. Die bekommen dann immer so zwei bis vier Prozent oder so, und als sie einmal unverhofft gewählt wurden, sind sofort alle zurückgetreten und haben von der Kohle ne Party geschmissen.
Du hast absolut recht, was die [Literatur-Website] und die nicht vorhandene Werbung betrifft. und auch so finde ich die umgestaltung auch gar nicht schlecht. ich bin ja auch schon ein wenig gespannt, was die neue anthologie so bringt. So, jetzt habe ich meinen neuen text noch mal gelesen, und da die straßenlaternen gerade ausgehen und die vögel anfangen zu singen, ist mein zustand so weit fortgeschritten, dass ich dir diesen text mit ranhänge. allerdings ohne jegliche gewähr, ich selbst find ihn irgendwie – na ja.
ich wünsche einen schönen tag, und stelle fest, in einer woche können wir all die fragen, die in den mails untergegangen sind, mal bei einem bier, oder whatever, klären. das stimmt mich froh.
bis demnächst
s.
ps. grüße an all die anderen, schließlich muss ich mich ja langsam beliebt machen 🙂
Datum: [Mai 2003]
Betreff:
Guten Abend Frau M.,
ich werde mich bemühen, den zeitpunkt des absendens dieser e-mail so zu wählen, dass man den inhalt noch für glaubwürdig befinden kann.
du siehst, ich bin schon wieder ganz schön spät dran – und schräg drauf. aber man soll es sich ja gut gehen lassen, und das tue ich dann auch. Eigentlich wollte ich schon spätestens vor zwei stunden eine antwort an dich verfasst haben, weil du willst ja auch wahrscheinlich langsam wissen, was sache ist. aber mich haben noch – achtung, tv-junkie-bekenntnis – zwei sendungen aufgehalten, schlimmerweise im musikfernsehen. aber so schlimm war es dann doch nicht, weil es schon relativ spät war, und je später die uhr, desto besser die sendungen. in der einen ging es um deutschpop – grausiger titel, meinte aber so sachen wie tocotronic und rocko schamoni und wurde von charlotte roche präsentiert, die ich für ziemlich fähig halte.
die zweite sendung beschäftigte sich in diversen interviews und musikvideos mit der scheinbar zur zeit unheimlich hippen underground-mainstream-band the white stripes. deshalb kann man die halb zurückgelehnte schreck-haltung, die man einnehmen würde, wenn jemand sagen würde, ich habe zwei stunden mtv und viva geschaut, aufgeben, oder? (natürlich gingen auch diverse musikvertiefende substanzen über in die blutbahn – daher bitte ein wenig verständnis für die verwirrten gedanken)
also, zur sache: unglaublich aber wahr, ich habe gestern in der bahn einen mitarbeiter der chinesischen botschaft getroffen, und der hat mich mit sars angesteckt, jetzt kann ich leider nicht kommen und kann an deiner lesung nicht teilnehmen. schade.
neenee, keine angst, du hast mich genug eingeschüchtert, ich bin dabei! und inzwischen habe ich auch fast all meine reisevorbereitungen getroffen, so dass ich ziemlich genau auskunft geben kann, hoffe ich: ich dachte, dass ich am mittwoch so am frühen abend, späten Nachmittag, such dir was aus, ankommen wollen würde, damit man noch genug zeit hat, bevor man irgendwo hingeht, zum slam oder so. also so circa fünf. man kann das ja nicht wirklich planen. und ich dachte auch bis vor kurzem, dass die entfernung berlin-frankfurt (tschuldigung, wiesbaden *g*) um die achthundert kilometer sein würde. dont ask me why. jetzt sagte mir ein schlauer internet-routenplaner, dass es nur knapp sechshundert kilometer sind, und davon über 90 prozent autobahn. also denke ich, dass ich nicht mehr als fünf-sechs stunden brauche, daher werde ich hier so um 12 losfahren. vielleicht verschätze ich mich ja auch total und gerate in eine dieser sagenhaften ferienreisekolonnen und brauche 23 stunden. mein plan aber ist, so zwischen fünf und sechs in der kleiststrasse in wiesbaden verzweifelt einen parkplatz zu suchen. meinst du es ist angesichts des geballten wissens eines internet-routenplaners und diverser stadtplandienste so kompliziert, die kleiststrasse zu finden, dass wir uns irgendwo treffen müssen? ich glaube, ich versuche meinen indianerinstinkt aus der kindheit wieder zu finden und auf den richtigen pfad zu kommen.
schwieriger wird es da schon mit dem erkennen, da hast du recht. aber du weißt ja ungefähr wie ich aussehe, und ein klingelschild wird mir ja auch erst mal weiterhelfen. allerdings kannst du mich ja auch total verarschen und ein kind aus der nachbarschaft dafür bezahlen, dass es sich eine tulpe ins knopfloch steckt und vorgibt, m. zu sein. aber so fies bist du glaube ich nicht.
ich bin jedenfalls gespannt aufs bezupfen und in die taschen gucken, und du kannst deinen leuten ja einfach sagen, dass du einen armen bekannten aus der ostzone kurzzeitig aufnimmst, das kam früher in der gegend glaube ich ganz gut, wie es jetzt ist, weiss ich nicht :-).
du siehst, ich bin gut gewappnet und reisefertig – dat klappt schon. allerdings bin ich noch nicht schlüssig, welchen text ich nehme, vielleicht den […], den ich dann in drei teile teile oder so. oder ich schreib noch was – es fließt gerade wieder, glücklicherweise. aber ich hab ja alles dabei, laptop und so. und der feiertag ist natürlich auch sehr gut, wenn das wetter dann noch stimmt, könnte das ein netter tag werden. na ja, alles weitere kann man dann ja vor ort bequatschen, was so generell an dem wochenende geht usw.
dein text für die lesung ist echt lustig, sehr gut! und danke für das lob, ich war über den perspektivenwechsel auch ein wenig überrascht, aber es ging ja irgendwie, war halt ein komischer abend, erst das mit den gedichten…. natürlich haben die sich nicht gereimt, das wäre ja noch schöner 🙂
so, dass war es erst mal, schließlich muss ich das zeitlimit ja einhalten…
bis übermorgen
s.
ps. wenn du übrigens meinst ich sollte meinen plan, was die zeit oder irgendwas anderes betrifft ( z.B. so vorwitzig sein und die kleiststrasse alleine suchen) ändern, dann sag es mir.
Über Inspiration, das Schreiben, das (Vor)Lesen, Bücher, Filme, Musik und den ganzen Rest: Von Kriegen und Frieden, und auch vom niemals zufrieden oder je ganz fertig genug sein. Kann Spuren von Drogen enthalten.
Ein einseitiger Briefroman in Fortsetzungen
(2002-2004)
(Zur Vorrede und Teil I hier entlang.)
Datum: [Ende April/Anfang Mai 2003]
Betreff:
Hallo M.,
ja, auch hier war frühling und er wurde sehr genossen, inklusive frühstück auf dem dach. allerdings macht der lenz gerade eine pause, so dass ich dazu komme, dir zu antworten…
[…] schön dass du nicht nur von mir zuspruch gefunden hast und auch andere deinen roman gut finden. wie kamst du darauf, dass er egozentrisch wirken könnte? mutig fand ich allerdings, dass du ihn zu der [Literatur-Website] gestellt hast, da er doch schon ziemlich lang ist. aber vielleicht liest es ja doch jemand, lohnen würde es sich ja auf alle fälle.
hier hat vor vier oder fünf tagen mein versuch geendet, deine mail zu beantworten.
inzwischen ist wiesbaden ja für diverse sachen bundesweit berühmt geworden. da reicht es wohl nicht mehr, barfuß durch die stadt zu laufen…*g*
jetzt hat das semester wieder voll angefangen, und damit rumsitzen mit hundert leuten in einem raum für fünfzig. aber ich glaube jetzt auch wieder an vorsehung: ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen, dieses semester wieder große schritte in richtung ende zu machen, hatte mir relativ viele veranstaltungen ausgesucht (das bedeutet bei mir 6).
jetzt, wie auch fast jedes semester, habe ich festgestellt, dass zwei davon ersatzlos gestrichen sind und eins so verlegt wurde, dass ich nicht mehr hingehen kann… also sehe ich das als zeichen, mache nur noch drei veranstaltungen und genieße den sommer… der ja inzwischen scheinbar wirklich einzug gehalten hat. achso, hatte ich ganz vergessen zu sagen: frohe ostern! bist du ein familienmensch, so mit gemeinsamen eiersuchen und so? ich komme gerade vom dach, das blöde daran ist, da kann ich den hund nicht mitnehmen, und den laptop hatte ich auch noch nicht mit oben, sollte ich vielleicht mal probieren. und kaum sind die ersten warmen sonnenstrahlen da, ist der krieg zu ende und die leute wieder allesamt freundlich. komisch oder?
was macht die wiesbadener bürgermeisterwahl? und dein lese-projekt? deine ferien sind jetzt wahrscheinlich auch rum, oder? wie sieht dein zeitplan denn jetzt aus, viel zu tun?
ich habe am karfreitag um zwei uhr nachts meine hausarbeit beendet, juhu, ich habs geschafft. Falls du etwas zur (bis zu dieser revolutionären hausarbeit) unterschätzten rolle des adels im mittelalterlichen stralsund wissen willst, frag mich. ich hätte aber auch nichts dagegen, mich mal mit einem anderen thema zu beschäftigen. muss ich ja auch noch, meine slam-poetry arbeitet wartet noch, thema wird wahrscheinlich „was war social beat“ oder so. aber da habe ich gerade eine fristverlängerung bis ende juni rausgeholt, bis dahin habe ich schon wieder zwei andere referate auf dem plan…
und da kommst du ins spiel: die begründung für die fristverlängerung war, dass ich noch ein porträt der jungautorin M. einbauen will, dafür müsste ich für recherchearbeiten nach wiesbaden kommen, hättest du ende mai noch eine matratze frei? : -) nee, mal ohne spass, das ist schon eine ernste frage: ich will vielleicht wirklich zu recherchezwecken zu der minipressenmesse, vorher muss ich noch mal das programm genau checken, ob die reise sich auch überhaupt lohnen würde, aber ich habe gehört, dass wiesbaden nicht weit weg von mainz ist. allerdings kenne ich dort nicht wirklich viele leute (bisher kein großer verlust, aber irgendwann rächt sich so was halt…). also wenn du irgendwelche näheren geografischen informationen über das verhältnis mainz-wiesbaden und die dortige situation der übernachtungsmöglichkeiten hast, lass es mich wissen.
dann kann ich mir ja auch mal vor ort den haufen der berlinreisewilligen anschauen und im auftrag der zonenverwaltung feststellen, ob ihr überhaupt einreisetauglich seid…
bis denne, ich muss jetzt zu einem kickerturnier…
und habe schon seit wochen nichts mehr geschrieben, das ist ärgerlich, ich muss mir noch ein paar persönlichkeiten abspalten, um alles zu erledigen. vielleicht hast du durch deine verbindungen zur unterwelt ja einen Tipp, auf welchem markt man die kaufen kann
fröhlichen sommer noch
s.
Datum: [Mai 2003]
Betreff:
Guten Abend Frau M.!
Um ihre Frage zu beantworten, der oft unterschätzte Adel bestand natürlich aus Minne-Freaks. Der letzte Rügensche Fürst zum Beispiel war selbst Minnesänger, und er lernte sein Handwerk bei einem bürgerlichen Musiklehrer.
Soviel dazu :-). Nächste Woche kann ich mir den Schein abholen, und dann habe ich das Thema erst mal hinter mir gelassen, zum Glück!
Was machen deine Studien-pläne? hast du die 18 SWS zusammen? (Bist du wahnsinnig?! Es ist Sommer! *g*)
Deine Anpreisungen des Rheinlands haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Ich kenne selbst die schönsten Frauenbeine immer nur vom stampfen des Sauerkrautes, Wein wächst hier glaube ich nicht…
Meinst du ich könnte die Lücke füllen, die Moke hinterlassen wird? Meinst du, dass ich mein Image aufrecht erhalten kann, und du deins, falls ich dein Angebot annehme? Ich weiss ja nicht…
Aber im ernst, es ist echt schade, dass sich in Deutschland noch kein flächendeckendes Backpacker-System durchgesetzt hat. in Berlin gibt es jetzt glaube ich so was, in Hamburg auch, aber das wars dann glaube ich. Weil, Jugendherbergen sind ja nun wirklich mit so vielen schlechten Erinnerungen behaftet, dass man sich da nicht freiwillig hinbegibt, und Hotels sind meistens schon zu teuer. Dazwischen gibt es nix vernünftiges. Vielleicht wäre die Minipressemesse ja auch was für dein Vorhaben mit […]. Schließlich ist das angeblich der Ort, wo sich kleine Verlage und zeitschriften präsentieren. So heißt es jedenfalls. Wie gesagt, ich muss mir das programm noch mal anschauen. Hast du davon denn schon mal was gehört, ist ja schließlich mehr oder weniger bei dir um die Ecke, oder?
Die Sache mit dem Test für die Berlinreisewilligen muss ich mir noch mal genau überlegen, die Ausarbeitung werde ich dir zukommen lassen, inklusive lösungsbogen :-). Es gibt echt viele Tests zu jedem Scheiss, oder? Ich glaube ich werde Test-Tester, muss es ja geben, so was.
Ich bin gespannt, was die [Literatur-Website] in den nächsten Tagen/Wochen so macht, von wegen Anthologie und so. Allerdings bin ich eher zurückhaltend gespannt, denn ich habe den verdacht, dass die Bande etwas überfordert oder lustlos ist, ich habe ja auch schon eine weile nichts mehr hochgeladen. selbst die nwo ist inzwischen recht still geworden, habe ich den eindruck. aber solange es nichts besseres gibt, muss man halt damit vorlieb nehmen, nicht wahr? Es ist eben jetzt kein besonders kleiner kreis mehr, in dem man gut diskutieren kann. aber was erzähle ich das dir, du bist ja die alte [Literatur-Website]-häsin, schließlich schon viel länger dabei als ich. war es früher eigentlich besser? war früher nicht alles besser?
Hast du schon mitstreiter für deinen leseabend gefunden? wie geht’s dir sonst so? was macht der krieg, der frieden, das leben, freunde, feinde? Wieso isst du keine eier, wenn du lamm isst, kann es ja wohl kaum am vegetarismus liegen, oder stosse ich da jetzt bei dir auf die schrecklichen geheimnisse?
dein verdacht bei mir war fast richtig, ich schreibe nicht oft über mich, weil ich meine schrecklichen geheimnisse sammeln werde und dann später irgendwann zusammen veröffentlichen. so habe ich mir das vorgestellt.
Hier ein kleiner Filmtipp für die PoWi-Studentin: Herr Wichmann von der CDU. Eigentlich ein trauriger film, denn er erzählt die wahrheit. über wahlkämpfe und kandidaten. ist von andreas dresen, den man fast uneingeschränkt empfehlen kann, zumindest aber halbe treppe, nachtgestalten und mein favorite: raus aus der haut.
bei mir gabs ostern auch eine überraschung, die ähnlich ist wie deine einkaufserfahrung. pünktlich zum abend des donnerstags stellte sich meine pollenallergie ein (zum glück richtet die sich nicht gegen die wirklich wichtigen pollen …). das hieß, dass ich bis dienstag warten musste, um mir beim arzt, wo es natürlich supervoll war, ein dämliches rezept abzuholen. also sah ich das ganze wochenende aus, als hätte ich versucht, mir die birne wegzukiffen, leider sah ich nur so aus, rote osterhasenaugen.
jemand, der das wirklich versucht hat, schleppte mich auch letzten dienstag in meine lieblingslokalität (bandito rosso), angeblich wäre da ein kickerturnier. allerdings hat sich sein kurzzeitgedächtnis selbst mit seinem langzeitgedächtnis verwechselt, denn es ist erst heute, also die gleiche verabschiedung, ich muss jetzt kickern gehen. Ansonsten bin ich optimistisch, in nächster zeit wieder was zu schreiben, das muss jetzt mal wieder sein. lass es dir gut gehen, und auch den anderen.
bis bald
s.
ps. habe gerade in einer fußnote gelesen, dass es einen aufsatz gibt (medien-powi-seminar), der heißt „the future does not exist, forecasters try to invent it“ – finde ich einen guten titel. es gibt zu wenig gute titel, siehe die deutschen titel für kerouac-romane. ich lese gerade „the subterraneans“ zu deutsch be-bop, bars und weißes pulver. na ja. vielleicht werde ich ja anstatt test-tester titel-erfinder. ma gucken.
Datum: [ Mai 2003]
Betreff:
Hallo M.,
erstens: vielen dank für deine mail. und das ist keineswegs eine floskel, die sich vielleicht auch schon in unsere konversation eingeschlichen haben könnte, nein, ich meine das so: vielen dank für deine mail.
ich hatte heute einen sehr perfekten tag, eigentlich. und schon eine ganze weile eine ganz nette zeit, davon später vielleicht mehr, aber heute bin ich mit freunden, die auch in meinem haus wohnen und die die mutter von k.[Hund] besitzen (schreckliches wort für diesen umstand…), morgens um 12 auf den kreuzberg gegangen (ein park auf dem namensgebenden berg), picknicken, dann hab ich mich mit einem anderen freund getroffen, wir wollten eigentlich alte ärzte-platten versuchen auf cd zu bekommen, da wir aber ziemlich früh merkten, dass uns die nötige software fehlte, haben wir uns auf den balkon gesetzt und eine tüte nach der anderen in der sonne geraucht, und jetzt wollte ich gerade wieder zu meinen nachbarn gehen und weiter einen schönen abend haben, dachte mir ich schau mal nach meinen mails und dann merke ich, dass der tag wirklich ein guter ist (das ist schon ein wenig übertrieben, stimmt aber doch irgendwie), weil deine mail, was du geschrieben hast, passt so richtig gut zu meiner gesamtstimmmung.
Du hast absolut recht. natürlich erwartet man es irgendwann, dass seminare nicht stattfinden, aber man ärgert sich trotzdem, vor allem weil man eben bis zum ersten semester-tag davon ausgehen muss, dass das alles stimmt was im kvv steht, obwohl man genau weiss, dass es nicht stimmt. […]
und auch über deine andere klage habe ich mich sehr gefreut, weil so ging es mir auch, genau so. ich habe mir den blöden schein abgeholt, für meine arbeit (du merkst vielleicht schon die negativen schwingungen…) eine zweikommanull. ist ja auf den ersten blick nicht schlecht, ich will mich auch nicht beklagen, aber ich habe im gesamten geschichte grundstudium und auf meinen ersten hauptseminarsschein jeweils eine 2,0 bekommen. dann habe ich ausgesetzt, ein jahr oder so, einen politikschein gemacht, mit 1,0, der wie ich dachte auch recht anspruchsvoll war, und hatte mir jetzt zum ziel gesetzt, die arbeit besser als 2,0 zu machen. hört sich wahrscheinlich ziemlich streberhaft an, aber ich sah das eher als bestätigung, dass es sich gelohnt hat, weiterzustudieren, und die pause nicht auf ewig auszudehnen. das hat mir der politikschein suggeriert, und paradoxerweise meinte die professorin auch (sie ist auf alle fälle anspruchsvoll – das bestätigt die durchfallrate, es gab echt einige leute, die keinen schein bekommen haben, das kommt hier inzwischen recht selten vor), dass ich ja gar nicht so schlecht wäre, das problem bloss meine sprache wäre, die zu „publizistisch“ wäre. was dem politikprof gefiel. lerne: zwei verschiedene fächer an ein und derselben uni können galaxien entfernt sein. entschuldige meine abschweifung.
Doch ich wollte nur unterstreichen, dass du recht hast, die uni ist eine komische veranstaltung. eben auch mit den profs, aber auch wie du sagst mit den anderen leuten. sicherlich, dadurch dass ich beim asta gearbeitet habe, hatte und habe ich viele kontakte (der streik, dass war auch ein riesen-sozialisiationsbeschleuniger), aber ich bin raus. ich hatte ausgsetzt mit der uni, ich war einige zeit nicht da, und in diesem universum ändert es sich rasant. es gibt kaum mehr jemanden im asta oder im selbstverwalteten cafe, den ich noch aus meiner aktiven zeit kenne.
ich bin ein studi wie jeder andere und ehrlich gesagt auch ziemlich menschenscheu geworden. ich kenne genug leute, ich muss niemanden mehr an der uni kennenlernen. damit will ich nicht sagen, dass die, die das machen, doof wären, es ist nur so: ich habe es hinter mir. ich finde seminargruppentreffen inzwischen recht schrecklich, meist. es gibt natürlich immer ausnahmen.
andererseits finde ich es auch gut, dass es inzwischen aus aktuellem politischen anlass wieder ansätze einer aktiven studischaft gibt (berlin ist megapleite und der ruf nach studigebühren wird wieder laut). Diesmal stehe ich allerdings aussen, bei der letzten derartigen auseinandersetzung war ich mitten drin. verhandlungen mit blöden cdu-senatoren.
das lustige ist: der jetzige senator (pds) ist der onkel eines meiner besten freunde und relativ cool drauf, ich könnte mir auch kaum vorstellen, mit dem verhandlungen führen zu müssen. soviel nur dazu, ich schweife schon wieder ab, aber mein schreibstil, wie ich herausgefunden habe, ähnelt dem, der kerouac zugeschrieben wird: dicht sein und drauf los schreiben – ich beschäftige mich gerade zwangsläufig mit literaturtheorie der jüngeren vergangenheit, sehr interessant.
also, zusammengefasst: ich find es ganz gut, dass scheinbar wieder vermehrt leute politisch aktiv werden (übrigens, die rigaer wurde gestern geräumt), und würde auch gerne als alter aktivist gute und weise ratschläge geben, wurde bloss bisher nicht gefragt *g*.sonst halte mich mich der uni fern.
manchmal beneide ich auch die freundlichkeits-überschäumer. doch meist belächele ich sie (psychologischer schutzmechanismus – ich denke, sie sind nur oberflächlich freundlich, haben keine richtigen freunde, oder so).
Ja, ich verlaufe mich noch in berlin. ich wohne jetzt seit sechs jahren hier. früher bin ich manchmal ziemlich verpeilt mitten in der nacht aus dem bandito zu meiner freundin, die in moabit wohnte, mit dem rad gefahren, da musste ich durch den tiergarten, und hab mich dort dann verfahren, was sehr schön ist, wenn der morgennebel gerade sprichwörtlich über dem rasen aufsteigt. und zur orientierung kann man in notsituationen die siegessäule heranziehen, doch manchmal, wenn man sie dann wieder sieht, fragt man sich: wie bin ich denn jetzt hier her gekommen?
und auch sonst, berlin ist schon ziemlich gross, so dass du an ecken, die du nicht kennst, schon einen stadtplan brauchst. aber das ist ziemlich normal, die urberliner allerdings tun dies nicht, weil sie sich einfach nicht an ecken aufhalten, die sie nicht kennen.
Was deine befürchtungen unserer begegnung angeht: ich gebe zu, auch ich bin gespannt, obwohl du ja eigentlich im spannungs-nachteil bist, schließlich hast du ja wenigstens schon mal einen kleinen eindruck von mir gewinnen können: ich allerdings spekuliere jetzt über siamesische zwillinge (handpuppen oder vögel auf der schulter) a la south-park und bin sehr gespannt. doch du hast recht, ich denke wir brauchen uns da keine allzu großen sorgen machen.
ich fänds natürlich schon cool, wenn wir uns treffen könnten, das mit der übernachtung ist auch immer noch prioritär bei mir, obwohl ich auch gerade eine liste mit privaten übernachtungsmöglichkeiten in und um mainz gefunden habe, so ab 25€ pro nacht, das ist zwar auch nicht billig, aber besser als hotel, und wir hätten sozusagen keine zwangssituation, ich will ja auch ein wenig arbeiten, und dabei störe ich ungern jemanden, falls du weißt, was ich meine, das ist jetzt nicht negativ gegen dein angebot oder so, vielleicht kann ich mir ja das auch gar nicht leisten und ich hab nur dein angebot oder den großen innenraum des volvos… muss ich mal genau ausrechnen, und auch mal diese angebote auschecken, also anrufen, können sich ja auch am telefon schon total blöd anhören. ich halte dich auf dem laufenden. allerdings sind auch g8-reiseverpflichtungen sehr ehrenwert.
diese messe – na ja, das war wohl vor zehn jahren der geburtsort des sogenannten social beat, das was ich gerade in meiner noch fehlenden hausarbeit behandle. allerdings ist dieses phänomen recht schnell verloschen, oder besser gesagt es glimmt halt noch aber mehr auch nicht. deswegen erhoffte ich mir davon etwas, und das programm ist auch nicht ganz so übel. ma schauen.
deine [Literatur-Website]-von-früher-geschichten sind ja ziemlich faszinierend. da war ja mal richtig was los, hab ich ja ziemlich viel verpasst. ich bin auch ein wenig gespannt, was die anthologie angeht, und auch die neue seite, wie gesagt, sie versuchen ja schon irgendwie recht gut, der ganzen sache herr zu werden. auch dein cleverer versuch, mit einem auszug aus […] in letzter minute noch teilzunehmen, ist mir nicht entgangen :-). Warum nicht!
Zum thema eier: meine oma hatte bis vor einem halbe jahr hühner, und da das nicht so weit von berlin ist, habe ich oft frische eier aus von oma kontrolliertem anbau gehabt, und das ist ein riesenunterschied. inzwischen ist sie zu alt, um jeden morgen die hühner zu füttern, und ich muss supermarkt-eier essen. oder vom wochenmarkt, und bei eiern schmeckt man wirklich einen unterschied, diese normalen teile aus käfigen kann ich auch nicht mehr essen. klingt zwar etwas biolatschen-hippie-öko-mäßig, ist aber so.
also, ich muss jetzt schluss machen, erinnere mich daran, dass ich nächstes mal noch erzähle, was ich für eine tolle woche hatte, wenn ich es bis dahin nicht vergessen habe. ich geniesse jetzt mein leben weiter.
bis dann
s.
grüße alle anderen netten menschen, die du triffst
Über Inspiration, das Schreiben, das (Vor)Lesen, Bücher, Filme, Musik und den ganzen Rest: Von Kriegen und Frieden, und auch vom niemals zufrieden oder je ganz fertig genug sein. Kann Spuren von Drogen enthalten.
Ein einseitiger Briefroman in Fortsetzungen
(2002-2004)
(Zur Vorrede und Teil I hier entlang.)
Datum: [2003]
Betreff:
Hallo M.,
man, ich hatte schon gedacht, dass du dir vorgenommen hast, nicht mit leuten zu kommunizieren, die angesichts der kriegswirren wirre gedanken produzieren…, glück gehabt. langsam habe ich inzwischen ein loses kriegstagebuch zusammen, da ich immer noch wenn ich zeit habe, die gedanken die ich gerade habe, aufschreibe. das interessante daran ist, dass sich die sicht auf die dinge doch deutlich unterscheidet, von mal zu mal.
doch leider kommt das andere schreiben dabei zu kurz, zumal ich jetzt fest entschlossen und von der zeit gedrängt bin, meine hausarbeiten zu beginnen (abgabeschluss erster mai – wie passend). vom vorlesen mal ganz zu schweigen, denn da ich mir ja vorgenommen habe, nicht mehr unvorbereitet auf die bühne zu gehen, und ich keine zeit zum vorbereiten habe… umso mehr freut es mich, dass du wenigstens den Entschluss hattest, zu einem slam zu gehen… und es lag ja letztendlich nicht an dir… Und Gratulation natürlich für die Entfragmentierung des Romanfragments.
–> gerade habe ich überlegt, was ich dir jetzt zum thema krieg schreiben kann, um deine Fragen zu beantworten, dann fiel mir nichts ein, ich habe was gegessen, eine tüte geraucht und mich überreden lassen, ins kino zu gehen. jetzt, nach einer weiteren tüte und spät in der nacht muss ich dir unbedingt eine Kino-Empfehlung aussprechen: Adaption. Ich weiss nicht genau, ob in deiner Film-Hitliste „Being John Malkovich“ vorkam, in meiner ist es jedenfalls so. und wenn du den magst, wirst du adaption auch mögen. Es passt auch zum Thema: Schriftsteller-Probleme. Nicht nur dass Leute die man kennt als Vorlage dienen, es ist noch schlimmer. Aber ich will nicht zu viel verraten. Aber doch schon ein komisches Gefühl, berücksichtigst du so was beim Schreiben, dass deine WG-Mitbewohner das mal lesen könnten und was die so denken? Hab ich ja bisher nicht gemacht, bis mir der typ geschrieben hat. Hab ich schon erzählt, dass er mir geantwortet hat und meinte, er wüsste nicht, wer ich bin, ich soll ihn aber mal ansprechen? Das finde ich voll lustig, es verleitet zu komischen Gedankenspielen (besonders nach dem Genuss des Films): Er weiss nicht, wer ich bin, weiss aber dass es mich gibt. ich weiss das, weiss wer er ist und bin mir ziemlich sicher, dass er mich wie man so sagt „vom sehen kennt“, mich aber wohl nicht zuordnen kann… na ja, ist das verwertbar?
voll clever, wie ich vom thema krieg abgelenkt habe, oder?! *g* Aber so ganz kann man sich dem ja nicht entziehen. Wie gesagt, ich bin gerade nach hause gekommen, es ist jetzt knapp eins, und ich bin live dabei, wie im moment die B-52 Bomber in der Royal Airforce Base Fairford/UK beladen werden. Dank meines immensen Nachrichtensenderkonsums in den letzten Tagen (dies auf die Frage, woher ich meine Infos bekomme, Internet spielt da bei mir eine ganz kleine Rolle, bis auf einmal indymedia pro tag, um die wahrheit zu erfahren : -) ) weiss ich inzwischen, dass diese Flugzeuge so fünf sechs stunden brauchen, um ihren job zu machen: Menschen töten (das sagt übrigens keiner, dieses flugzeug wird jetzt beladen, fliegt ein paar stunden und tötet dann menschen, es ist immer nur von „erreichen des zielgebiets“ die rede. daher hast du recht, er ist surreal, der krieg – er wird nicht vermittelt. was mich allerdings wirklich trotz meiner kritik und medienverseuchter abgeklärtheit aufs heftigste geschockt hat, war sgt. john riley, einer der us-kriegsgefangenen. wie gesagt, ich leide an ntv-n24-cnn-bbc-skynews-nbc-überkonsum und habe mitbekommen, wie dieses kriegsgefangenen-video das erste mal gezeigt wurde, auf n24. eine halbe stunde später gab es die erste meldung auf cnn, dass es so ein video geben sollte, dann kam eine pressekonferenz mit rummy, wo er sagte, dass die ausstrahlung eines solchen videos die genfer konventionen verletzen würde (dabei habe ich ein neues wort gelernt: humiliation), und so etwas zu tun sei nicht sehr schlau. ich überlegte, ob er jetzt auch die deutschen nachrichtensender angreifen würde.
Sgt. Riley schockte mich, weil er sehr sehr sehr ängstlich war. das erste menschliche gesicht in diesem krieg. da hat die pr des irak gewirkt, es sah so aus, als ob er echte todesangst hatte. wie ein wildes tier, dass man gerade eingefangen hat und in eine kiste gesperrt, so verschüchtert. das fand ich echt hart, und das bestärkt mich in der hoffnung, dass dieser krieg etwas bringen könnte im hinblick auf die erkenntnisfähigkeit der menschen. inzwischen nennt man das glaube ich auch vietnam-effekt. wenn solche bilder zu sehen sind, könnten ein paar mehr leute über kriege allgemein nachdenken… allerdings ob es für eine bewegung reicht? ich weiss nicht, irgendwie ist die bewegung ja schon da, immerhin sind hunderttausende auf den strassen (sogar in wiesbaden *g*), aber es fehlen die wirklichen inhalte und ziele, oder? ich war übrigens nicht da, ich hatte in meiner „aktiven“ zeit, beim asta, so viele demos organisiert und absolviert, dass ich noch fünf jahre demoabstinenz auf meinem konto gut habe. und dieses konto füllt man in berlin ja wirklich, du hast recht, einmal pro woche auf, weil man zufällig, wenn man aus der u-bahn kommt, in eine demo gerät. und ich spare auf den ersten mai – quatsch.
habe ich jetzt einen gedankenstrang vergessen? ich weiss es nicht genau, es ist spät und ich muss dringend eine neue tüte drehen, deshalb nur noch ganz kurz: Warmer Damm?! Schon allein wegen diesem namen würden tausende berliner schwule nach wiesbaden ziehen, wenn sie davon wissen würden, glaube ich :-).
Aber auch ich bin wahnsinnig froh über den frühling, das ist in berlin echt die schönste jahreszeit. wenn man in einer großstadt erlebt, wie das leben wieder erwacht, ist das echt cool. wiesen, ufer, parks, seen und wälder sind voll, genau wie die bürgersteige mit cafe-stühlen, ab und zu wehen nette lüftchen in die nase und man denkt wieder drüber nach, mal über den flohmarkt zu gehen. macht schon spass. also auf auf und das dach eingeweiht! berlin ist übrigens gerade jetzt eine reise wert, nur so am rande : -)
K.[Hund] geht es sehr gut, bin heute mit ihr im Wald rad gefahren, das findet sie glaube ich ganz gut. sie bedankt sich der nachfrage und übermittelt ihrerseits die besten wünsche. aber du hast recht, der winter passt ihr besser, nicht nur wegen ihrer husky-gene. ihr paradies wäre eine winter mit viel schnee, aber trotzdem seen mit wasser, in dem man schwimmen kann.
Zum thema kinder vor bösen hunden retten und auf den arm nehmen kann ich dir gerne mal einen erfahrungsbericht schreiben, durchaus interessant. erinnere mich daran, doch jetzt bin ich zu erschöpft dafür…
Du hast dich übrigens nicht wiederholt, finde ich total spannend, das mit der hundewolle-mütze. von k.[Hund]s fell könnte man glaube ich ganze teppiche machen. ich schick dir mal ein paar kilo haare. finde ich übrigens voll witzig, dass du deiner mutter ein spinnrad schenkst. hat was von einem märchen, irgendwie.
[…]
arrividerci und dos widanja
s.
Betreff: Re: -nooo subject-
Datum: Thu, 3 Apr 2003 23:50:15 +0200 –
Hallo M.,
ich sitze nicht nur mit dem Laptop in der Bibliothek und schreibe meine Hausarbeit, sondern zur Zeit sogar in dem lustigen kleinen Stadtarchiv meiner ehemaligen Heimatstadt. Ist auch viel besser, da ich von der Uni-Geschichtsbibo nur den Blick auf Unter den Linden habe, wo der Alte Fritz als Denkmal steht, das ist nicht so inspirierend. Hier schaue ich aus dem Fenster und sehe dicke alte rote Backsteinmauern und die etwas aufgewühlte See – das ist schon netter.
Die Zugvögel tun mir natürlich auch leid, und das Kulturerbe. Sagen wir mal so, schließlich ist ja mesopotamien mal der Anfang der Zivilisation gewesen, und vom letzten der Zivilisation wird’s jetzt zerstört . Zum Thema Zynismus wirst du von mir altem Zyniker kein Wort des Tadels hören…
Ich habe meine Gedanken zum Krieg jetzt auch auf die Homepage gestellt, weiß nicht, ob das schon zu modisch ist? Kannst du ja mal abchecken… ; -) Inzwischen sind in Berlin glaube ich auch nur noch 30-50 Leute bei den Demos, von mehr habe ich jedenfalls nichts gehört.
Schämst du dich gar nicht, dass du mit den Filmdownloads persönlich dafür verantwortlich bist, dass die Hollywood-Bosse sich nur noch zwei Maybachs pro Nase leisten können? *g* Aber im Ernst, weil ich nichts fürs Kino bezahlen muss, bin ich ziemlich hochnäsig geworden. Auf einem Computermonitor könnte ich mir glaube ich keinen Film anschauen… Nervt das nicht ein bisschen?
Wenn du meinst, dass du nur gut über Sachen schreiben kannst, die du irgendwie persönlich erlebt hast, dann hattest du wohl viel mit Käfern zu tun, oder? :).
Womit wir wahrscheinlich beim Thema wären, worauf du schon die ganzen Zeilen wartest… Ich habe das Werk der bisher (zu unrecht) unbekannten Autorin bekommen, mich gefreut und es gleich gelesen. Das ist jetzt drei Tage her, deshalb kann ich keinen komplett frischen und detaillierten Erfahrungsbericht mehr abgeben, aber ich tue mein bestes. Also erst mal Gratulation, ist ja doch schon gar nicht so kurz, und sehr nett gestaltet! Die Kritik zuerst: (keine Angst, ist nicht so viel) Ich glaube man braucht sehr viel Konzentration, um es zu lesen, und wirklich noch zu wissen, wo man ist. Einige Stellen könnten auch durchaus gestreckt werden, manchmal scheint es sehr komprimiert. Naja, und ein paar kleine Schreibfehler, aber darüber brauchen wir ja nicht zu sprechen. Wenn du willst, helfe ich dir gerne noch mal alle Fehler ausfindig zu machen. ich hatte glaube ich auch einen logischen Fehler gefunden, weiss ich aber nicht mehr genau.
Doch in erster Linie hat es mir sehr gut gefallen. Deine Art, zu beschreiben, ist wirklich sehr sehr schön, dieses „etliche Zigaretten sind schon geraucht worden“ hat mir sehr gefallen, auch das surreale, z.B. mit den dressierten Tieren etc. Und das Thema an sich ist auch interessant. Ich glaube, ich muss es doch noch mal lesen und dann eine richtige Kritik schreiben. Aber wie kommt mein Hund in dein Buch?! ; -)
Also, später mehr dazu.
Übrigens, ich habe am wochenende eine interessante DVD geschaut, Memento hieß sie glaube ich, ist auch schön verwirrend. aber der film hat sich bestimmt schon mal auf deiner festplatte befunden…
[…]
Rigaer Straße, hoho! Wenn nach Berlin dann gleich richtig, was ;)? Aber im Ernst, ist schon ganz nett dort, obwohl ich inzwischen ziemlich kreuzbergpatriotisch bin. Doch Friedrichshain (Rigaer) gehört ja jetzt zu Kreuzberg, von daher ist es schon wieder okay. Da erwarte ich mal gespannt den Sommer, ob du jemanden findest, der dich begleitet. Aber sage nicht ich hätte dich nicht gewarnt, der Frühling ist vieeeel besser, obwohl er sich ja auch schon wieder verkrümelt hat, die Sau! Prinzipiell müsste ich eigentlich da sein, ich wollte mal ne woche an die küste und vielleicht nach italien, ein freund von mir arbeitet dort irgendwo. aber der sommer ist ja lang.
typen wie deinen onkel gibt’s hier genug, und so freaks machen die stadt ja auch so liebenswert. hört sich jedenfalls nach einem vollen programm an, dein berlin-plan.
Nach Südafrika geht’s leider frühestens erst wieder im Winter, Oktober, wenn alles klappt. jemand erzählte mir zwar, dass da auch schon wieder semester ist, aber auf solche stimmen höre ich prinzipiell nicht *g*. Sommer wäre aber auch blöd, da dort dann gerade winter ist. eigentlich wollte ich ja jetzt dort sein (eigentlich will ich immer „jetzt dort sein“), aber das liebe geld wollte für was anderes ausgegeben werden (so komische sachen wie miete und strom).
K.[Hund] ist gerade mal wieder krank. An den Strand des Grunewaldsees wird so zwei mal im Jahr ein toter, alter und grosser karpfen angespült. und k.[Hund] findet solche leckerbissen zu verführerisch, als dass sie auf uns hören würde. das bedeutet zwei tage lang kotzerei und scheißerei (entschuldigung für diese rüde wortwahl). zur strafe gab es dann nur reis für sie….
bedenke dies, wenn du dir einen hund anschaffst, nicht jeder ist so ein wackerer russischer recke wie c. (kennst du eigentlich ilja muromez oder so? fiel mir gerade assoziativ zumn thema russischer recke ein).
also, bis dann, ich lasse von mir hören und werde versuchen, das reich-ranicki gen in mir zu finden.
S.
PS. ich muss mir jetzt erst mal ein wörterbuch holen, meine russische halbbildung reicht nicht wirklich, um deine ansprache ganz zu verstehen. Ertappt!
Hallo M.,
danke für die schnelle antwort und entschuldige bitte meine oberflächliche Kritik in der letzten mail. du hast keinen grund, traurig zu sein, oder etwas besser zu machen. Ich habe mir die nötige Mühe gemacht (denn das ist, und das hat nichts damit zu tun dass ich dich persönlich kenne – tue ich ja gar nicht : -) – das mindeste was man einem text entgegenbringen sollte, schließlich wurde er ja auch unter mühen verfasst) und […] noch mal gelesen. und versucht, meinen spontanen eindruck direkt festzuhalten. Wenn du versprichst, dass du den rest dieser mail noch liest und nicht sofort runterscrollst, verrate ich dir auch, dass du diesen verworrenen erlebnisbericht am ende dieses briefes findest. *g*.
Übrigens hast du volkommen recht, natürlich erkenne ich niemanden speziellen in den Figuren, aber das ist auch gar nicht nötig.
Jetzt zu was profaneren: Hundekotze. da sind diese tiere echt eklig, du hast recht, aber mit der zeit sinkt die ekelschwelle. das wirst du bei deinem job ja bestimmt auch gemerkt haben… Die Kotze berühmter Leute zu entsorgen könnte doch aber auch durchaus lukrativ sein – bei ebay lässt sich alles versteigern! :-).
Also mit Prominenz kann man in Berlin auch angeben, obwohl es natürlich besser ist, backstage die stars kennenzulernen. Ich habe eine gute freundin, die ich schon jahre kenne und die immer ziemlich strange männer hat. könnte eine lange geschichte werden, aber ich versuche mich kurz zu fassen:
vor drei jahren oder so war sie mit einem typen zusammen, der ganz witzig war, aber irgendwie sehr schüchtern und so künstler-mäßig, er studierte puppenspiel, was dazu führte, dass in der wohnung auch lauter lustige puppen rumlagen. irgendwann hatte er mich mal eingeladen, wo er mit einem freund einen auftritt hatte: puppen und dazu ganz witzige musik mit freestyle-gesang. nicht mein ding, aber gut gemacht. inzwischen scheinen die „puppetmastaz“, wie sie sich nennen, in berlin eine gewisse berühmtheit zu haben. als ich jedenfalls beiläufig einem anderen freund von mir erzählte, dass ich p. kenne, starrte der mich ungläubig an, so als ob sich ein tor in eine andere welt öffnen würde. da habe ich mitbekommen, wie so fanverhalten gegenüber stars ist. ich kannte halt den schüchternen p., der sich ohne eine puppe vorzuschieben wohl nicht auf die bühne trauen würde, und ein anderer kennt ihn als star. das war nur so eine anekdote am rande.
Ich würde mich echt gerne mal in deine welt rüberbeamen, und ich würde dafür sogar in kauf nehmen, vorlesen zu müssen. schon weil ich dich dann auch lesen sehen kann. *g*. Und du weißt gar nicht, auf was für glattes eis du dich mit dieser einladung begibst, würde das semester nicht schon in einer woche beginnen und müsste ich nicht noch meine hausarbeiten schreiben (die glücklicherweise gut vorankommen, ich war ja gerade auf recherche-tour und musste mich gestern durch einen schneesturm zurück nach berlin kämpfen, aber ich war erfolgreich und bin frohen mutes) dann hätte ich glatt einen kurzurlaub in roland-koch-land gemacht. so aber hast du noch mal glück gehabt.
Aber es freut mich für dich, dass du solche einladungen erhältst, du scheinst ja doch schon eine lokale berühmtheit zu sein! Qualität setzt sich wohl doch durch… Die [Literatur-Website] nicht einzubeziehen halte ich übrigens für eine sehr gute Idee.
Um deine Frage noch kurz zu beantworten: Ich bezahle 215 Euro Semestergebühren. Das liegt aber einerseits daran, dass ich schon ziemlich lange studiere (macht glaube ich so um die 20 Euro extra), und andererseits daran, dass unsere Hauptstadt-Vorzeige-Uni es endlich geschafft hat, als letzte Hochschule in Berlin, ein Semesterticket einzuführen. Ein langes und elendiges Thema, in Berlin gibt es mindestens fünf verschiedene Semesterticketmodelle parallel nebeneinander. ohne das waren es 100 euro, glaube ich.
Also, hier jetzt meine Gedanken beim lesen deiner geschichte:
Ein unvermittelter Einstieg. Gleich im ersten Satz werden die Qualitäten der Erzählerin klar: „mache Musik an, um sie nicht zu hören.“ Solche Formulierungen machen neugierig. Die folgenden Sätze lassen klar werden, wo man sich befindet, welche Gesellschaft man hat, und das sieht nicht gut aus.
Eine graue Welt mit rauen Sitten und Menschen, die zu sich und anderen ein eher gespaltenes Verhältnis haben. Und Merkwürdiges tun: Informationen sammeln, Schreie in Ampullen abfüllen.
Moke, paranoid, irrgläubig und halbverwest, wird in seiner Hoffnungslosigkeit allein gelassen, aber taucht schnell wieder auf, um seine Talente unter Beweis zu stellen. Er kann schließlich kochen, Salben zusammenrühren und Messer werfen. Er ist keine ausnahmslos tragische Gestalt, denn er wird nicht nur alleingelassen, sondern lässt auch allein. Ein guter Charakter.
Spaziergänge in der Kanalisation, in der es von Anonymitäten wimmelt. Bravo! Dann aber der abrupte Bruch mit Moke. Warum? Ist das Fass übergelaufen? Er schien schon immer durchgeknallt, also kann es daran ja wohl nicht gelegen haben.
Stück für Stück wird die Welt gut portioniert beschrieben. Zeit spielt keine Rolle, und das hatte man sich auch schon fast gedacht. Wissen dafür umso mehr. Es ist nicht ganz klar, ob es verboten ist oder einfach nicht mehr auf dem freien Markt zu haben, aber das ist auch egal. Und die Idee mit den gestreckten, unsauberen Informationen kannte ich so auch noch nicht. Hier und spätestens bei dem Baum, der Geheimnisse verrät, zeigt sich, wie originell dieser Text ist. Unterschwellig klingt vieles an: clockwork orange, cronenberg, natürlich naked lunch und lynch. Doch das sind nur unterbewusste echos. Es ist nicht so, dass man denkt, da hat sich jetzt jemand einen topf genommen und das alles aufgekocht. Was mit der richtigen Würze ja auch durchaus gut sein. Nein, es ist eine eigene Sache, die nur erinnert, so wie man sich im ungünstigsten Fall beim Schwimmen in unbekannten Gewässern plötzlich an all die reproduzierten Ängste erinnert, die man kennt. Schlechter Vergleich, aber gut gemeint.
Ist die Eule nur ein Traum? Wohl schon, und das Entwerfen der Traumentwürfe passt gut in den Rahmen, klang ja schon an bei dem augenauskratzenden Kind, das mir noch besser gefallen hat – eine Verbindung?
Ortswechsel. Von wo weiß man nicht genau, aber das Ziel ist bekannt: Ein Egal-Ort. Eine Begegnung mit Komplimenten für nette Schnitzereien (wiedermal gut getroffen!) Verwirrend nur der Bezug zu einer deutschen Tracht – bisher gab es keine konkreten Bezüge auf irgendwas, und das passte auch ganz gut. Dann bekommt die Begegnung einen Namen und es werden noch ein paar wohldosierte Informationsbrocken verstreut, aber nicht zu viele.
Auf einmal eine dramatische Wendung, schlagartig kommen scheinbar Emotionen auf, bisher war alles auf eine gewisse Art emotionslos. Und das stellt sich auch gleich wieder ein, ohne Erklärung. Die Brücken scheinen abgerissen zu sein, plötzlich eine andere Umgebung, andere Menschen. Eine neue Situation wird beschrieben, man wird durch das vor-sich-hinqualmen eingelullt und findet sich damit ab.
Doch die Zeitschlaufe wird zurückgespult, während man neuer Dinge harrt, wird man von der Vergangenheit eingeholt. Moke is back.
Eine böse Raupe, die gerade ein weiteres Verpuppungsstadium absolviert hat. Kaum wiederzuerkennen, aber mit der gleichen DNA ausgestattet. Doch so wie er gekommen war, ging er auch wieder. Diese Wiedergängerei ist wohl für ihn Normalzustand.
Keine Ruhe, immer wieder neue Personen, neue Umgebungen, auf den ersten Blick ohne Zusammenhang, bis auf das Vergängliche, Unstete. Lebensfetzen.
Nach einer Phase der Entspannung eine neue böse Überraschung. Der schwarze Schatten, die Welt wird noch seltsamer, aber es passt irgendwie. Eine Hilflosigkeit gegenüber den Veränderungen schleicht sich ein und wird von Verdrängung abgelöst. Konzentration auf andere Sachen. Ohne Ergebnis.
Zur Aufheiterung der Ausweglosigkeit wieder ein sehr schönes Bild: Trotzdem man inzwischen an rehreissende Bären in Küchen und dressierte Wildkatzen ebenda gewöhnt ist, huscht einem bei der Vorstellung von fernsehschauenden Käferfamilien ein Lächeln übers Gemüt. Doch dann ein Zeitraffer, der nicht die Zeit, sondern die Außenwelt rafft, alle offenen Fragen werden im Turbo beantwortet, aber keine Antwort befriedigt so richtig.
Die Flucht, so scheint`s, endet in einer archetypischen Dorfidylle. Und da darf natürlich auch die einfühlsam beschriebene gutmütige Alte nicht fehlen (warum wird sie gesiezt?). Aber bevor es zu klischeemäßig wird, erkennt man, dass auch diese Idylle trist ist, und die gutmütige Alte sich einem verworrenen Schicksal ergeben hat.
Keine Auflösung, war auch das nur wieder ein Traum? Jedenfalls schlägt die Möbiusschleife wieder zu, die Handlung wurde unvermittelt zurückgebeamt.
Jetzt wird es allerdings verworrener. Mela, ohnehin schon ins Undefinierbare übergegangen, komplettiert ihre Verwandlung, und ohne Zusammenhang wird eine alte, traurige und merkwürdige Geschichte erzählt – die Reste eines Ereignisses, das am verdampfen ist…. das wirkt!
Die Bestätigung folgt: Mela erzählt eben auch nur Geschichten, die zur ihr passen. Aber wer ist Kira, die plötzlich da ist? Perspektivenwechsel – die bisher namenlos gebliebene Erzählerin? Sie treibt ziellos durch die schon bekannt wüst wirkende Welt, bis sie unvermittelt zum Ziel, zum Kern kommt. Und da dauert es auch nicht lange, bis die bekannten Gesichter auftauchen. Und neue unbekannte dazu. Langsam macht sich eine das-Rätsel-hat-bald-ein-Ende-Stimmung breit. Nach einem kurzen Täuschungsmanöver durch Schilderung angespannt-entspannter Ruhe bestätigt sich dieser Verdacht, klassisches Motiv: ein Sturm kommt auf, legt sich, und nichts ist wirklich klarer geworden. Im Gegenteil, jeder scheint vom Unwetter in seine eigne kleine Psychose, wahlweise Albtraum, gewirbelt worden zu sein.
Andere konnten sich auf eine merkwürdige Party retten, jetzt, am Schluß, dann doch noch eine obligatorische sexuelle Eskapade? Nein, der Leser wird nicht enttäuscht, er wird enttäuscht.
Die Psychosen sind überstanden, doch die Außenwelt bleibt widrig. Und wie es das Schicksal will, der Kreis schließt sich, der letzte fehlende Teil taucht wieder auf, Moke. Ein wirklich guter Schluß, mit dem Traum. Hinterlässt eine gewisse Leere, so einen unappetitlichen Nachgeschmack.
Erklärt das den Titel, der nicht ein einziges mal im Text vorkommt? Hmm….
ich hoffe das hat dir irgendwie geholfen – bei rezensionen war ich noch nie besonders gut.
bis dann
s.
Über Inspiration, das Schreiben, das (Vor)Lesen, Bücher, Filme, Musik und den ganzen Rest: Von Kriegen und Frieden, und auch vom niemals zufrieden oder je ganz fertig genug sein. Kann Spuren von Drogen enthalten.
Ein einseitiger Briefroman in Fortsetzungen
(2002-2004)
(Zur Vorrede und Teil I hier entlang.)
Datum: [März 2003]
Betreff:
Hallo M.,
vielen Dank für deine mail! und wieder mal sorry für die späte antwort. Doch ich musste leider viel arbeiten, und wenn ich dann mal den kopf frei habe, dann versuche ich zu schreiben, und wenn ich versuche zu schreiben, dann denke ich an brecht, der mal sagte, dass in solchen zeiten jedes gespräch über einen baum ein verbrechen wäre, weil damit nicht darüber geredet würde, wie viel unheil auf der welt geschieht.
Nicht dass du erschrickst, ich bin nicht auf einmal rührselig, ich habe meinen zynismus natürlich bewahrt. Gerade angesichts von medienwirksamen Massendemonstrationen, bei denen die teilnehmer am nächsten Tag mit einem super gefühl zur arbeit gehen, aber keinen blick über den tellerrand werfen, gegen einen krieg sein reicht ja, man muss ja nicht gleich gegen alle sein.
Soviel dazu, entschuldige dass ich abschweife. Aber andererseits war der erste (oder eigentlich ja mindestens der zweite) Irakkrieg 1991 für mich die erste große politische Erfahrung im freien Westen. Da kommen schon erinnerungen hoch.
Was sagst du zum Krieg? Ich fand A. hat es ja ganz gut getroffen, das thema :-). Ich habe bei der [Literatur-Website] ein wenig rumgestöbert und bin auf die neuen sachen von ihr gestossen, vor ein paar tagen (du merkst ich lebe ein wenig zeitverzögert *g*), viele grüße und meine bewunderung an sie! Naja, und dann habe ich natürlich auch mitbekommen, dass die NWO sich jetzt auch auf die [Literatur-Website] ausgedehnt hat. Ich finde langsam sollte mal ein neuer Spielplatz gebaut werden in […]irgendwashausen. Und der Osten? Ich weiß nicht, ich habe erst mal den […]-Text neu reingestellt und osten kann ja überall sein, auch im süden gibt’s ja einen Osten… Wenn sie mich drin haben wollen, dann sollen sie sich halt einen text aussuchen, ich fände es okay, kann aber auch nicht auf krampf was zu einem thema schreiben, wie gesagt, eigentlich kann ich ja gar nicht schreiben gerade :-). Wie schaut es da bei dir aus, bist du jetzt komplett zur romanautorin geworden oder zur Profi-puzzlerin?
Zum glück ist die Berlinale auch vorbei, die hat echt mit der zeit genervt, tausende von cineasten aus aller herren länder sind irgendwann mal zu viel. ich hab mir zwei drei filme angeschaut, es gab ein hommage-programm an die frühen kung-fu-filme, also noch lange vor bruce lee, das war witzig. anonsten, um auf deine frage zu antworten, schaue ich nicht alles, aber schon viel, das kommt ganz drauf an, ob ich bock habe, ins kino zu gehen. ich habe aus bequemlichkeit (oder anderen gründen – welche das wohl sein könnten…?) auch schon filme verpasst, die ich unbedingt sehen wollte, während ich mir auch schon totalen müll angeschaut habe, aus langeweile. gestern zum beispiel waren wir in catch me if you can, den würde ich mir an einem guten tag mit sonnenschein nicht mal nachmittags im fernsehen anschauen, aber für gestern abend wars ok.
Die Ferien haben jetzt gerade angefangen, obwohl wie schon erwähnt kompensiert durch längere arbeitszeiten. Klausuren muss ich zum glück nicht schreiben, ich studiere ja total altmodisch auf magister, das bedeutet drei hausarbeiten bis spätestens mai. aber das dürfte ich wohl hinkriegen. vielleicht bleiben sogar ein paar tage an der ostsee übrig, urlaub wäre mal wieder eine gute sache.
Die fragen von A. waren sehr, nun ja, amüsant passt da wohl nicht, aber so in der art. ich arbeite ja auch immer noch an meinem katalog der unbeantworteten fragen. jetzt muss ich aber leider langsam los, hier noch zum trost mein letzter schreibversuch, obwohl einiges nicht ganz neu sein wird für dich, das ist alles, wozu ich gekommen bin in letzter zeit. Aber wie du so schön sagtest, man kann ja nicht immer den supertollen text schreiben.
Übrigens: Bei einem Studentenstreik vor drei Jahren reagierte die kanadische Polizei auf die Besetzung eines Uni-Gebäudes damit, dass sie aus riesigen lautsprechern die Backstreet-Boys spielten, den ganzen tag lang. Unter diesem Aspekt sollte doch darüber nachgedacht werden, ob man UN-Waffenkontrolleure mal ins Studio von Dieter Bohlen schickt, oder?
Hier mein Text, und noch einen schönen Tag!
Bis bald
S.
Datum: [März 2003]
Betreff:
Hallo M., arme M., böse M.!
musst du mich daran erinnern, dass die Semesterferien nur 2 Monate dauern ?! *g*. Aber im Ernst, du tust mir Leid, auch du scheinst nicht viel davon zu merken, dass ja eigentlich Ferien sind. Blöde Hausarbeiten. Allerdings habe ich ja glücklicherweise schon die passenden Referate gehalten, so dass ich hochmütig davon ausgehe, schon jeweils 70 % der Hausarbeit zusammenzuhaben mit dem dafür angehäuften Wissen. Und außerdem gibt es durchaus Dozenten bei uns, die sagen „wann Sie die Hausarbeit abgeben ist mir egal, hauptsache ich bin noch nicht pensioniert.“ Daher lasse ich es wie gesagt gerade eher ruhig angehen. Wo studierst du eigentlich, hast du mir das schon verraten? in frankfurt, oder? das ist doch auch so ein netter heimeliger massenbetrieb, oder?
Ich hatte in letzter Zeit glücklicherweise wieder das vergnügen, zu leben, also zu schreiben (bei interesse schau auf meine neuigkeiten-seite, und das ist noch lange nicht alles…), zu lesen (einen Essay-Band von Jörg Fauser, sehr gut!) und mich unter menschen zu begeben. Und natürlich tennis zu spielen :-). Ich hoffe, dir sind diese vergnügungen auch bald wieder vergönnt. bis dahin musst du damit leben, dich von sat.1 teams inteviewen zu lassen. das kann man in berlin übrigens zum hobby machen, wenn man sonst nichts zu tun hat. in nachrichten-umfrage-interview-mikrofone reinlaufen, oder film-dreharbeiten. gibt’s hier ständig und macht besonders spass bei nachtdrehs, wenn man gerade betrunken von einer party kommt und da scheint dir auf einmal ein 60.000 watt strahler entgegen. das nur nebenbei.
Aber du hast ja wenigstens ein ziel vor augen, dein fragment. ich glaube ich hätte da schon längst den faden verloren. Zum thema erzählperspektive habe ich letztens in einem wirklich guten artikel im kultur-spiegel zum ende der popkultur (inhalt: leider keine millionengagen für uns zukünftige literatur-stars) gelesen, dass juli zeh sich über die langweilige ich-erzählperspektive beschwert hätte. und da fühlte ich mich persönlich getroffen, obwohl die dame mein werk wohl gar nicht kennt. also versuchte ich, meine perspektive zu wechseln, was mir aber nur in einer verlogenen art und weise gelang. ich hatte das früher schon mal versucht (in einem meiner ersten roman-fragmente), es klappte aber nicht wirklich. Also der vorwurf ist schon irgendwie begründet, aber ich glaube, jeder muss auch seine eigene perspektive finden. ich glaube nicht, dass es da qualitative unterschiede gibt, oder wie siehst du das?
Also, ich will dich auch nicht zu lange aufhalten, wünsche dir noch viel glück und erfolg und verbleibe
mit sonnigen grüßen
s.
PS. Wie es scheint hast du dich zwischenzeitlich auch wieder ins [Literatur-Website]-universum verirrt, was sagst du zu den zuständen dort, und zum osten? hast du diesen nepal-text gelesen?
Bis denne!
Datum: [2003]
Betreff:
Hallo M.,
damit du dich wieder freuen kannst, dass ich so schnell zurückschreibe, hier diese mail. Und einen Anlass gibt es auch: ich war gestern auf meinem dritten slam. Und hatte damit mein Slam-Depri-Ereignis. Es war ziemlich haarig. Als „Gaststar“ eröffnete Jan Off den Abend, der ganz gut war. Dann wurde die Reihenfolge festgelegt, und es gab nur acht Leser. Und ich kam schon an dritter Stelle, was mir gar nicht passte, da ich noch zu bekifft war :-). Als erstes kam eine typische Berlin-Amerikanerin mit englischer Lyrik, dann kam Mind J Jizum, ein Freestyler, der eigentlich richtig gut ist, aber dem der Zeitpunkt auch viel zu früh war, und der gar nix machte ausser kostenlos CDs zu verteilen. Dafür bekam er dann eine ganz gute Wertung. Und dann ich. Ich hatte den […]text, dachte gerade weil so wenig Leute lesen wollten, mal einen längeren Text, und verfranste mich voll. Als ich das merkte, wurde es nur noch schlimmer, ich versuchte auf der Bühne noch zu improvisieren und den Text zu kürzen, was auch nicht gelang. Und darüber hinaus wurde ich immer unsicherer. Das war schade, denn dadurch versaute ich einen eigentlich guten Text. Insgesamt wurde ich so 10. von 12 oder 13, aber mein Nachbar, der auf dem Fußboden neben mir saß, versicherte mir, dass es sooo schlecht nicht war.
Meine Lehre aus dem Abend: Vorbereitung. Auch der Umgang mit dem Mikro muss gelernt sein. Aber: Immerhin stand ich auf der Bühne, und das trauten sich einige nicht. Ein schwacher Trost. Eine weitere Aufheiterung meines Befindens lieferte mein Nachbar, der mich schon von den anderen Auftritten kannte, wie sich herausstellte. Man kennt mich bereits! Witzig, aber auch beängstigend.
Der weitere Verlauf war über lange Strecken irgendwie komisch. Das Publikum war sehr sehr schlecht zu motivieren, das merkte nicht nur ich. Es waren dann auch die bekannten Gesichter und Teilnehmer da, Bastian Böttcher zum Beispiel, den ich immer noch uneingeschränkt empfehlen kann. Bei ihm merkt man auch, was Professionalität bedeutet. Diese Leute schreiben nicht nur auf den Auftritt bezogen, also können berechnen, was ankommt, sondern haben ihre Performance auch eingeübt. Ich traf ihn vor seinem Auftritt auf dem Klo, wo er seinen Text unter zu Hilfenahme der Kopf-gegen-die-Wand-Technik noch mal übte.
Überraschenderweise war er nicht der einzige Sieger an diesem Abend. Der Überraschungskandidat war ein zufällig in diese Veranstaltung geratener Münchener, der nichts tat als Geräusche. Eine fabelhafte BeatBox. Da taute das Publikum dann auch auf, obwohl kaum Text gebracht wurde. Die Begeisterung war aber durchaus gerechtfertigt und der Höhepunkt wurde erreicht, als die Endabstimmung kam. Da das Publikum abstimmte, war es schwer zu sagen, wer mehr Applaus hatte. Und so einigten man sich auf zwei Sieger, die dann eine Wahnsinns-Kür hinlegten:
Sebastian Krämer ist eigentlich eher von der Prosa-Fraktion, wenn auch mit gutem Rhythmusgefühl und wie gesagt professioneller Performance. Also machte die BeatBox aus München die Musik und Krämer lieferte den Text und der Saal kochte das erste mal an diesem Abend. Alles in allem dann doch eine gute Veranstaltung, wenn auch nicht für mich *g*. Meine Lehre war, dass ich nie mehr unvorbereitet auf die Bühne gehen werde.
Soviel dazu und jetzt Helau! Auch ich bin ein Karnevals-Leidender. Nicht nur, dass ich meinen tollen neuen Fernsehempfang eine Woche lang vergessen konnte, da auf jedem Sender nur noch diese Sitzungen übertragen wurden, sondern inzwischen gibt es auch im protestantischen Berlin Karnevalisten. Die sind zusammen mit der Regierung aus Bonn gekommen und verursachen auch hier mittlerweile Straßensperrungen wegen Umzügen. Schrecklich! SCHRECKLICH!! Aber es ist ja zum Glück vorbei. Doch du hast da mein volles Mitleid, in dieser Gegend zu wohnen und zu studieren (Mainz wie es singt und lacht, haha!), ich würde mich an amnesty wenden. […]
Ich würde deine Versorgung ja gerne verbessern, habe allerdings kein rechtes Vertrauen in die Deutsche Post. Und der Weg ist mir dann doch ein wenig zu weit. Aber auch hier im Schlaraffenland gab es vor kurzem einige Engpässe, was ungewöhnlich ist. Es wurden ziemlich viele Wohnungen und Privatplantagen ausgehoben, so dass die Paranoia um sich greift, mich aber zum Glück noch nicht erreicht hat. Falls du das nächste mal im Traum mal wieder in Berlin bist, schau einfach bei mir vorbei ;).
Finde ich ja cool, dass jetzt auch in der hessischen Regionalpresse über die Fernsehprobleme Berlins berichtet wird. Und ja, es ist so kompliziert, wenn man es technisch verstehen will. Wenn man einfach nur Fernsehen schauen will, dann braucht man sich nur zu merken: Kiste kaufen für 200 € und an den Fernseher anschliessen. Das ist nicht ganz so kompliziert, aber eben trotzdem teuer *g*.
Der Oasis-Text ist nicht in monatelanger Recherche entstanden, sondern so wie es da steht: Im Rausch geschrieben, direkt beim Schauen des Videos. Inzwischen weiss ich nicht mehr genau, was ich davon halten soll, ist halt mal was anderes. Ich habe auch bemerkt, dass das Video mehr enthält, als ich dachte, und dieser Typ keinesfalls nur vor dem Baum steht, und der Baum nicht auf einem Hügel ist, sondern in einem Park, aber was zählt, ist der Moment, und der Moment, in dem ich das geschrieben hab, suggerierte mir eben einen Hügel. Also lass ich es auch so.
Die Skispringernamen gibt es doch wirklich. Danke für das Lob, ich überlege, ob ich diesen Text zum Osten-Wettstreit anmelde. Mal schauen. Und um dir ein noch schlechteres Gewissen zu machen: ich habe noch zwei Texte geschrieben, aber du weißt ja, die müssen eine Weile reifen, in der Schublade. Aber lass dich von deinem Gewissen und mir nicht zu sehr ärgern, schließlich tust du was für die Uni, was ich zur Zeit eher aufschiebe. Auf keinen Fall solltest du dich von mir entmutigen lassen, von wegen Zugang verloren und so. Schon allein deswegen, weil ich gespannt bin, ihn zu lesen.
Bei der [Literatur-Website] habe ich inzwischen die Zeitsynchronisation wieder geschafft, also den aktuellen Überblick über die neuen Texte und was gerade so abgeht. Doch das macht es auch nicht besser. Den Nepal-Text hatte ich gelesen, kurz bevor ich dir die letzte Mail geschrieben habe, und mein Problem damit war, dass der Text sagen wir mal vom Thema her sehr interessant ist, aber meiner Meinung nach nicht wirklich gut geschrieben. Rechtfertigt ein gutes Thema alleine eine Aufnahme in die Anthologie? Das ist die Frage, die ich mir stellte.
[…]
Bis demnächst
S.
Datum: [März 2003]
Betreff:
hallo m.,
ganz entgegen meiner gewohnheit diesmal keine abgeklärte mail von mir.
gerade eben sprudelte ein text aus mir heraus, und irgendwie habe ich das bedürfnis, ihn dir so „frisch“ wie möglich zuzuleiten, da ich nicht weiss, ob ich ihn nach dem „drüber schlafen“ auf meiner festplatte behalten würde. Es geht, unüblicherweise, um das populäre thema krieg, was mich natürlich auch beschäftigt, aber du weisst ja, dinge, die mich wirklich berühren, kommen selten in meinen texten vor. der zweite text ist ebenfalls zum gleichen thema, vor einer woche geschrieben. Sehe bitte beides als Fragmente, so wie du mir auch eins geschickt hast.
deine mail, für die ich mich natürlich sehr bedanke, beantworte ich bestimmt morgen. sie klang gut, hörte sich ein wenig so an, als ob es dir wieder stressfreier geht, das würde mich freuen.
Bis bald und gute Nacht in die Kleiststrasse!
S.
PS. Warum eigentlich 341?
Datum: [März 2003]
Betreff:
Hallo M.,
und, hast du den Schock meiner letzten Mail verkraftet *g*? Erst stellt sich heraus, dass ich Spiegel-Leser bin, und dann auch noch für den Krieg… Naja, das waren halt so ein paar Gedanken, entstanden durch non-stop-Vorkriegsberichterstattung. Aber im Grunde finde ich, ist was Wahres dran. In den Sechzigern war viel die Rede von der „imperialistischen Fratze“ der USA, und ich glaube, die wird jetzt, im Krieg, wieder sichtbar, auch für die, die es schwer glauben. Soviel nur kurz dazu, jetzt zu deiner Mail.
Du hast natürlich gut aufgepasst, und es freut mich dass du meine Mails so gründlich liest. Bei dem Slam waren es anfangs wirklich nur acht Teilnehmer, aber nachdem der MC so gebettelt hatte, erklärten sich noch ein paar Unentschlossene bereit, vorzulesen. So dass es am Ende 12 Leute oder so waren. Autogrammkarten habe ich noch keine, noch nicht :-). Aber es ist echt lustig, nicht nur dass mich dieser Typ bei dem Slam angesprochen hat, ich habe auch noch andere Fanpost bekommen:
vor ein paar Tagen bekam ich eine Mail von jemanden, den ich in meinem […]-Text verarbeitet habe – [geschwärzt]. Das war schon ein komisches Gefühl. Und er schrieb, er „wurde schon mehrfach auf diesen Text hingewiesen“. Ich dachte ausser dir kennt keiner meine Homepage, und dann meldet sich auch noch ein „Opfer“. Er war aber nicht sehr böse, nur etwas verwirrt, so wie ich ihn auch aus der Realität kenne. Lustigerweise weiss er nicht, wer ich bin, also er kennt den Text, und er kennt mich im „wahren Leben“ auch, wenigstens flüchtig, aber er hat das Puzzle noch nicht zusammengefügt. Apropos, was macht dein Puzzle?
Zum Thema Christiansen und Spiegel – ich weiss ja nicht, wie gesagt, die Popliteratur ist vorbei, die Millionenvorschüsse auch (wieder mal sind wir zu spät dran, so`n Mist) und wer kennt heute noch Lebert? Auch Stucki hat ja schon lange, für seine Verhältnisse, kein Buch mehr geschrieben, dafür hat er sich aber ne gute Frau geangelt, das füllt ihn jetzt wahrscheinlich genug aus.
Und natürlich werde ich weiter lesen, bis ich von der Bühne geprügelt werde. Entgegen deiner Vermutung habe ich das noch nicht getan, ich arbeite aber dran. Wie gesagt, das nächste mal will ich mich besser vorbereiten. Den richtigen Ort habe ich auch schon: Den Scheinbar-Slam in Berlin-Schöneberg. Da war ich letzte Woche das erste Mal, und während in den Bastard, wo ich sonst immer war, so bestimmt mehrere Hundert Leute reinpassen (ich kann das nicht gut schätzen, aber ich glaube 200 ist realistisch), ist die Scheinbar schon mit 50-60 Leuten überfüllt. Es war auch eine sehr nette Atmosphäre dort, irgendwie familiärer.
Aber trotzdem gibt es auch dort die Profis, da hast du schon recht, das kann einen irgendwie nervös machen. Andererseits wurden diese Leute auch nicht als Profis geboren, denke ich. Hauptsache ist, dass man den Drang danach verspürt (der bei mir immer hervorgerufen wird durch freien Eintritt und die Getränkebons).
Dein Scherz war übrigens gar nicht so lahm, keine falsche Bescheidenheit! Ich habe, Achtung: im Spiegel mal eine Reportage gelesen über ein Unternehmen, das für relativ wenig Kohle alle unzustellbaren Briefe und Pakete und so aufkauft, um den Inhalt dann zu sortieren und zu verscherbeln. Und da kam wohl einiges zusammen, Drogen, Geld, Technik usw. Wenn ich mal nachschaue, finde ich bestimmt die Adresse raus, dann kannst du ja einen Brief schreiben und dich nach deinem Paket erkundigen *g*.
Ich habe jetzt zwei Texte zur Anthologie angemeldet, mal schauen, was draus wird. Speziell was dafür schreiben könnte ich aber auch nicht. Deine Erfahrungen mit Sibiria würden mich schon interessieren, dann sind wir schon zwei, die diesen Text gerne lesen würden. Wenn du jemanden gefunden hast, der ihn geschrieben hat, sag Bescheid.
Gratulation zu den siebzig Seiten! Der Spannungsbogenaufbau ist dir jedenfalls gelungen, was meine Neugier betrifft. Ich habe mal ein paar meiner alten Texte durchgesehen, auch ich habe ja diverse Versuche in Richtung Roman gestartet (sogar in der dritten Person), dann aber mangels Zeit abgebrochen. Ich finde es echt schwierig, die Story im Kopf zu behalten, deswegen hatte ich mir damals am Ende immer Notizen gemacht, was als nächstes passieren sollte. Leider kann ich die jetzt nicht mehr wirklich deuten….
Bis gestern war bei uns auch tolles Park- und Grünanlageneinweihwetter, und ich war tatsächlich auf unserem Dach, um den Fernsehturm am Alex zu fotografieren. Zu mehr habe ich es noch nicht gebracht. Der Nachteil ist, dass jetzt wieder unzählige Wochenendspaziergänger sich im Grunewald-Hundeauslaufgebiet rumtreiben und sich über die Hunde beschweren. Aber nach fast drei Jahren habe ich mich auch daran gewöhnt.
Soviel dazu.
Bis dann und Grüsse an A. (ich habe schon viel unbrauchbarere Gedichte gelesen)
S.

(Da drüben auf dem Platz vor Aldi, doch auch den gibt es schon lange nicht mehr)
Über Inspiration, das Schreiben, das (Vor)Lesen, Bücher, Filme, Musik und den ganzen Rest: Von Kriegen und Frieden, und auch vom niemals zufrieden oder je ganz fertig genug sein. Kann Spuren von Drogen enthalten.
Ein einseitiger Briefroman in Fortsetzungen
(2002-2004)
(Zur Vorrede und Teil I hier entlang.)
Datum: [Januar 2003]
Betreff:
Hallo M.,
ich hoffe du hattest einen guten Start ins neue Jahr und dir geht es wieder besser. was macht der Fieberwahn? Du weißt ja, immer schön Tee trinken und was man noch so alles machen sollte, mein Floskel-Vorrat ist leider ziemlich erschöpft.
Doch ich denke nicht, dass dieser Fieberwahn dem „alles wird gut“ entgegensteht – auf dich warten noch große aufgaben! :- )
Was hat dein Sektenguru denn mit dir gemacht? So ernst auf einmal, und dann auch noch auf den Zynismus schimpfen, das wird meinem Guru gar nicht gefallen. Aber mal im Ernst: klar ist alles schlimm, soviel steht fest. Auch ich frage mich manchmal, ob ich die richtige frau, den richtigen job und das richtige leben erwischt habe, warum das wetter so schlecht, das portemonnaie so leer und die regierung so doof ist. und dann kommt man leicht ins resignieren, was dann im zynismus endet. Aber glücklicherweise bin ich ein absoluter Anti-Modernist. Was meint, dass ich mich bemühe, nicht das zu tun, was gerade mode ist. Also finde ich den Euro toll und die regierung gar nicht so schlecht. Wenn alle kanzler-bashing betreiben, dann sage ich, wenn ihr das system anerkennt, dann ist dies die bestmögliche regierung: ein leider gekipptes zuwanderungsgesetz, ein leider ziemlich verzögerter atomausstieg, die homo-ehe, dosenpfand – das mit kohl (denn der drohte ja 98 noch, was viele vergessen) oder stoiber?! Naja gut, das wetter könnte wirklich besser sein. Aber sonst, geht es uns so schlecht? ich glaube nicht, schließlich sind ja wenigstens wir beide berühmte schriftsteller, in irgendeinem paralleluniversum. und das sollte uns zuversicht geben.
Es freut mich, dass du meine verschlüsselten botschaften empfangen hast. Du darfst es aber keinem weiter erzählen, denn die tarnung vom bobbele muss aufrecht erhalten bleiben. Ich meine so ein typ, jet-set-leben, eine frau mal eben in der wäschekammer nageln (entschuldige meine ausdrucksweise, ich passe sie nur den umständen an), mehrere wohnsitze, noch mehr frauen: warum gehen die leute zu james bond ins kino und kommen nicht auf die geheime geheimagentenidentität von boris becker?
Und jetzt eine kleine geographie-nachhilfestunde: der Grunewald ist ein wald in berlin, der sehr schön und sehr groß ist, mit mehreren seen und noch viel mehr wildschweinen. dort kann man toll mit dem hund spazieren. mit friesland meine ich schon das, was du auch denkst, wobei es glaube ich schon unterschiede zwischen nord- und ostfriesland gibt, als großkotziger hauptstadtbewohner kann ich aber darüber geflissentlich hinwegsehen. und der spreewald ist so circa 150-200 kilometer südlich von berlin in brandenburg, da gibt es viele kleine flüsse, wo kähne mit touristen drauf fahren, und im sommer ganz viele mücken. aber denke jetzt nicht, dass mein geographiewissen so toll ist, das kommt immer drauf an.
[…]Ich bin froh drüber, dass du das buch durch hast und es dir gefallen hat. und wenn man ein gutes buch weiter gibt, dann gibt das ein paar punkte auf dem „jeden tag eine gute tat“-konto. Ja, was da abgeht mit kerouac, ginsberg und borroughs (ich habe gehört, sie werden aus abkürzungs- und verschwörungszwecken auch gerne kgb genannt, mystisch, was?!) war schon verrückt, aber auch ein ziemlich hartes leben, was in „on the road“ auch deutlich wird. und darum beneide ich sie nicht. Vielleicht aber um die art und einstellung zu leben, so unbeschwert irgendwie. na ja.
Diese Mail ist etwas kürzer, ich beende sie hier mal, um deine gesundheit zu schonen (das ist jetzt wirklich frei von jeglichem zynismus, und völlig ernst gemeint). ist es in solchen fällen eigentlich eher hilfreich oder eher belastend, wenn die mutter krankenschwester ist? war doch so, oder?
gute besserung und möge das nächste jahr für dich alles bringen, was du dir wünscht.(floskel zu ende)
bis bald
s.
ps. es scheint wirklich berg ab zu gehen, ich stand um 12 zum jahreswechsel bei uns auf dem dach und hatte alle feuerwerke gut im blick, und die offiziellen am brandenburger tor waren echt dürftig. Keine knete oder denken die „ach, die leute werden in diesem jahr noch so viele feuerwerke live auf cnn sehen können“? (tschuldigung, da hat sich der zynismus wieder eingeschlichen)
Datum: [Januar 2003]
Betreff:
Hallo M.,
du siehst, meine euphorie und mein mitteilungsdrang haben wieder zu ihrer alten gewohnten form zurückgefunden. leider ist es inzwischen bei mir wieder so, dass die uni mich zurück hat. ich muss in einer woche ein referat halten, wo die professorin ziemlich anspruchsvoll ist. mittelalter. noch dazu sitzt sie im prüfungsausschuss und so, und da ich irgendwann im nächsten halben jahrzeht mit dem studium fertig sein will (nicht nur, dass wir hier jetzt ein unsäglich teures semsterticket haben, jetzt denkt der pds(!)-senat darüber nach, studiengebühren zu erheben), muss ich bei dieser person einen nicht allzu schlechten eindruck hinterlassen.
doch genug des trübsals, ich zehre immer noch ein wenig von der adrenalinausschüttung des auftritts, das war echt ein gutes gefühl. die namen müssen natürlich keinem was sagen, aber solltest auch nur von einem hören, dass er irgendwo bei einem slam in deiner gegend auftritt, rate ich dir, geh hin. (ich weiss ja nicht, wie breit das angebot bei euch so ist, ich hoffe nicht, dass das jetzt hauptstadtbewohnermässig herablassend klingt… ;). und ausserdem ist schönstes winterwetter hier in berlin, verschneite strassen und bäume. davon sehe ich leider nur während des hundespaziergangs etwas, und wenn ich wie jetzt gerade vom pizzaholen komme (glücklicherweise gibt es in dieser sonst so tristen gegend einen pizzabäcker zwei häuser weiter, der wenn man selbst abholt unschalgbar billig ist).
nächstes mal sage ich dir dann auch bescheid: also, der nächste slam in berlin, wo ich wohl hingehe, wahrscheinlich, mal sehen, ist anfang februar. jetzt weißt du es! damit mir keine beschwerden kommen… na ja, es war wie gesagt weniger grausam, obwohl das schon ein wenig, warten, nervosität etc. , aber wenn man es hinter sich hat, dann fühlt man sich schon ziemlich gut, wenn’s nur einigermassen geklappt hat. Und wie gesagt, ich bin von dort ja auch zurückgekommen mit vielen neuen Erfahrungen, von daher habe ich (achtung: abgedroschene, aber hier wirklich passende floskel) auch gewonnen :-). zum beispiel wie du sagtest, dass meiner meinung nach weit über 50% eines poetry-slam-auftrittes von der übung und erfahrung abhängen. wie du schon mal vor einiger zeit in einer mail bemerkt hast: man erfährt unmittelbar auf der bühne, ob und wie der text ankommt, an welchen stellen man noch arbeiten könnte. so habe ich auch schon vor dem zweiten auftritt bei dem text einfach zwei stellen weggestrichen, da sie zwar meiner meinung nach zum lesen gut waren, zum vorlesen aber eher weniger. und am auftritt selbst, also freies sprechen etc. kann man immer von mal zu mal arbeiten. einige leute machten echt den eindruck, als ob sie einen zehnseitigen prosatext auswendig vortragen…
Herzlichen glückwunsch jedenfalls zum roman als fieberwahnprodukt. ich bin gespannt auf alle weiteren informationen darüber, verkneife mir aber das neugierige nachfragen :). nur eine frage: wenn du jetzt wieder auf papier schreibst, was ich bewundere, mir aber nicht selbst zutraue, musst du da nicht ganz neue muskelgruppen wieder aufbauen, und wenn ja, bekommt man dabei muskelkater in den fingern? das ist echt eine halbwegs ernste frage, ich finde so zwanzig handgeschriebene seiten ist schon viel, oder?
Es erfreut mich natürlich zutiefst (kann man das so sagen? *g*), dass du meine roman-schreib-hypothesen bestätigst. denn schließlich hab ich bisher ja nur dumm rum gequatscht und theorien aufgestellt, die du aber jetzt nachweist, oder auch nicht… wie gesagt, herzlichen glückwunsch und ich bin gespannt.
silvesterboykott findet übrigens meine vollste zustimmung, bei russischen künstlerfilmen bin ich da zurückhaltender : ) dass du in berlin warst, ohne mir vorher bescheid zu geben, auch wenn es nur im traum war, finde ich doof. aber mal im ernst, woher wusstest du denn, dass das berlin war? hast du irgendwas berlin-typisches in deinem traum gesehen, oder wusstest du es einfach?
k.[hund] hat silvester ganz gut überstanden, war zusammen mit ihrer mutter, deren besitzer bei uns mit im haus wohnen, ihrem bruder, der auch um die ecke bei einer freundin von uns zu hause ist, und noch einem dritten hundefreund von einem kumpel von uns bei uns in der wohnung, während unsere kleine partygesellschaft um zwölf ja auf dem dach war. was aber okay war, denn die hunde waren ja zu dritt und nicht alleine, und als wir wiederkamen, war noch alles in ordnung, aber ausreissen wäre auch schwer möglich gewesen… stadthunde eben!
tut mir ja wirklich leid, dass deine leute nach berlin ziehen, doch ich denke eine anarchistische m.-republik wiesbaden wird viele immigranten aus berlin raus locken. was wären denn die ersten gesetze, die du erlassen würdest? (kleine fangfrage : -) ) Du merkst schon, ich muss wohl gleich noch mal meinen geisteszustand auf seinen gehalt an albernheit überprüfen lassen, doch mal im ernst, was wäre das erste, was du tun würdest in der freien m.-republik?
bis bald und sehr gespannt auf weitere nachrichten
s.
ps. ich habe mein text-fragment übrigens noch fertig gestellt, nachdem ich dir die mail geschrieben habe, war also eine sehr lange nacht noch, ich schicke es dir vielleicht demnächst, noch will es noch nicht so richtig von fremden leuten gelesen werden, muss noch ein bisschen reifen *g*
Datum: [15. Januar 2003]
Betreff:
hallo m.,
sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber ich hab die letzten beiden wochen nur in der bibliothek gesessen, doch morgen ist es vorbei, dann muss ich mein referat halten. ich bin nicht mal dazu gekommen, zu irgendeiner lesung zu gehen, überhaupt wegzugehen, geschweige denn etwas anderes kreatives zu tun. gestern rief mich glücklicherweise ein freund an, und da er wusste, wie ich im stress stecke, sagte er ich sollte mir eine tüte bauen, schwimmzeug einstecken und warten bis er kommt.
er holte mich dann ab und wir gingen ins liquidrom – das war genau das richtige. so ein riesiges rundes salzwasserbecken in einer architektonisch nett gestalteten kuppel-halle, lichtspiele und lustige filme an die wand projiziert und dann konnte man sich dort ins wasser legen und sich davon tragen lassen und unter wasser hört man, was der dj gerade für entspannende musik auflegte. das ist bekifft echt ein erlebnis :-). Jetzt bin ich also total gechillt und sehe dem morgigen tag entspannt entgegen.
auch dich scheint die tristesse ja wieder eingeholt zu haben. das mit deinen ohren tut mir leid. aber jetzt scheint ja die kältewelle vorbei zu sein. dieses jahr gingen die kohlen (ich habe statusgemäß noch eine kohlenheizung – mit kachelöfen, ich weiss nicht ob es das im goldenen westen noch gibt?) weg wie noch nie. aber ich fand das wetter schön, solange es kalt war. jetzt ist es matschig und nass, das find ich doof, da hilft es auch nichts, dass es wärmer ist. ich bin gespannt auf deinen bericht über die einführungskurs-mogelpackung, so was kenne ich, bibliothekseinführung oder pc-pool einführung, totaler beschiss.
ich bin inzwischen im elften semester, also schon seit anderthalb jahren fertig, laut studienordnung, hihi. na ja, ich glaube ich brauche noch so vier semester, aber du hast recht, leider gottes rückt der ernst des lebens näher, obwohl ich mir ein geregeltes arbeitsleben auch nicht vorstellen kann. aber was solls, studier ich halt noch was anderes… na ja, es ist ja nicht so, dass ich total unzufrieden bin mit meiner situation, ich arbeite halt nebenbei und kann mich über wasser halten, was will man mehr.
Gerade strassen wären auch in meiner republik erlaubt. und dope natürlich auch. ansonsten dürfte jeder nur höchstens 20 stunden in der woche der lohnarbeit nachgehen oder so, pflichtfreizeit für alle. ist mir gerade so spontan eingefallen.
freut mich übrigens sehr, dass du mit deinem text vorankommst, ich hoffe dass ist immer noch der fall. ich habe bisher wie gesagt nicht die zeit gehabt, weiter zu machen, aber viele ideen gesammelt. ich habe einen katalog mit unsinnigen fragen angelegt, als ich überlegt habe, wie viele leute wohl noch handschuhe im handschuhfach haben (würde das in der m.-republik nasenwärmerfach heissen? *g*).
was für filme hast du denn zur inspiration geschaut, vielleicht ist ja was dabei, was ich noch nicht kenne. irgendwelche geheimtipps?
das wars dann auch erst mal für mich, schließlich ist morgen ja mein referat! danach bin ich ein neuer mensch und gelobe besserung in der häufigkeit der nachrichten von mir, ehrlich.
bis dann
s.
Datum: [Februar 2003]
Betreff:
Hallo M.,
falls du dich wunderst, warum ich dir solange nicht geschrieben habe: ich musste mir erst mal alle filme anschauen, die du aufgelistet hast. – Quatsch, kannte ich schon alle, das war nur eine ausrede. Aber im ernst, es sind auch fast alles lieblingsfilme von mir, fast. was mich wundert ist cube, denn den kennen glaube ich nicht wirklich viele leute, das andere sind ja schon alles eher filme, die so sagen wir mal subkultur-mainstream sind. aber cube hat schon was, auf alle fälle. deine liste hat mich dazu angeregt, mal wieder filme zu schauen, wozu hat man schließlich diesen dvd-kram! was mir noch einfällt: snatch, bube dame könig gras, Bang Boom Bang und Lammbock. jetzt ist ja wieder Berlinale hier, und da meine freundin nebenbei im Kino arbeitet, bedeutet das stress für sie und umsonst berlinale schauen für mich, hihi.
Wo wir grad beim thema sind: im gegensatz zu dir (das mit diesem filme-aus-dem-internet-laden finde ich witzig, dass du das machst – dafür bin ich dann echt zu wenig internet-affin oder so, mit meinem mickrigen analoganschluss) hatte ich ja bisher fernsehen. und zwar klassisches hausantennen-fernsehen. da bekommt man in berlin immerhin so 10 programme. doch jetzt kommts: die rundfunk-mafia hat entschieden, dass berlin testgebiet wird. der sogenannte analoge terrestrische empfang (es hat wochen gedauert, bis ich verstanden hatte, was das ist :-)) wird eingestellt. stattdessen wird der terrestrische empfang auf digital umgestellt. hört sich ja erst mal modern und gut an, bedeutet aber, dass man nix mehr in die kiste bekommt, wenn man sich nicht ein zusatzgerät für mindestens 200 euro pro fernseher kauft. sonst geht gar nix mehr. Und das fand ich dann auch doof. also habe ich mir, um mich dem straßenbild in kreuzberg anzupassen und um mich nicht von diesen banditen abhängig zu machen, eine satellitenschüssel geholt. das war ein fataler fehler, weil ich bei diesen vielen programmen schon eine halbe stunde brauche, um durchzuzappen. da bin ich inzwischen dran kapituliert.
das nur nebenbei, tschuldigung falls ich dich mit meinen anekdoten langweile. aber, und das auch zur begründung meiner schreib-unpünktlichkeit, ich lass es mir grad ein wenig gut gehen. ich muss zwar noch arbeiten, aber das sind nur zwei tage die woche. und an der uni mach ich grad pause, habe alle referate hinter mir, danke der nachfrage, und das letzte, wofür ich so geackert habe, war echt gelungen, mein bestes bisher und auch das sah auch die dozentin so, nicht dass ich ein streber wäre, aber das fand ich ganz cool.
und da habe ich mir gedacht, feier ich das doch ein wenig dadurch, dass ich erst mal wieder anfange, zu leben :-). so in zwei wochen werde ich dann mit den hausarbeiten anfangen. bis dahin schaff ich es vielleicht auch mal wieder, was zu schreiben oder gar zu lesen, denn das habe ich echt schleifen gelassen. genau wie die [Literatur-Website]. da war ich echt lange nicht gewesen, man verliert da ja echt schnell den anschluss inzwischen. neue anthologie, oho, in dieser schwierigen zeit… ich weiss nicht, was ich von der ost-idee halten soll, muss mich erst mal wieder zurecht finden in der virtuellen welt.
Schade, dass der roman auf eis liegt. apropros, hier ist nach einer matsch-phase wieder winter, und das nervt mich inzwischen ganz schön. aber vielleicht ist es ja besser so, denn wenn dann ganz. vielleicht schaffst du es ja in den ferien, den anschluss und einstieg wieder zu bekommen. ich hoffe es und bin gespannt.
was macht deine beziehung zum BAföG-amt? wäre das nicht mal thema für eine geschichte? oder handelt dein roman gar von renate g., der BAföG-verwaltungskraft für die buchstaben f-l, die irgendwann von dem hartnäckigen studenten karl meier wegen ignoranz aus verzweiflung erschosssen wurde?
aber genug der vermutung und der spinnerei. ich hab noch eine idee im kopf, von meinem letzten nächtlichen ausflug, vielleicht kann ich ja noch was draus machen.
bis denne und grüße an alle!
s.
(28.2.21)
Die Baugrube,
in die der junge Fuchs immer
– zugegeben, das waren noch andere Zeiten –
neugierig verschwand,
ist längst geschlossen
& die Fenster sind eingesetzt.
Überall wird verdichtet,
erst in den Straßen,
dann in den Köpfen.
Oder war es doch
umgekehrt?
Ganz zu schweigen
von dem Schießschartenhochhaus
vorne am S-Bahnhof.
Der Fuchs, immerhin,
den ich längst für überfahren hielt
(wegen der beschissen geschnittenen
neuen Straße, wo jetzt auch noch
ein Bus lang fährt),
der lebt noch.
Ist älter geworden, und struppiger und
sieht mitgenommen aus.
So wie die Stadt auch.
Über Inspiration, das Schreiben, das (Vor)Lesen, Bücher, Filme, Musik und den ganzen Rest: Von Kriegen und Frieden, und auch vom niemals zufrieden oder je ganz fertig genug sein. Kann Spuren von Drogen enthalten.
Ein einseitiger Briefroman in Fortsetzungen
(2002-2004)
(Zur Vorrede und Teil I hier entlang.)
Datum: [Dezember 2002]
Betreff:
Hallo M.,
nun endlich mal wieder eine Antwort von mir. Ich sitze total geschlaucht vom Weihnachtsessen in der mir zugewiesenen Kemenate im Stammsitz meiner Familie. Der ist übrigens lustigerweise unweit von Berlin im einzigen offiziell anerkannten slawischen Teil Deutschlands – der sorbischen Lausitz. Bei uns wird Weihnachten immer großfamiliemäßig gefeiert, mindestens zehn Leute. Das ist aber für mich ok, da ich meine Familie eigentlich mag, vor allem seitdem ich sie nicht mehr jeden Tag sehen muss…
Den Hund jedenfalls freut es, da er im Schnee rumtoben (hier ist Weihnachten irgendwie immer Schnee) und durch fremde Wälder laufen kann.
Natürlich war ich bei meinem Auftritt aufgeregt und nervös, ziemlich sogar. Doch es geht mir wie dir, wenn man dann oben steht und den ersten Satz vorgelesen hat, dann geht es, so eine Art Tunnelblick oder so. Und ich werde weiter machen, doch vielleicht nicht gleich bei einem slam, sondern eher bei so einer Vorlesebühne, um nicht gegen die Lyrik-Fraktion zu sehr kämpfen zu müssen. Mal schauen.
Ich befinde mich jedenfalls zur Zeit nicht in der Lage, etwas kreatives zu schreiben, aber morgen fahre ich wieder zurück nach Berlin, und dann habe ich ein paar Tage Zeit, die ich nicht allein mit Uni-Kram verbringen werde, hoffe ich. Auch bei mir liegt derzeit ein Fragment auf der Festplatte, doch deines scheint mir um einiges gelungener. Es ist wirklich schön, und es würde auch so reichen, ohne weitere Ergänzungen. Das war wieder typisch M. – entschuldigung dafür, aber deine Gedankengänge faszinieren mich immer wieder, wie die Leute, die für das ernst nehmen verantwortlich sind. Und deine Weisheit schimmert auch durch ein paar Zeilen hindurch – du wirst auch immer abgeklärter, oder? :- ) Bekanntschaften zu Leuten, die sich mit Anerkennungsdiskursen auskennen, sind gefährlich nahe an Mitgliedschaften in gesundheitsschädlichen Sekten dran…
Doch ich sollte dazu schweigen, denn schließlich hast du mich enttarnt. Über lange Kaderrekrutierungsverfahren stieg ich in der DDR zum Leistungssportler auf, um dann für den KGB Tennisspionage durchzuführen. Davon wird auch mein nächster Text handeln, der als Fragment wie gesagt schon vorhanden ist, doch wohl auch mein letzter sein wird, da ich ja enttarnt bin, und jetzt wohl von meinem Führungsoffizier Boris Becker (der es mit einem so offensichtlich russischen Namen geschafft hat, immer noch nicht aufzufliegen und stattdessen in der ostdeutschen Provinz Mercedes-Autohäuser betreibt) durch einen Hammeraufschlag ruhig gestellt werde.
Aber im ernst, ganz ganz früher habe ich viel Sport gemacht, und wirklich schreibe ich darüber gerade einen Text, aber jetzt seit 13 Jahren oder so gar nichts mehr. Und Frühsport am offenen Fenster ist doof, da mir da ja immer die Passagiere der Berufsverkehr-U-Bahn zuschauen können. Aber ein Freund von mir, der ein aktiver ultralinker dogmatischer Schwuler ist, ist an der Uni Tennislehrer. Und wie du meintest, da es ja recht preiswert ist (von kostenlos kann hier keinesfalls die Rede sein) dachte ich mir „jawoll!“ und habe mich überwunden, es mal auszuprobieren. Allerdings wusste ich da noch nicht, dass die Anfängerkurse so früh morgens sind. Doch da muss man durch, nicht wahr. Und jetzt, wo schon die Hälfte des Semesters geschafft ist, ist der Rest ja nur noch ein Klacks.
Aber Mountainbike fahren wäre auch ein tolle Sache. Ich mache das ja manchmal mit meinem Hund im Grunewald, was sehr spaßig ist, vor allem für den Hund. Doch das ist noch gar nichts gegen meinen ehemaligen WG-Mitbewohner. Der war wirklich Fahrrad-Fanatiker. Der ist Sonntag Mittag los und erzählte abends, wenn er wieder da war, vom Spreewald oder so. Dann arbeitete er als Velotaxi-Kutscher, bis diese Berufsbekleidungen einführten, wo so Logos drauf waren, was ihm nicht gefiel. Und einmal, er kommt ursprünglich aus Friesland, ist er von einer Freundin von dort, die ihn verlassen hatte, nachts mit dem Rad zurück nach Berlin gefahren. Das hat natürlich länger als nur die Nacht gedauert, aber verrückt, oder?
Ein Tennisdress habe ich nicht, jedenfalls kein klassisches. Stattdessen versuche ich meine mangelhaften Leistungen bei meinem Tennislehrer dadurch auszugleichen, dass ich mein altes Che-T-Shirt (original auf Kuba gekauft) auftrage. Bis jetzt hat es geholfen.
Ich denke mal um deine finanzielle Ausstattung brauchst du dir als Nasenwärmerfabrikbesitzerin bei dem Wetter keine Sorgen machen, oder? Ansonsten hoffe ich für dich, dass der Weihnachtsmann dir noch bessere Highlights überbracht hat als die von mir, denn ich habe gerade bemerkt, dass in dem Paket gar nicht alles drin war, was ich dir eigentlich schicken wollte. Ich hatte noch zwei comics ausgesucht, die sich ganz gut für ein WG-Klo eignen, ich schick sie dir jetzt mal als Anhang mit, was natürlich nicht halb so cool ist, wie im Original aus einer Zeitung rausgerissen.
Womit wir bei der nächsten Überleitung wären: Schreiben auf Papier oder am PC. Ich schreibe inzwischen fast nur noch am pc, aber ich habe auch vor circa einen Jahr meine alte Mühle meiner Mutter geschenkt und mir einen Laptop geholt, was im Nachhinein betrachtet eine sehr gute Entscheidung war, da man das Teil wirklich überall mit hin nehmen kann (zum Beispiel hier her, oder auch in die Bibliothek). Doch manchmal muss eben auch ein Notizzettel reichen, aber da kommen dann wirklich nur Notizen rauf, keine fertigen Texte mehr. Es ist schon trauig irgendwie, und sicher auch absolut stillos, aber eben auch einfach und unkompliziert. Was ich wirklich schade finde ist, dass man die Genese eines Textes nicht mehr erkennt, also so durchgestrichene Sätze, hinzugefügte Wörter am Rand und so.
– So, jetzt muss ich mal kurz eine Rauchen gehen, nach draussen, bibber, das freut den Hund.-
Gitschin ist so weit ich weiss ein Kaff in Brandenburg, ich bin mir aber nicht sicher. Es ist eine breite hässliche vierspurige Hauptverkehrsstrasse, deren Verlängerung Skalitzer Str. heißt. Was aber ist Skalitz? Hmm. Die kleinen Nebenstraßen sind da schon einfacher, die lassen sich zuordnen, das Viertel um die Ecke ist zum Beispiel das Lausitzer Viertel, da gibt es den Lausitzer Platz, die Kottbusser Str., den Spreewaldplatz. Aber Gitschin? Normalerweise hängen bei uns manchmal auch so kleine Schilder unter den Straßenschildern, wo drauf steht, warum die Straße so heißt. Da muss ich mal auf die Suche gehen. [Gitschin und Skalitz liegen in Tschechien]
Ich stelle es mir auch ziemlich kompliziert vor, einen Roman zu schreiben, nicht unbedingt, weil es schwer ist, die Leute abhängig zu machen, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, sondern eher, weil ich dann auch nur den Roman schreiben könnte, und nichts anderes. Also irgendwo hin zurückziehen und als Hauptaufgabe den Roman haben. Was ich nämlich nicht könnte wäre so morgens studieren, nachmittags arbeiten und abends drei Seiten Roman schreiben. Es muss fliessen können, falls du verstehst was ich meine. ich habe schon ein paar ansätze gehabt, aber dann immer wieder abgebrochen, weil ich rausgekommen bin. Aber auf alle Fälle hast du recht damit, wenn du sagst, ausprobieren und du bist ja gar nicht der-und-der. das stimmt, denn du bist M., und darauf kannst du dir einiges einbilden *g*. das ist übrigens ernst gemeint. ich habe vor meinem auftritt auch noch überlegt, ob ich mir einen tollen künstlernamen ausdenken sollte, wenigstens perspektivisch, mir ist aber auf die schnelle nichts eingefallen. auf die liste hatte ich mich mit s.w. eingetragen, dann wurden ja die namen in einen hut geworfen und von einer person ausgelost, die sie dann vorgelesen hat, während eine andere person die namen an eine tafel geschrieben hat. und was soll ich sagen, so wurde aus mir s. p. nur wegen eines sprachfehlers. ich versuchte dann auch, das richtig zu stellen, was aber ja eh egal war – du kennst ja den titel des buches, in dem texte von uns beiden zu finden sind.
Vielen Dank für die Nicht-Geburtstagsgrüße, bei Gelegenheit und Zeit können wir darauf ja mal ein Tässchen Tee trinken. Ich hoffe dieser Brief hat dich mit seiner Schwerfälligkeit nicht allzu sehr gelangweilt, doch morgen ist zum Glück die Völlerei vorbei und ich bin wieder in good old berlin.
bis dann
s.
ps. ich habe den Tipp mit dem Rheinland Hessen an meine Freunde weitergegeben, doch die wollten mir nicht glauben, da ein grossteil von Ihnen aus Rheinland-Flüchtlingen besteht oder sie schon mal von Rheinland-Flüchtlingen gehört haben…
psps. Ich hoffe ja sehr darauf, dass deine weiteren Kreativitätsausbrüche etwas geworden sind, da ich immer gerne etwas von dir lese.
pspsps. Schönen Gruß von K.[Hund]
Datum: [Januar 2003]
Betreff:
Hallo M.,
entschuldige bitte, dass ich dich schon wieder belästige. du brauchst dich jetzt weder unter druck gesetzt fühlen, weil ich dir schon wieder schreibe und du ja eigentlich dran wärst (gibt es diese regel? ist das so was ein ungeschriebenes gesetz? :- ) ), noch brauchst du deswegen irgendein schlechtes gewissen entwickeln*g*.
doch es gibt etwas, was ich jetzt unbedingt aufschreiben muss, du kennst das gefühl doch, oder? (achtung achtung, könnte vielleicht etwas länger werden): ich war gerade bei meinem zweiten slam. also ich habe gerade das zweite mal an einem slam teilgenommen. na ja, ich dachte mir, schließlich habe ich mir vorgenommen, weiter zu machen, schließlich fand ich`s ja letztes mal nicht schlecht, und außerdem war das jahr noch so frisch, dass ich mich ausnahmsweise mal an die vorsätze erinnerte.
Und ich dachte mir auch, dass es ja eben frisch nach silvester ist, da haben die leute ja alle gerade gefeiert, da dürfte nicht so viel los sein, da kann ich vielleicht ein wenig üben, so annähernd unter dem ausschluss der öffentlichkeit. denn, um das vorweg zu nehmen, eine sache hat sich im gegensatz zu meinem ersten auftritt letztens absolut nicht geändert: ich war wieder total nervös.
auch meine anderen vermutungen erfüllten sich leider nicht. diesmal war die veranstaltung im bastard, ein club im prater, der wiederum der biergarten der volksbühne ist. der bastard also ist, wenn ich von meinem begrenzten fachwissen ausgehe, die top-location wenn es um slam poetry in berlin geht. ich war dort schon mal, als zuschauer, es war ganz ok, wirkte aber irgendwie – gesättigt. also dachte ich mir wie gesagt, dass nach dem neujahrssilvestermarathon nicht allzu viele leute dort wären. doch ich hatte nicht mit der werbewirksamkeit des berliner fensters gerechnet. das berliner fenster ist eine ablenkungsmassnahme der bvg, die hier für die u-bahnen zuständig sind. damit die leute nicht merken, dass schlecht getarnte kontrolleure in die waggons steigen, wurden auf einigen linien in den abteilen fernsehmonitore aufgehängt, auf denen so bedeutsame nachrichten wie „lothar matthäus trainiert jetzt die schwäbische kreisauswahl“ verkündet werden. oder eben auch, dass im bastard am 02.01.03 um 22.00 uhr ein poetry slam ist. und deswegen war der auch total überfüllt. ein voller erfolg für die veranstalter, und für den erfinder des berliner fensters auch, denke ich.
verzeih mir, falls ich abschweife. die bude war also gerammelt voll. das machte mich noch ein wenig nervöser. wir (ich habe mich diesmal getraut, mir bekannte und auch wichtige leute mitzunehmen) kamen auch ein wenig zu spät, so dass natürlich keine sitzplätze mehr zu haben waren. und als ich am eingang fragte, ob man noch auf die liste kann, murrte man mir ein „na gut“ entgegen. ich zählte nach und merkte ich war der 13. super omen! mein text, den ich mir ausgesucht habe, war glaube ich auch nicht der allerbeste, aber ganz ok, sollte ja nur übung werden. es war […].
da ich so nervös war, musste ich ganz schnell ganz viel bier trinken, und es noch schneller wieder wegschaffen. dummerweise war das für mein geschlecht bestimmte klo direkt neben der bühne, von der ich aber nur etwas sah, wenn der vortragende über 1,90 war. Also musste ich mich durch die gänge drängeln, was echt schwierig war. von so einer menschendichte pro quadratmeter träumt die loveparade seit jahren. das brachte natürlich mit sich, dass ich einige aschenbecher und getränke umkippte, was mich für die wertung für meinen text sehr optimistisch stimmte, wenn ich so in die gesichter der unter mir sitzenden sah. dazu kam, dass es nicht nur so 18 teilnehmer gab, sondern die reihenfolge auch nicht ausgelost wurde, sondern so wie angemeldet verfahren wurde. ich also als 13. das bedeutete viel zeit für bier und durch nicht vorhandene gänge drängeln und sämtliche sympathien verscherzen.
letztes mal war es ja so, dass ich als siebenter oder achter dran war. wie ich jetzt merkte, steigt die nervosität sozusagen kongruent mit der wartezeit. Abgestimmt wurde diesmal übrigens per von einer zufällig ausgewählten jury vergebenen punkten.
ich fasse zusammen: superviele leute (schätzungsweise weit weit über 100), viele durch mich umgekippte biere und verstörte mienen. und einen mittelmäßigen text!
doch es kam noch besser. der opener, ausser konkurrenz, war dan richter von der vorlesebühne chaussee der enthusiasten. er war brilliant. und zu beginn des zweiten teils, um mal wieder was vorweg zu nehmen, steigerte er sich noch mal. satirische improvisation, superwitzige kurzprosa – einfach gut. danach machte ich im publikum mir bekannte poeten aus. und es waren echt die allerbesten dabei. ohne quatsch. ich habe mich ja gerade unimäßig damit beschäftigt und auch sämtliche berichte über die gesamte szene der letzten zeit gelesen und auch das glück gehabt, eine gute dokumentation über die deutschsprachige slam poetry auf 3sat aufgenommen zu haben. und bei diesem blöden neujahrsslam, wo man denkt, da bleiben alle zu hause, waren sie dann alle im bastard. der absolute held, ich weiss nicht ob der name dir was sagt, sebastian krämer, mindestens zweimaliger gewinner des german poetry slam, mind j jizum, der ist dieses jahr glaube ich vierter geworden, ein virtuose im freestyle, dann xochil schütz, eine sehr erfahrene slammerin, die sehr gut gefühlvolle sachen rüberbringt, wolfgang hogekamp, robert weber, mara leibowitz, dann noch der ebenfalls national-sieger bastian böttcher, auch sehr gut im freestylen, und daneben noch mindestens fünf andere supergute leute. ein, zwei, die schlecht waren, doch schlecht war in diesem feld schon der durchschnitt.
sollte ich mich also diesmal ärgern, dass ich in dieser blöden subkulturhauptstadt wohne? zu viel konkurrenz? na ja, ich legte mir wieder ein paar anfangsfloskeln zurecht. ich blieb bei meinem „schlechte nachricht – prosa!“. und mir sind noch mindestens fünf andere kluge einleitungs-kommentare im laufe des abends eingefallen. zum beispiel, dass es mir schon reichte, vom klo zu kommen, als ein gewisser moritz (keine ahnung über den nachnamen, aber sehr gute prosa-performance) von der bühne ging, der applaus, der von ihm auf mich abtropfte, hätte mir vollkommen gereicht. ich wollte auch sagen, dass ich mir bei dieser konkurrenz (sebastian krämer hat zu recht die volle punktzahl – 30 – bekommen, er war zwei startplätze vor mir) vorkäme wie ein vorspringer beim skispringen. leider habe ich mich in der aufregung an nur eine witzige einleitungs-bemerkung erinnert. wieder was gelernt: immer alles sofort aufschreiben.
nun gut, um es kurz zu machen: ich war also dreizehnter, mindestens 8 leute vor mir, die profis waren, und denen ich allemal mehr zusprach als mir selbst, und dann ein übungstext!
ich brachte es hinter mich, lustigerweise berührte es mich nicht im geringsten, dass diesmal dreimal soviel leute im publikum standen wie bei meiner premiere, und es kam sogar ganz gut an. bei einem maximum an punkten von 30 kam ich auf 15. das war bei dieser konkurrenz für mich mehr als okay. ich war zwar nicht hannawald (du merkst, skispringen – du hast ja keinen fernseher, aber das ist schon seit altersher ein bei mir beliebter sport, als ddr-bürger hatte man an sportlichen vorbildern ja nur kati witt oder jens weißflog, doch dazu mehr in meinem nächsten sport-text, du weißt schon, boris und so, da braut sich was zusammen). also ich war nicht hannawald, aber allemal besser als martin schmidt. in etwa adam malysz, der mir auch der sympathischste ist. das nur nebenbei, ich schweife wieder ab.
das hier ist dann auch schon das ende dieses briefes. ich hoffe, ich habe dich nicht allzu sehr gelangweilt damit, doch es musste aus meinen fingern in die tastatur gebracht werden.
nach dem auftritt merkte ich, dass ich adrenalin für fünf wochen im blut hatte, und das habe ich jetzt langsam aufs zwei-wochen-level abgebaut. die leute, die mich begleitet hatten, waren erstaunlicherweise der meinung, dass ich recht gut war, während ich dachte, dass man gesehen und gemerkt hat, wie verdammt nervös ich war. aber ich war und bin froh, dass ich bei diesem wirklich besten slam ever überhaupt einen punkt bekommen habe. am ende war es dann auch gutes mittelfeld, achter oder neunter platz von 18. ich hatte so ein gefühl, wie wenn man in woodstock die vorband von jimi hendrix gewesen wäre. es wird sich zwar keiner an dich erinnern, aber du hattest einen mordsspass, du warst dabei und du kannst sehr zufrieden mit dir sein.
So, das musste mal raus. danke für dein offenes ohr. vielleicht werde ich ja doch mal b-klassen-prominent, wenn in ein paar jahrzehnten erwähnt wird, dass die berühmte literatin M. im briefwechsel mit einem erfolglosen, aber unbeirrten schreiberling namens s. war. gibt ja immer so briefwechsel-bücher, die posthum veröffentlicht werden. dafür reichts dann vielleicht noch bei mir.
bis dann, und ich hoffe deine krankheit ist dort, wo das alte jahr ist, nämlich weg.
das nächste mal versuche ich dann auch wieder, nicht so in egoistischen gefühlen zu schwelgen.
grüße auch an a. und h.
s.
Über Inspiration, das Schreiben, das (Vor)Lesen, Bücher, Filme, Musik und den ganzen Rest: Von Kriegen und Frieden, und auch vom niemals zufrieden oder je ganz fertig genug sein. Kann Spuren von Drogen enthalten.
Ein einseitiger Briefroman in Fortsetzungen
(2002-2004)
(Zur Vorrede und Teil I hier entlang.)
Datum: [Dezember 2002]
Betreff:
Hallo ärmste M.,
erst die Bronchitis, dann auch noch fassenacht und schließlich „Fliege“! Du tust mir wirklich leid! Ich für meinen Teil habe auch das vorweihnachtliche Familienprogramm absolviert, habe meine mutter gerade wieder zurück zum bahnhof gebracht. sie hat mich zwei tage lang belagert. doch ich denke, deine bronchitis ist schlimmer.
in berlin gibt es übrigens inzwischen auch karneval. zusammen mit den ganzen bonner beamten ist vor jahren ein gastronom, der in bonn wohl die abgeordneten-abfüllstation betrieb, mit nach berlin gekommen. hier hat er eine kneipe mit dem namen „ständige vertretung“ aufgemacht, und da ihm das nicht reichte, musste er auch noch den karneval importieren. bisher ging hier alles seinen protestantischen gang, aber seitdem ziehen ein paar irre durch die strassen mit aufgesetzter pappnase und lustigkeit. man lernt damit zu leben, sag ich mal.
ansonsten habe ich mein referat gut überstanden und das nächste ruft schon aus der ferne. mittelalter, brrr. dazwischen liegt aber noch genug zeit, um meine amazon-bestellung abzuarbeiten. fünf neue bücher warten darauf, gelesen zu werden. wenn ich sie durch habe, dann kann ich dir bestimmt wieder was schönes erzählen, was sich lohnen würde zu lesen, wenn man zeit hätte und die uni und die erwerbsarbeit nicht wären.
ich werde aus dem reichen fundus meiner texte mal wieder was zu der [Literatur-Website] stellen, aber das kennst du wohl alles. was du glaube ich noch nicht kennst, ist dieser text:
den meinte ich auch eigentlich in meiner letzten mail, als ich sagte neuer text, der mir nicht so gut gefällt. und der, der mir gefällt, den habe ich noch nicht ins netz gestellt.
was macht eigentlich deine schreiberei und euer literarisches terzett? nicht dass ihr so endet wie mrr und karasek. bei mir hat sich inzwischen eine gewisse kontinuität beim schreiben eingestellt, alle paar wochen schaffe ich es dann trotz uni doch, was zu schreiben. doch jetzt fahre ich erst mal mit meinem hund auf irgendwelche brandenburger felder, denn hier ist wunderschönes bitterkaltes (minus sechs grad) winterwetter bei strahlend blauem himmel.
dass ich gut auf mich aufpassen muss, hätte man mir viel früher sagen sagen müssen… 🙂
bis bald und gute besserung
s.
Datum: [Dezember 2002]
Betreff:
Hallo M.,
erst mal zu deiner Frage: Nein, ich ziehe meinem hund im winter keine klamotten an, obwohl das sicher lustig wäre… Nasenwärmer zum beispiel*g*. ich habe aber gehört, dass das bei manchen hunden schon ok ist, da sie echt total kurzes und dünnes fell haben. zum glück ist k.[Hund] eine strassenköter-mischung (die edelsten unter den berliner punk-hunden gehören zu ihren vorfahren) mit viel husky drin, so dass sie den winter total liebt.
Mit Lenin bin ich auch in der schule groß geworden. ich habe noch ein buch mit geschichten aus den kinder- und schuljahren lenins, so heisst es auch im original: detskije u schkolnuije godui ilischa, geschrieben von a.i. uljanowa. es beginnt so: am 10. april 1870 wurde unser grosser lehrer, wladimir iljitsch uljanow in der stadt simbirsk an der wolga, die heute im zu ehren den namen uljanowsk trägt, geboren.
schön, oder? und es gibt eine geschichte, die mir immer in der schule erzählt oder vorgelesen wurde: ein armer trauriger junge sitzt irgendwo auf einem dorf rum und heult. dann kommt ein fremder, der ihn fragt was los ist und ihn tröstet. dann geht der fremde weg und der junge freut sich wieder und geht ins dorf zurück, wo gerade auf dem marktplatz eine versammlung ist und jemand sagt, dass lenin gleich spricht. und was ein wunder, der junge sieht, dass lenin der fremde mann war, der ihn getröstet hat.
Bei uns wurden aber natürlich auch geschichten von lokalen revolutionsgrössen den kindern erzählt, zum beispiel von teddy (ernst thälmann) oder dem kleinen trompeter. Über walter ulbricht gab es solche geschichten komischerweise nicht.
ich werde mal schauen, ob ich heute abend noch was schreibe, lust und ideen hätte ich, doch davor hat der knecht ruprecht noch eine büro-weihnachtsfeier gesetzt. zum glück sind die leute, mit denen ich zusammenarbeite, echt ok, so dass es wohl so schlimm nicht wird.
Ich weiss schon, warum ich versuche, meine texte immer gleich sofort aufzuschreiben, es ist echt total blöd, wenn man morgens aufwacht und genau weiss, dass man soeben eine tolle idee vergessen hat. manchmal stehe ich echt um drei uhr nachts auf und schreibe, wenigstens ein paar notizen, meist gleich den ganze text.
ich wäre sehr gespannt auf den nasenwärmer, meine adresse ist XXXX, 10969 Berlin. Ich hätte da vielleicht auch einen postalischen weihnachtsgruß zu verschicken, wie ist denn deine adresse in der realität der deutsche-post-gottschalk-brüder? (Sind wir überhaupt schon so weit?? dürfen wir einfach das paralleluniversum verlassen? 🙂 )
Ich hörte davon, dass rolli koch schon wieder brutalstmöglich wahlkampf betreibt bei euch, wie schlimm ist es denn? gerade habe ich eine zeitung in der hand gehabt, die ein freund von mir macht, und habe genua-berichte gelesen. das erinnerte mich an deinen genua-text, und er schien mir bei weitem der beste zu sein. die zeitung war trotzdem ganz ok, die haben wohl auch eine internet-adresse, ich schau mal nach und schick sie dir das nächste mal mit. jetzt allerdings muss ich mich sputen, um zu dieser feier zu kommen…
bis bald
s.
Datum: [Dezember 2002]
Betreff:
Hallo M.,
danke, mir geht es sehr gut! ich weiss, du hast nicht gefragt, aber ich wollte das mal loswerden. ich sitze gerade spätabends vor dem computer, habe grasbedingt (und das in mehreren bedeutungen) sehr gute laune, auch begründet durch einen erfolgreichen 10-stunden bibliothekstag (und das ist nicht ironisch gemeint), und dann lese ich eine neue geschichte meiner lieblingsliteratin m.! Juhu! und ausserdem beteiligt sie sich auch noch intensiv an einer von mir initiierten diskussion. zu deinem text nur soviel: er gefällt mir schon, ist aber auch irgendwie anders als sonst – frag mich morgen mal, wieso! den rest schreibe ich gleich in die diskussion, um dein konto aufzubessern (und dem l. mal ein schnippchen zu schlagen- doch dazu später mehr, erst mal die liste, warum es mir so gut geht, weiter auszuführen) und ausserdem hast du mein konto aufgebessert, und ich war sehr glücklich darüber, denn diesen text finde ich inzwischen, ohne eingebildet zu sein, ganz gelungen. dein: es wurde auch mal zeit, dass dieser text hier her gefunden hat, entsprach genau dem, was ich mir dabei dachte – also ein grosses dankeschön! darüber hinaus schaue ich gerade, und das macht mein bild bei dir wahrscheinlich schon wieder zunichte, eine geniale folge der harald-schmidt-show. doch darüber kann man tagelang diskutieren, ob das ok ist, habe ich schon alles durch 🙂
jedenfalls hat mich meine euphorische stimmung dazu bewogen, erstens morgen in ein paralleluniversum zu treten und zur dortigen postfiliale zu gehen, um ein päckchen in die kleisttraße zu schicken. der übrigens, kleist, hat sich vor hundert jahren total verwirrt mit seiner begleiterin hier in berlin im wannsee selbst ertrunken, sozusagen. mehr droht mir wohl beim eintritt in das paralleluniversum auch nicht, höchsten stundenlange warteschlangen in der post – vorweihnachtszeit. aber das ist man ja als ossi gewohnt :-).
Apropos: bei meiner recherche zu dem poetry-slam-referat habe ich rausgefunden, dass die szene, die sich in den frühen neunzigern in deutschland gebildet hat, aus den linken gruppen, um politische spoken-word-literatur zu verfassen, bei ihrer vernetzungsarbeit, also dem gegenseitigen briefe schreiben (selig sei die neue email-kultur), enorm gespart haben, indem sie auf die briefe, die sie sich schrieben, die briefmarken mit einem prittstift von aussen einschmierten. Dadurch konnte man den stempel mit einem feuchten tuch wieder abwischen und die briefmarke noch mal verwenden. clever, oder? aber das nur nebenbei.
zweitens bewog mich meine euphorie dazu, mir selbst ein vor-neujahrs-versprechen zu geben: morgen, am mittwoch ist hier in berlin der letzte slam dieses jahr, und ich werde all meinen mut zusammennehmen und mich dort öffentlich blamieren, ich weiss nur noch nicht genau, mit welchem text, ist ja auch durchaus von der länge abhängig. meine auswahl zur zeit ist […] – ganz okay, aber wohl nicht lustig genug, keine schlusspointe oder so. [….] – wie gesagt einer meiner favourites, aber zu nahe an der szene – da kann ich es mir leicht verderben *g*, oder […] – ganz nett, aber nur nett, richtige länge. oder […], gut, aber wohl zu lang. ich werde dir mitteilen, mit welchem text ich gescheitert bin, wenn ich denn den nötigen mut hatte….
ich hoffe, dieser brief ist dir nicht zu verwirrend…wenn doch, möchte ich dies mit meinem bewußtseinszustand entschuldigen. ich freue mich jedenfalls, dass euch der schlachthof bleibt. […] deine wahl-entscheidungs-begründung finde ich durchaus gerechtfertigt, man sollte wählen generell vom wetter abhängig machen…
ich finde, du nimmst l. zu ernst, wahrscheinlich ernster, als er selbst sich nimmt. ich glaube, er provoziert einfach nur gerne, was ja auch bei dada in den 20ern und bei holländischen provos zum guten ton gehörte. wenn man ein paar zwischentöne von ihm liest, hat er teilweise recht. es ist so, als wenn er dir ein super tolles seltenes und außergewöhnliches auto verkauft, du machst das paket auf und es ist ein trabi drin. und er sagt, wenn du ihn ungläubig anstarrst: „was willst du, das ist doch außergewöhnlich!“ so ungefähr. und du fütterst ihn natürlich dadurch, wenn du sagst, er soll sich verpissen, denn das ist es, was er erwartet. denn er erwartet ja immer eine reaktion, es ist ihm egal, wie die ist, hauptsache jemand reagiert. wenn keiner reagiert, dann schreibt er halt kommentare zu seinen eigenen texten. armselig, aber verschlagen…
zu den anderen leuten kann ich nicht so viel sagen, aber so eine masse von literaten und leuten, die die [Literatur-Website] frequentieren, da sind natürlich auch idioten dabei. die berechtigte frage, die sich dabei stellt, ist ob die [Literatur-Website] als idee dabei in ihrer kreativität und in ihrem fortschritt gehemmt wird. das könnte ich mir schon gut vorstellen.
also, ich werde mich morgen den aliens im paralleluniversum stellen und versuchen, eine friedenspfeife mit ihnen zu rauchen. wenn sie das ablehnen, war es auch für mich schön, dich kennengelernt zu haben. das borg-gehirn wird durch mich dein literarisches schaffen zu würdigen wissen, wenn ich assimiliert bin.
vielleicht ist dieser brief ja schon ein anzeichen von unterschwelliger vereinnahmung durch fremde kräfte.
live long and prosper
s.
Datum: Fri, 20 Dec 2002 19:29:30 +0100 –>
Betreff:
Hallo M.,
du hast recht: in wahrheit bin ich ein spiegel-lesender, harald-schmidt-guckender, echt-hörender pickliger student, der heimlich konsalik liest und mein hund ist auch nur aus stoff. (bekommt man eigentlich probleme, wenn man am flughafen drogen in einem plüschtier schmuggelt und sagt „das ist ein stoffhund“?)
na ja, ganz so schlimm ist es nicht. ich habe bloß in dem moment, als ich den text geschrieben habe, gerade dieses lied gehört, und diese eine zeile finde ich ganz gelungen. es ist ja so, dass man inzwischen wirklich jeden scheiss auf cd hat, weil man es einfach brennen kann.
überhaupt bin ich der unmusikalischste mensch, den es gibt, ehrlich. und auch nicht wirklich festgelegt. musik bedeutet für mich nicht irgendwas identitätsstiftendes oder so, bis auf zwei ausnahmen. die scherben werden für mich immer das größte bleiben, was es je im deutschsprachigen musikbereich gab. na ja, und die andere band ist halt … na, so viele geheimnisse gebe ich nicht in einer mail preis :). deshalb höre ich eben auch alles quer durch die bank. vielleicht nicht echt, aber aus irgendeinem komischen grund finde ich sportfreunde stiller ganz witzig, aber auch nur das, frag mich nicht wieso, denn eigentlich kann ich nichts leiden, was aus münchen kommt.^^
ich habe ja auch nur eingeschränkten fernsehempfang, also altmodisch über hausantenne. da gibt es zum glück kein mtv oder viva, sonst würde mir wohl das musikhören komplett vergehen, viva 2 gibt’s ja nicht mehr, wie ich hörte.
es freut mich sehr, dass dir das päckchen gefallen hat! und doch, die mischa ist aus meiner privatsammlung, doch in zweihundert jahren, wenn der mischa-sammlerwert auf seinem höhepunkt ist, kannst du sie ja verkaufen und dir davon ein ticket kaufen, um mich auf dem mars im altersheim für erfolglose alt gewordene jungliteraten besuchen und vielleicht ein butterbrot mitbringen. Und vielen dank für die text-kritik. Du hast recht, wenn du sagst, dass man nicht die ganze Zeit Bestseller schreiben kann, absolut. das kann nur dieter bohlen, und ihm ist es ja zu gönnen, da er ja sonst nicht viel zu lachen hat. tut es eigentlich weh, wenn sich im kopf ein vakuum befindet? da muss man bestimmt eine ziemlich stabile schädeldecke haben, sonst kracht das ja alles ein, nach innen.
Nun gut, du siehst schon, meine verwirrung hat sich noch nicht so richtig gelegt, der wahnsinn ist noch da, doch das genie lässt auf sich warten… jedenfalls machte ich gerade den briefkasten auf, und da purzelte mir ein kleiner umschlag aus wiesbaden entgegen, was mich ebenfalls sehr erfreute. Doch liebste m., ich glaube nicht, dass dieser durchaus famose nasenwärmer auch nur annähernd für mike krüger reichen würde, mich aber stellt er komplett zufrieden. Vielen Dank! Ist der selbst angefertigt oder in einer teuren Wiesbadener Boutique gekauft, wo es Sachen gibt, die aussehen wie selbst von Hand angefertigt? Übrigens habe ich mich letztens geirrt, Kleist hat sich nicht vor 100 jahren umgebracht, sondern vor schon fast 200. ich bin nämlich gestern durch mitte geirrt, und habe ein schild an einem haus gelesen, das behauptete, das kleist dort mal gewohnt hat. ansonsten war die gegend total doof, nur riesige, protzige wilhelminische bauten, wo jetzt ministerien drin und überwachungskameras dran sind. wenn man jetzt dort wohnen müsste, wäre es kein wunder, wenn man sich im wannsee selbst ersäuft.
du fragst dich wahrscheinlich gerade, ob ich versuche, dir auszuweichen und nichts über den slam zu erzählen. vielleicht war ich ja doch zu feige?
Also, der mittwoch begann damit, dass ich mit dem hund in den grunewald gefahren bin. dort, bei bitterer kälte, konnte ich ungestört von zehlendorfer millionärsgattinen, die sonst dort ihre pudel und möpse ausführen, noch mal die texte durchgehen. ich entschied mich dann dafür, den […] text zu nehmen, denn nachdem ich auf die uhr geschaut hatte, dauerte es schon sieben minuten, ihn vorzulesen. zwei minuten toleranz allerdings konnte ich wohl abziehen, da ich auch damit zu tun hatte, k.[Hund] aus einem wildschweinrudel abzurufen.
dann bin ich zur uni gefahren, um meine 18-20 uhr veranstaltung abzusagen. der vorteil war, dass dies genau die veranstaltung ist, wo ich das referat über poetry slam gemacht habe, also sagte ich einfach, ich müsste feldforschung betreiben.
Tja, und dann war es soweit, ich stand vor der bar, und am eingang wurde ich gefragt, ob ich zu irgendwelchen ermäßigungen berechtigt wäre. ich fragte, wie es denn aussieht, wenn man vorliest, und bekam als antwort einen stempel auf und drei getränkebons in die hand. dies liess mich dann schon wieder gutgelaunt werden, denn wenigstens hat der abend nichts gekostet….
natürlich war ich wahnsinnig aufgeregt, es war auch relativ voll, was aber eher an der begrenzten platzkapazität des raumes lag. vielleicht so siebzig leute insgesamt, eine nette atmosphäre, ebenso die inneneinrichtung. kleine bühne mit standmikro, was auch noch einen wackelkontakt hatte. Dann wurden die regeln erklärt: 15 leute hatten sich gemeldet, also zwei gruppen auslosen. es waren ein paar bekannte gesichter dabei, und nur einer aus jeder gruppe kommt weiter. da war für mich klar, dass die sache gelaufen ist, aber ich war sehr froh, denn so konnte ich meinen auftritt ohne den druck, vielleicht doch noch ins finale zu kommen, genießen.
mein name wurde als vorletzter der ersten gruppe gelost, und die sechs anderen vor mir waren irgendwie ziemlich schnell fertig. also geh ich auf die bühne, der typ, der vor mir gelesen hat, war circa 1,99m gross, so dass ich mich voll strecken musste, um ans mikro zu kommen – nicht anfassen, wegen mit tape repariertem wackelkontakt. da war mir dann auch der erste lacher sicher, sozusagen.
wie ich dann gelesen habe, kann ich nicht beurteilen, es gab ein paar weitere amüsierte reaktionen des publikums, und alles in allem lief es wohl ganz gut. ich habe mich ein wenig geärgert, weil ich in fahrt zu der bar in der bahn noch ein wenig am ende rumgefeilt habe, und dann beim vorlesen meine schrift nicht mehr richtig lesen konnte. der applaus war jedenfalls nicht nur aus höflichkeit, und was für mich am wichtigsten war, ich habe mich nicht unbedingt unwohl gefühlt, weil mir auch keiner das gefühl gegeben hat, dass ich an der falsche stelle war.
Tja, ich habs also getan! Nach mir kam dann ja nur noch einer in der ersten gruppe, und dann kam schon die abstimmung. die war nicht mit punkten, sondern mit applaus, was ich ein wenig schade fand, da man nichts genaues sagen kann. ich wurde nicht erster, was mir klar war, denn wie gesagt, erstens ein paar bekannte gesichter, zweitens wirklich gute poeten – sprich lyrik, und die kommt glaube ich bei solchen sachen immer besser an. ( mein eröffnungsspruch, an dem ich lange gearbeitet habe, war: „Hallo, ich habe euch zwei mitteilungen zu machen, erstens herzlichen glückwunsch, ihr seid mein allererstes publikum. zweitens, traurige nachricht, jetzt kommt prosa“). Und, ohne mich rechtfertigen zu wollen, es gibt natürlich diese bekannten slammer, die ihren fanclub dabei haben.
Nichtsdestotrotz war ich ziemlich zufrieden, hatte so circa den dritten oder vierten platz und freue mich auf die nächste veranstaltung. Allerdings habe ich den schluss nicht ganz mitbekommen, da ich am nächsten morgen (donnerstag) um 8.30 uhr an der uni sein musste (jetzt rate mal, wozu! unisport – tennis- anfängergruppe, und zwar nur, damit du ein weiteres häkchen auf deiner „irgendwie ist dieser typ ganz schön komsich“ liste machen kannst…)
also, ein gelungener abend für mich, es war ein gutes gefühl, da oben zu stehen, es wird nicht das letzte mal gewesen sein, denke ich. Vielen dank auch noch mal an dich, dass du mich dazu ermutigt hast.
Deine e-mail signatur ist auch voll lustig, ich habe erst gelesen „rheinland-hessen“ und dachte, irgendwie kenn ich das doch anders, was haben die denn mit der pfalz gemacht, hat ein bewaffnetes guerillakommando unter der führung von helmut kohl die pfalz gestürmt und zur „freien saumagenrepublik“ ausgerufen?
würde sich denn die buchung lohnen?
also, viele grüße nach wiesbaden, lass dich nicht ärgern und viel glück beim überstehen der weihnachtstage, viele grüße auch an den rest der dreierbande!
bis denne
s.
Über Inspiration, das Schreiben, das (Vor)Lesen, Bücher, Filme, Musik und den ganzen Rest: Von Kriegen und Frieden, und auch vom niemals zufrieden oder je ganz fertig genug sein. Kann Spuren von Drogen enthalten.
Ein einseitiger Briefroman in Fortsetzungen
(2002-2004)
(Zur Vorrede und Teil I hier entlang.)
Datum: Sat, 16 Nov 2002 21:05:51 +0100 –>
Betreff:
Hallo M.,
sorry dass diese Antwort mal wieder etwas gedauert hat, aber ich musste die Kritik erst mal verdauen… Quatsch! Einfach keine Zeit. Denn man höre und staune, ich habe mich mal wieder auf das Pflaster der Großstadt gewagt, nachts, um zu sehen, was da so passiert. Und ich habe einige Entdeckungen gemacht. Es gab in Berlin mal einen Club (was ist ein Club? so heisst hier alles) der hieß eimer. Völlig baufälliges Haus, besetzt mit tollen Partys. Ich dachte bisher, der eimer ist seit Jahren abgerissen, oder wenigstens von der Baupolizei gesperrt. Und letzte Woche erzählt mir ein Freund, dass er dort bei einer Party auflegen wird. Da musste ich natürlich hin. War auch sehr sehr lustig, durch unseren privelegierten Status haben wir dann die meiste Zeit im Backstage-Bereich rumgehangen und Tüten gerollt. Da kommt man dann auch mit den Veranstaltern (alte Hausbesetzer der ersten Stunde) ins Reden, und einer von denen zeigte mir den Hinterhof, sehr schön gestaltet. Doch das überraschende an der Sache war, dass genau auf diesem Hinterhof die Garagen standen, in denen ich vor fast zehn Jahren meine ersten aufregenden illegalen Partys in Berlin, damals noch als „Touri“, feierte. Solche Vergangenheits-Reminiszenzen sind schon ganz cool. Dann gab es noch ein Kicker-Turnier und meine allerbeste Jugendfreundin hatte Geburtstag, und keiner ausser mir war da, um mit ihr zu feiern, weil sie sich nur mit Rockstars umgibt, die ständig touren.*g* Und nebenbei war da ja auch noch die Uni. Doch sei beruhigt, ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, dir nicht geschrieben zu haben…
Sind deine Leute aus Gorleben heil angekommen? Was ich am interessantsten fand, waren die Aufdrucke auf den Castoren: www.kernenergie.de – ein ganz neuer ansatz. Demnächst auf US-Bomben: www.usarmy.gov oder? Wieder ein paar Krümel, die man in einem Text verarbeiten könnte.
Meine Lektüre habe ich noch mehr vernachlässigt als die Korrespondenz mit dir. Man kann halt nicht alles haben.
Ich hab mir meinen Moritzplatz-Text auch noch mal durchgelesen, der tollste ist er wirklich nicht. Du hast schon recht, irgendwie passt er nicht ganz, es stimmt was nicht. Aber ich denke es liegt an der Entstehung, zusammengefrickelt halt. Mal schauen, ob ich ihn umschreibe oder so. Zu Musik-Beeinflussungen und anderen Erlebnissen kommt an diesem Wochenende noch eine Mail, versprochen, doch jetzt muss ich mich der kapitalistischen Verwertungslogik unterwerfen gehen. Es wurde übrigens in deinem Namen bei der [Literatur-Website] Schindluder getrieben – da wagt es jemand, der uns bekannt ist, als M. zu sprechen! Ich hab übrigens noch mal in meinem alten Deutsch-Russisch Buch nachgeschlagen, und auf einmal fielen mir all die Vokabeln wieder ein, die ich mal in der Schule lernen musste. Das nutzte ich dann gleich, um im eimer bei der Party mit einem Saxophonisten aus Minsk Späßchen zu machen. Manchmal nützt es doch was, was man in der Schule lernt.
bis gleich, versprochen!
S.
Datum:
Betreff:
Hallo M.,
was ist denn schiefgegangen? ich hoffe nichts, was man nicht wieder begradigen könnte. Ich stehe übrigens sehr wohl zu meinem hund. ihr name ist k.[Hund], inzwischen ist sie zweieinhalb jahre alt. und du hast recht, mit einem ausgewachsenen alkohol-kater hat sie ihre probleme, weil der kater es nicht so gerne hat, morgens früh aufzustehen.
ich hatte heute einen ziemlich guten tag, weil das wetter hier klasse war. kalt zwar, aber total sonnig. ich war total sonnenstrahlen-high und bin mit dem hund zwei stunden lang am landwehrkanal, der komplett durch kreuzberg läuft, langegangen. nette parks und nette leute. aus dem unterbewusstsein schrie zwar ständig eine stimme „du musst unbedingt jede freie minute für die bibliothek nutzen, weil du in zwei wochen ein scheiss-referat halten musst“, aber das war mir egal. jetzt mache ich mir erst mal einen leckeren kakao mit extra-zutaten und dann werde ich zur gewissensberuhigung noch zu meinem 18-20 uhr seminar gehen, wahrscheinlich…
leider bin ich noch nicht dazu gekommen, mehr zu schreiben. ich fürchte, dass das jetzt wieder ein bisschen abnimmt, zeitbedingt. und was ich ja total hasse ist, dass es jetzt um halb fünf schon dunkel ist. blöder winter!
Ich fand das damals auch gar nicht so toll, russisch lernen zu müssen. eigentlich hatte ich nie probleme mit sprachen, aber das hat mich echt null interessiert. wahrscheinlich weil es aus zwang war, genau wie der geografieunterricht in der sechsten klasse, wo wir jeden fluss und hügel in der udssr auf der karte zeigen können mussten. heute allerdings fallen mir so ab und zu oder in gesprächen wieder ein paar brocken russisch ein, und das wiederum finde ich ziemlich lustig. weil mir die sprache eigentlich vom klang her ganz gut gefällt. und man ist ja unter wessis sowieso der star, wenn man nur kyrillische buchstaben lesen kann :-). aber richtig lernen würde ich es wahrscheinlich nicht mehr wollen, dafür war es dann doch zu kompliziert. doch in einem hatte mein russischlehrer recht: er meinte, wir werden nie wieder das wort „dostoprimelschatjelnosti“ (sieht das lustig aus in der schrift!) vergessen, und das trifft bei mir zu.
Also, irgendwie wird meine kommunikationsfähigkeit gerade von etwas anderem abgelöst, deshalb erst einmal viele grüsse an dich und das bka, das einzige, was mir noch zu wiesbaden einfällt *g*.
Bis bald
s.
Datum: Thu, 21 Nov 2002 22:03:47 +0100 –>
Betreff: Re: ich komme um mich zu beschweren : -)
Sehr geehrte Frau M.,
ein Zitat! Und ich hab es erraten! Oder?! Als weise Literaturwissenschaftlerin werden sie ja wohl denn Betreff ihrer letzten Mail nicht so „mir nichts, dir nichts“ aus der Luft gegriffen, sondern mit Bedacht gewählt haben?! Eine leise Anspielung an den Titel einer Audioveröffentlichung einer Hamburger Musikkapelle, nicht wahr?
Naja, genug mit dem Quatsch, aber irgendwie hatte deine mail so einen ansteckenden Blödelvirus. Anthrax in elektronischer Form? (Wegen diesem Satz wird unser briefwechsel jetzt wahrscheinlich von mindestens drei geheimdiensten überwacht, falls du denen irgendwas mitteilen willst : -)
Die Zeit ist aber auch bei mir schon ganz verkümmert, ich glaube K.[Hund] frisst ihr das Futter weg… Doch letztens blühte sie auf, und entführte mich in das „Vergiss die schlauen Bücher und schreib mal wieder was“-land. war ein netter besuch, vielleicht werde ich dir bald mehr darüber berichten.
Staubsaugervertreter werden wahrscheinlich die Helden in den Sagen über unsere Zeit werden, die man sich später mal so am Plutonium-Lagerfeuer erzählen wird. Mystische Gestalten mit obskuren Riten. Wenn du es schaffst, Zugang zu dieser erlesenen Kaste zu erlangen, vergiss nicht, dass du mich mal gekannt hast. : -)
Was genau sind eigentlich Nasenwärmer? Das würde mich mal interessieren, und gibt es die nur in den grössen s, m, l, xl oder kommen da noch kategorien wie krumm, platt, spitz und mike krüger dazu?
Übrigens noch etwas mystisches in deinem brief: BAföG! ich kannte bisher noch leute, deren ältere geschwister mal mit jemanden zusammen studiert haben, der jemanden kannte, der BAföG bekam. Hihi.
Du siehst deine Mail hat mich auch nicht gerade klar denkend und nüchtern analysierend gemacht, so wie ich es jetzt bräuchte, um mein nächstes referat vorzubereiten (thema übrigens: poetry slams und social beat – hab ich geschickt eingefädelt, oder? das angenehme mit dem nützlichen verbinden, oder wie ging der spruch?)
Obwohl, vielleicht lag es ja nicht nur an deiner mail, vorweihnachtsgemäss habe ich auch noch ein paar plätzchen verzehrt.
ich hoffe, die nächste botschaft von mir wird etwas ernsthafter, denn das ist ja schließlich kein spass hier, nicht wahr!
bis dann
s.
ps. heute mal ohne ps.
Datum:
Betreff:
Hallo M.,
jetzt weiss ich, was ich mir zu Weihnachten (Mein Lieblingsdialog zur Zeit: „Mann, wie schnell die Zeit schon wieder vergangen ist, schrecklich!“ Antwort: „Ich finds gut, schließlich ist in einem Monat Weihnachten schon wieder vorbei!“) wünsche: Nasenwärmer Marke „Mike Krüger.“ Kennst du die legendären Supernasen-Filme?! Leider war ich, als die liefen, noch zu jung, um Drogen zu konsumieren. Das würde ich gerne nachholen, doch leider wird immer nur Sissi wiederholt…
Ich habe auch nichts gegen eine konservative Tüte, aber da in dieser Hinsicht hier das Land des übersprudelnden Vorrats an Milch und Honig ist, nehme ich mir ab und zu auch mal die Zeit, um mit der Sache, die meine Kreativität fördert, kreative Dinge anzustellen: Kakao, Kekse…. Kleine halbwegs passende Anekdote am Rande:
Als ich in Südafrika war, haben wir circa eine Woche vor Abreise in einem kleinen Kaff einen einheimischen Bekannten ein Paar Rand in die Hand gedrückt, umgerechnet so fünfzehn Mark, um Gras zu kaufen. Wir sind zusammen mit ihm in ein Township gefahren (laut sämtlicher Reiseführer wahrscheinlich zu Recht absolute No-go-Area), er ging in eine Hütte, wir waren die einzigen Weißen in einem Umreis von ein paar Kilometern, ein paar Kids kamen an unser Auto, nahmen ein paar Schlucke von unserem Bier und lobten meine Frisur und unterhielten sich echt nett mit uns. Dann kam unser Bekannter aus der Hütte mit einem Packen Zeitungspapier in der Hand. Er meinte ich solle losfahren, was ich auch tat. Auf einmal hörte ich von hinten aus dem Wagen Geschrei, mein Freund hatte das Päckchen geöffnet, und ich dachte, wir wären beschissen worden – absolut blöder Gedankengang, denn es offenbarten sich feinste fünfzig Gramm Gras. Im Endeffekt ein Preis von 30 Pfennig… Damit hatten wir nicht gerechnet, es fiel uns echt schwer, das in einer Woche zu vernichten. Da kam dann die richtige Kreativität zum Einsatz: Salate, Soßen, Grill-Marinaden…. Trotzdem hatten wir am Ende der Woche noch ziemlich viel zu verschenken.
Könnte man fast eine Geschichte draus machen….
Apropos, ich habe gerade einen Text auf meine Seite gestellt, denn ich bei Computer-Aufräumarbeiten gefunden habe. Er ist ok, nicht supertoll, aber ich habe ja wie gesagt letztens einen geschrieben (über das Schreiben), mit dem ich bisher ziemlich zufrieden bin, doch er muss noch ein wenig reifen, bis er ans Licht darf…
Du kannst A. übrigens trösten, als ich in meinen Jugendtagen noch in der Ostsee-Kleinstadt-Drogenprovinz lebte, habe ich mal in einem Haschbrocken (das war damals das einzige, was man so bekam) einen Schnürsenkel gefunden…
Ich schicke dir gerne mein Poetry-Slam-Referat, oder auch die Hausarbeit, die ich dazu noch schreiben muss. Doch das Referat ist erst in einer Woche, und du glaubst doch nicht wirklich, dass ich das jetzt schon fertig, geschweige denn überhaupt richtig angefangen habe :-).
Ich warte gespannt auf deine Bafög-Geschichten, auch wenn sie von was anderem handeln sollten. Ich allerdings werde mir meine Kontoauszüge heute mal ausnahmsweise nicht vorm einschlafen anschauen, da grusele ich mich immer so. Das wäre doch mal übrigens eine nette Idee für ein Helloween-Kostüm: Eine Verkleidung aus Kontoausdrucken! Richtig gruselig! Trotz dieser genialen Idee werde ich wohl nicht an solchen Veranstaltungen teilnehmen… Kannst du mir das Phänomen Karneval in Köln erklären?
Nun gut, für heute war`s das, ich hoffe bald von dir zu hören! Viele Grüße aus der Pleite-Hauptstadt an A. und ihre Schwester, und natürlich auch brutalstmöglich an Rolli Koch.
Bis Bald und Druschba
S.
Über Inspiration, das Schreiben, das (Vor)Lesen, Bücher, Filme, Musik und den ganzen Rest: Von Kriegen und Frieden, und auch vom niemals zufrieden oder je ganz fertig genug sein. Kann Spuren von Drogen enthalten.
Ein einseitiger Briefroman in Fortsetzungen
(2002-2004)
(Zur Vorrede und Teil I hier entlang.)
Datum: [2002]
Betreff:
Hallo M.,
das Buch liegt wohl irgendwo auf dem Dachboden meiner Mutter. Es war (und da kommen wir auch gleich ein wenig auf die Sozialisations-Frage) Teil dieser „Zauberer der Smaragdenstadt“-Reihe. Die waren ja bei uns total angesagt und sehr schwer zu bekommen, zum Glück arbeitete eine Tante von mir damals im Buchladen. Jedenfalls ging es darum, dass eine Hexe nach vieltausendjährigem Schlaf wieder aufwacht, und sie war böse, hatte aber wegen dem langen Schlaf viele ihrer Tricks verlernt und legte dann einen Gelben Nebel auf das Land, um es sich untertan zu machen. Ich hab es wie gesagt lange nicht mehr gesehen, geschweige denn gelesen, und ich weiss nicht, ob ich es tun sollte. Bisher war es immer so, dass sich die Sachen, die diesen mystischen Schleier der Kindheit hatten, sich dann ganz schnell entzaubert haben, wenn man sie noch mal liest.
Deine Schreib-Methode (Schnipselschnipsel) finde ich sehr interessant. Allerdings (Achtung – böse Kritik – wenn du willst, überspring den Absatz) bist du die einzige, die weiss, wie der Herstellungsprozess war. Für jemanden der es nicht weiss, sind es halt nur Worte, die (wahllos?) aneinandergereiht sind. Schon vom Ansatz her so wie du es dir dachtest, auch ich dachte, dass dies sehr nahe an einem Traum ist. Und wie gesagt, die Methode finde ich interessant, doch man kommt nicht unbedingt drauf, dass das mal ein zusammenhängender Text war, was schade um den Text ist. Aber jetzt weiss ich es ja, und wenn ich mal viel Zeit habe, kann ich ja versuchen, ihn wieder zusammen zu setzen. : -)
Ich kann dir leider nicht sagen, was dir an dem Text nicht passen könnte. Aber vielleicht erfüllt er ja deine Ansprüche nicht: So viel arbeit, da muss doch was tolles bei raus kommen. so geht es mir jedenfalls öfter. Ich finde den Text ja wie gesagt auch nicht schlecht, eher im Gegenteil, und jetzt, wo ich weiss, wie er entstanden ist, gefällt er mir noch besser.
Das Problem des „Wie schreibe ich über das, was mal meine Heimat war“ habe ich ja auch. Wie ich vorher schon mal sagte, das ist zu nahe dran an mir, als dass ich unbefangen schreiben könnte, und daher versuche ich es eher selten. Deine Umsetzung gefällt mir ganz gut, das märchenhafte. Aber es passt glaube ich nicht ganz zu meinem Stil : -)
Würdest du noch mal zurückgehen wollen nach Workuta, um zu schauen, wie es ist? Ich glaube, ich würde es nicht machen wollen. Es ist besser, eine persönliche Erinnerung zu haben, die so aussieht, wie es eben ausgesehen hat, als du mit acht da weg bist. Oder?
Für mich ist in erster Linie gar nicht so wichtig, dass ich im Sozialismus aufgewachsen bin, obwohl es auch eine grosse Rolle spielt. Wenn ich heute erwachsene Menschen sehe, die sagen wir mal laut Definition 18 Jahre alt sind, und damit zum Fall der Mauer fünf Jahre alt waren, finde ich das schon irgendwie beängstigend. Das sind wirklich komplett andere Menschen als ich, und dann komme ich mir irgendwie alt vor, so wie sich wahrscheinlich mein Opa immer vorgekommen ist, als er Geschichten aus dem Krieg erzählte… Gerade hier in Berlin gibt ja kaum einer was darauf, wo du herkommst, hier kann man sich sowohl als Ossi als auch als Wessi ganz gut tarnen, aber es gibt eben Situationen, die dann der Ossi nicht versteht (Konversation auf einer Party spät abends über Herrn Rossi, der das Glück sucht – Wer bitteschön ist das? Bei uns brauchte man das Glück ja nicht zu suchen….) oder eben auch der Wessi nicht versteht (Pittiplatsch – obwohl die meisten meiner aus linken Lehrer- und Sozialarbeiterfamilien stammenden West-Bekannten versichern, dass sie den Ost-Sandmann viel lieber mochten…)
Naja, und der Sozialismus – ich habe ihm auf alle Fälle viel zu verdanken. Ich habe gerne für die Freiheit Mandelas und Chiles Altpapier gesammelt, und ich bin ehrlich gesagt sehr froh darüber, atheistisch erzogen worden zu sein. Und wo wir schon dabei sind, ich finde auch viele Werte, die man mir beigebracht hat, immer noch gut. Aber: Das was ich am meisten schätze ist, dass ich gemerkt habe, wie manipulierbar der Mensch ist, gerade als Kind. Am eigenen Leib erfahren, schließlich war ich ja überzeugter Gruppenratsvorsitzender. Ich denke, ich hatte genau das richtige Alter, als die Mauer fiel, um noch bewusst mitzubekommen, was da alles lief. Und das haben wir den Westdeutschen doch voraus: Wir haben zwei politische Systeme am eigenen Leib erfahren, ganz zu schweigen von den Wirtschaftlichen Systemen (Zwei Währungsreformen innerhalb von 12 Jahren – nichts leichter als das..).
Dazu gibt es noch viel zu sagen, aber ein wenig muss ich ja noch für den Roman übriglassen : -)
Zum Schreiben: Ich bin da auch nicht wirklich festgelegt, das Ritual ergibt sich eher von selbst. Und nachts konnte ich auch schon früher meine Jugendgedichte viel besser schreiben. Allerdings mache ich mir inzwischen viel mehr Notizen, so wie du meintest, in Seminaren oder so, weil ich zu viel interessante Sachen vergesse. Ob die allerdings dann auch alle in die Texte einfliessen, so wie ich mir das denke, wenn ich sie beobachte, ist eine andere Sache. Wie gesagt, die Stimmung!
Ich glaube, du solltest deine Selbstanalyse in einen dunklen Keller sperren und nur ab und zu mal rausholen… Ich kenne das, wenn man sich selbst runterredet, und es ist ja in gewissem Maße auch vonnöten, aber es kann auch blockieren. Apropros – auf Eis liegen ist genau die richtige Umschreibung, sowohl zu meinen Vorlese-Plänen als auch zu neuen Texten von mir. Denn dummerweise hat mein „chef“ sich zwei Wochen Urlaub für Flitterwochen genommen, und bei einem zwei-Mann-Betrieb fällt es mir schwer, Zeit zu finden. Aber das dürfte hoffentlich bald vorbei sein. Derweil freue ich mich, wenn ich nach Hause komme, es mir mit einer Tüte gemütlich machen kann, und vielleicht eine nette Mail im Posteingangsfach habe. Ans Schreiben und Lesen denke ich zwar schon oft, aber das endet dann damit, dass ich um 4 oder fünf zum schlafen komme, was doof ist, wenn man um 9 wieder fit sein muss. Auch ein Nachteil am „nachts schreiben“.
Zu der [Literatur-Website]-Diskussion nur ganz kurz:
Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so, wie in einer Familie. Und jetzt ist eben die Pubertät dran, wo man die Eltern scheisse finden muss. Ich lass mir das noch mal durch den Kopf gehen…
A. und S. haben übrigens recht, was Kerouac betrifft. Sein größter Hit war wohl „On the Road“ dt: Unterwegs. Zum Einstieg würde ich „Engel Kif und neue Länder“ empfehlen.
bis bald
S.
Datum: [2002]
Betreff:
Hallo M.,
klar verzeihe ich dir :-)! Mein Stress ist zum Glück gerade vorbei, und wie es immer ist, die Erkältung, die von den Stresshormonen in Schach gehalten wurde, ist ausgebrochen. Tja, man kann nicht alles haben. Aber immerhin habe ich es geschafft, was neues zu schreiben, wenn es auch nicht genau das ist, was ich wollte.
Deinen Genua-Text hätte ich fast übersehen, da ganz schnell viele andere Leute auch was neues zu der [Literatur-Website] gestellt hatten. Ich fand ihn sehr gut. Realismus – mal was ganz anderes von dir. Aber er hat mir echt gefallen, obwohl ich ihn wohl noch ein zwei mal lesen muss. Was ich gut fand, war dass er nicht irgendwie pathetisch war oder so, sondern wirklich wahr. Dass du genau das beschrieben hast, was passierte, wie du dich fühltest, wie du auch über alles dachtest, auch nicht versteckt hast, dass die Gefühle dich überrannt haben, dass es schon toll ist, zu einer verschworenen Gemeinde zu gehören, die eigene Gesetze hat… Echt gut, ich glaub ich muss ihn gleich noch mal genau lesen :-). So ähnlich ging es mir auch bei meiner ersten 1. Mai-Demo in Berlin vor fünf Jahren oder so.
Inzwischen bin ich von solchen Veranstaltungen, also nicht Genua, sondern dem Berliner 1. Mai, eher abgetörnt, weil es wirklich nur noch ein Spielplatz für agressive Kiddies und eine optimale Manöver-Übung für die Bullen ist. Genua – das kannst du auf alle Fälle später deinen Kindern erzählen. Oder vorlesen.
Sorry auch für meine kurze mail, aber wie du meintest, es ist Wochenende, und ich muss mir wie gesagt noch mal deinen Genua-Text durchlesen und habe zweitens eine brennende Idee für einen Text. Und muss meinen neuen Text noch auf meine homepage stellen. Ich kann dir nur zurufen: Weiter so! Das war sozusagen odschen choroscho. hihi.
bis bald
s.
ps. bestell a. mal ein paar herzliche verspätete geburtstagsgrüsse und sag ihr, ich beneide sie um die zwanzig stripperinnen.
pps. villeicht lüftest du in der nächsten mail mal das Geheimnis deiner verschiedenen namen?
Datum: [2002]
Betreff:
Hallo M.,
also erst einmal vielen Dank für deine gute Laune, die dich zu Übersprungshandlungen in Form von total-nette-Kommentare schreiben gebracht hat. Und dann natürlich herzlichen Glückwunsch zu der guten Befindlichkeit, ich hoffe da ist jetzt am Wochenanfang noch was von über.
Und um dein Ego noch ein wenig zu erfreuen, ich hab wie gesagt den Text noch mal gelesen, in ruhe, und er ist echt gut, du solltest die Projekte „abgebrochener Fingernagel“ und „Scheisse ich find kein Paper mehr“ weiter verfolgen. Sind ja beides auch echt harte Schicksalsschläge, besonders das letztere. Es wurden schon Bücher über Belangloseres geschrieben.
Mein neuer Text ist hier:
Er ist entstanden aus vielen zusammengetragenen Notizzetteln, die sich schon gehäuft haben, ich bin aber nicht absolut zufrieden, weil ich noch einiges über hatte, aber nicht genug Geduld, es mit in den Text zu bringen. Vielleicht kommt ja noch ein zweiter Teil. Mal schauen. Vielen Dank übrigens dafür, dass du dir gerade die beiden Texte zum kommentieren ausgesucht hast, die waren für mich schon „alt“, hab sie lange nicht gelesen und daraufhin dann wieder, und fand sie trotzdem wieder einigermaßen gelungen. Liest du oft alte Sachen von dir?
Meine Lektüre beschränkt sich auch fast nur auf die Uni, obwohl ich das nie ganz durch halte, dazu lese ich zu gerne. Zur Zeit lese ich „Geschichten ohne Heimat“. Ich weiss aber nicht, ob ich es dir empfehlen sollte. Nicht weil es nicht gut ist, sondern vielleicht nicht dein Stil – das ist zwar blöd formuliert, aber ich weiss nicht, wie ich es dir besser beschreiben soll. Es hat was mit Nostalgie zu tun. Der Autor, Erwin Strittmatter, war ein relativer bekannter Schriftsteller in der DDR. Nicht so wie jetzt Grass, eher drei Nummern kleiner. Aber er schrieb eine Trilogie (Der Laden) über seine Kindheit und Jugend auf einem Dorf in der Lausitz vor so 80 Jahren. Und in dem Nachbardorf habe ich einen grossen Teil meiner Kindheit verbracht. Das fand ich sehr spannend, und ich habe die Bücher schon mit so elf, zwölf Jahren verschlungen, sind halt auch ganz gut geschrieben, wenn man die Art mag. Und jetzt wurde eben aus seinem Nachlass „Geschichten ohne Heimat“ veröffentlicht. Eher so eine Insider-Sache, man erkennt sehr viel wieder aus den anderen Büchern, sollte sie glaube ich auch vorher gelesen haben. Soviel dazu.
Dann lese ich noch, da muss ich mich fast als bürgerlich outen, den neuen Spiegel sehr interessiert. Ich hab den zum Studi-Preis abonniert, weil wie du vielleicht ja weißt, ich keine Tageszeitung habe, und schon ein bisschen informiert sein will. Und leider reissen die Stürme zur Zeit ständig unsere Antenne vom Dach, so dass ich die RTLII-Nachrichten verpasse :-). Und der Spiegel trauert auf 170 Seiten. Erst dachte ich, ja, is ja traurig dass der Augstein tot ist, aber 170 Seiten, das is doch n bisschen viel, oder?! Aber dann fand ich es noch fast zu wenig, da sind schon ziemlich viele spannende Geschichten und Interviews drin. Da ich als privilegierter Student der Hauptstadt den Spiegel schon am Sonntag bekomme, bin ich auch schon durch. Etwas peinlich, diese bürgerliche Ader in mir :-).
Wegen diesen Demo-Geschichten, und des bürgerlichen Schleiers, der auf mir liegt:
Ich find Gorleben und Genua echt wichtig und würde auch heute noch überlegen, wie ich es damals vor Genua tat, hinzufahren. Ich hab auch zwei Jahre lang im Asta gearbeitet, das ist so zwei Jahre her, und fand es gut, habe viel gelernt über Politik auch im grossen Stil, und dabei eben auch schon viele Enttäuschungen erlebt, doch das gehört dazu. Ich würde das meiste heute wieder tun. Zum Glück gab es bei uns im Asta die Regel, dass man sich nur einmal wiederwählen lassen kann, weil ich auch finde, dass man in solchen Strukturen nicht hängen bleiben darf. Das sehe ich an der FU, da sind seit fünf Jahren die gleichen Leute am Werk, dass ist auch blöd.
Naja, du hast jedenfalls meine aufrichtige Hochachtung wegen Genua. Und es gibt auch in Berlin noch gute Demos, wo ich gerne hingehe, die „Reclaim the streets“ sind immer voll lustig im Sommer. Aber der erste Mai nervt halt, weil sich da im Vorfeld schon mindestens fünf Splittergruppen streiten, wessen Demo denn zuerst verboten wird. Und ob es cooler ist, im Prenzlauer Berg oder in Kreuzberg sich von Bullen verprügeln zu lassen. Da gibt es auch hinter den ganzen vorgeschobenen Argumenten kaum noch wirklich politische Motive für die Demos.
Ich sende dir und deinem Garten viele Grüsse und viel Sonne, von der es hier leider nicht so viel gibt.
Bis dann
S.
PS. Hast du eigentlich Formatierungs-Probleme beim Einstellen der Texte bei der [Literatur-Website]? Bei mir erscheinen da immer so blöde Fragezeichen statt Bindestriche oder Anführungszeichen.
(10.4.21)
Auf dem Papier bin
ich für mein Alter
ein unbeschriebenes Blatt.
Über Inspiration, das Schreiben, das (Vor)Lesen, Bücher, Filme, Musik und den ganzen Rest: Von Kriegen und Frieden, und auch vom niemals zufrieden oder je ganz fertig genug sein. Kann Spuren von Drogen enthalten.
Ein einseitiger Briefroman in Fortsetzungen
(2002-2004)
(Zur Vorrede und Teil I hier entlang.)
Datum: Mon, 21 Oct 2002 11:21:27 +0200 (MEST)
Betreff: Re: -no subject-
Hallo M,
der einzige wirkliche Surfpoet von denen ist glaube ich Ahne. Kaminer und Jakob Hein gehören eher zur „Reformbühne Heim und Welt“. Aber da erkennt man schon das Dilemma, manchmal kann man sie nicht auseinanderhalten, die treten ab und zu auch zusammen auf und besuchen sich gegenseitig bei ihren Veranstaltungen. Und bei dieser Konkurrenz wirst du dir denken können, ist die Überwindungskraft selbst aufzutreten, noch größer.
Das mit dem Wettbewerbscharakter finde ich auch nicht so toll, vor allem weil ich finde, dass wenigstens sagen wir mal in jedem Genre eine Bewertung stattfinden sollte. Man kann doch nicht den MC Freestyler Soundso, der wirklich einen guten Auftritt hinlegt, mit einer lustigen Geschichte von Ahne vergleichen. Trotzdem passiert das hier halt manchmal.
Und wenn man wie du in die Endausscheidung kommt, ist das doch schon ganz gut. Du weißt doch, der olympische Gedanke : ) Du hast aber recht, gänzlich ohne Wettbewerb wäre besser, aber der plebs will halt auch Spass.
Hinterkaffingen finde ich ein schönes Wort. Ich wohnte ja selbst in einem Hinterkaffingen, bevor ich nach Berlin zog. Jetzt allerdings, fünf Jahre später, könnte ich mir nicht vorstellen, woanders in der BRD zu leben. Vielleicht noch in Hamburg, wegen meines Hans-Albers-Gens, das mich immer zum Meer zieht, und dass sich in Berlin immer meldet und sagt: „Wage es, in diesen Süsswassertümpel zu steigen! Das ist böse!“ Wenn ich eine Wanne hätte, würde ich wohl einmal pro Woche, um das Hans-Albers-Gen zu befriedigen, ein Wannenbad mit Salzwasser nehmen. Aber das nur nebenbei. Ich glaube auch, Hamburg ist zu schnöselig und zu teuer. Ein paar Freunde von mir wohnen dort, und zwar recht sparsam.
Ehrlich gesagt ist Berlin wirklich toll, doch wenn man eine Weile hier lebt, dann bekommt man das nicht mehr mit. Und wenn man schon länger in Berlin wohnt, dann wird es noch schlimmer. Ich merke das langsam auch an mir. Es schleicht sich das berühmte „früher war alles besser“ ein. Natürlich war das ja auch so. Viel mehr besetzte Häuser, illegale Kneipen und Clubs…
Doch sei gewarnt, das Angebot hier ist wirklich riesig, aber alles kostet auch was. Ich muss sagen, ich bin ausgehfaul geworden. Gerade bei dem Wetter. Aber ich sitze dann manchmal zu Hause in meinem stillen Kämmerlein und freue mich darüber, dass ich theoretisch die Möglichkeit hätte, zu vielen tollen Veranstaltungen zu gehen. Gestern waren meine beiden Alternativen „Heim & Welt“ mit Kaminer und Co und das einzige Deutschlandkonzert von Bruce Springsteen : )
ich blieb zu Hause, Gründe waren Regen, Unentschlossenheit, Geldmangel und leichter Gripperückfall. Und eigentlich mag ich Bruce Springsteen gar nicht so sehr.
Selbstkritik kann in Überdosierungen schädlich sein. Ich habe zum Beispiel selten einen Text über sieben Seiten geschrieben. Ich würde gerne mal eine Art Roman schreiben, aber dafür bräuchte ich Zeit und Abgeschiedenheit. Weil ich so schreibe, dass alles in einem Rutsch runtergeschrieben wird. Ohne Zwischenstörungen. Ganz selten habe ich einen Text unterbrochen geschrieben. Wie machst du das? Ich finde übrigens nicht, dass du dich in Selbstmitleid badest und deine Texte langweilig sind. Es gibt da ein ganz einfaches Kriterium: Gut oder schlecht. Das ist zwar subjektiv, aber ich denke, du bist eindeutig auf der guten seite.
Das gegenseitige Über-Texte-Diskutieren fehlt mir wahnsinnig. Ich glaube, das bringt wirklich sehr viel. Und da könnt ihr von großem Glück sprechen, euch gefunden zu haben. Und es muss ja nicht der gleiche Stil sein. Wenn du dich unwohl fühlst, Gedichte zu schreiben, dann lass es. Ich habe auch so vor zehn Jahren Gedichte geschrieben. Manche finde ich immer noch gut, aber diese Phase ist bei mir vorbei, das ist für mich wieder die Gefahr des „zu persönlich“.
Es ist natürlich eine Bereicherung in Berlin zu wohnen, aber auch eine Gefahr. Es ist erst mal eine anonyme Großstadt. Es stinkt, es regnet und man hat keine Freunde. Wenn man studiert, dann findet man zwar schnell, sagen wir mal, Bekannte, aber richtige Freunde… Ich hatte das Glück, mein Studium zu beginnen, als die große Uni-Streik-Welle war. Da war zwar keine Uni, aber die Leute fanden schneller zueinander. Das war meiner Meinung nach auch das einzige Ergebnis des Streiks, und dafür hat es sich gelohnt : )
Wart ihr denn schon mal für ein Wochenende oder so in Berlin? Vielleicht fangt ihr ja mal mit so einem Schnupperkurs an.
Wie bist du eigentlich auf die [Literatur-Website] gestossen? Und kennst du andere Seiten, die ähnlich (gut) sind? Inzwischen stapeln sich bei mir die bei amazon bestellten Bücher, weil ich immer nur „netzliteratur“ lese.
helle grüsse aus dem grauen Berlin
s.
ps. der urlaub war in Südafrika, ich war schon zweimal dort, und hoffe, nächstes Frühjahr wieder hinzufahren. Eine Freundin von mir hat dort studiert und lebt inzwischen da mit mann und kind…
Datum: [2002]
Betreff:
Hallo M.,
auch von mir diesmal nur eine kurze mail, muss noch was lesen über Städte und deren Verhältnis zu Königen im Spätmittelalter, wahnsinnig interessant : (, und ausserdem wartet noch das Highlight der Frankfurter Buchmesse, die >Zonenkinder<, darauf, gelesen zu werden.
Also ich denke nicht, dass du zu hart mit i. umgegangen bist. Ich hab ja nix gegen Kritik, aber die Form fand ich echt schwach.
Das mit Südafrika fing damit an, dass eine Freundin von mir dort zum studieren hingegangen ist. Dann haben wir sie dort vor drei Jahren das erste mal besucht, also keine organisierte Reise, nur Flug gebucht und mal schauen was man so machen kann. Natürlich wurden vorher unzählige Reisebücher gewälzt, die alle einen sehr gemischten Eindruck hinterliessen. Nach dem Motto: Schön, aber sehr gefährlich. Als Beispiel sollte man dort nie die Türen während der Fahrt unverriegelt lassen, also immer Knöpfchen runter. Aber als wir ankamen, war alles ganz anders.
Dazu später mehr, sorry für die Kürze, doch die Zeit drängt leider.
Viele Grüsse aus dem blöden Uni-Alltag
S.
Datum: [2002]
Betreff:
Hi m.,
und weiter geht’s. Wie kommst du eigentlich darauf, bwl und jura als nebenfach zu studieren? Wenn bei uns idioten an der uni rumlaufen, dann bei jura. obwohl ich denke, dass die humboldt-uni, wo ich studiere, noch ganz gut ist, im vergleich zur fu und tu. immerhin gibt es in berlin ja genug unis und fh`s für ca 130.000 studis. was allerdings für die aufhebung der anonymität nicht gerade förderlich ist …
zu südafrika: das wichtigste war wohl, dass wir eben keine organisierte reise gemacht haben. erst campierten wir in der wohnung von unseren bekannten, lernten deren südafrikanische freunde kennen, und dann zogen wir gen kapstadt. das waren so circa 800 km luftlinie, nicht so viel für 3 wochen. auto gemietet und mit ein paar guten Tipps ausgerüstet losgefahren. gerade in der gegend wo wir waren, die südküste sozusagen, auch garden route genannt, ist es sehr westlich-europäisch, aber es gibt auch in jedem kaff einen backpacker – eine supernette art zu reisen. wir hatten viel sonne, meer, wilde tiere und nette leute um uns rum, und die zeit verging viel zu schnell.
im jahr drauf bin ich mit einem freund dann noch mal runter, das war im märz/april 2001. da haben wir die gleich tour gemacht, aber noch mehr abstecher und leute kennen gelernt. es ist ja gerade politisch gesehen sehr interessant – schließlich ist die apartheid keine 10 jahre vorbei. wenn man überlegt, wie vergleichsweise friedlich die leute sind, dafür dass sie vor kurzem noch wie sklaven behandelt wurden. und jetzt zu beobachten, wie sich die verschiedensten menschen neu arrangieren müssen, ist schon sehr spannend. ausserdem haben wir auch noch viel bessere grasquellen als beim ersten mal erschlossen, so dass das fahren im linksverkehr auf menschenleeren staubpisten noch spannender wurde : ).
na ja, und eigentlich plane ich und meine bessere hälfte für den nächsten februar wieder runterzufliegen, diesmal eher den Norden, wo wie man sagt noch mehr afrika ist. leider siehts mit dem geld noch nicht so aus, als ob es klappen würde, mal schauen. muss ich noch irgendwoher eine gutbezahlte kolumne bekommen […]
doch was echt nervt, besonders in kapstadt, sind die deutschen pauschaltouris. die sind echt überall, und südafrika boomt ja inzwischen bei den reiseunternehmen. gut für das land, aber auch schade drum.
mein schaffen ist mal wieder zum erliegen gekommen, aber zum glück liegts nur an zu viel uni, zu viel arbeiten und zu viel schlechtem wetter, und nicht an einer blockade. allein schon, dass ich wieder an der uni bin und jeden tag studenten um mich rum habe, birgt stoff für die nächsten fünf texte, hihi.
ich hoffe dir geht’s ein wenig besser, viele grüße an den rest des terzetts! in der nächsten mail erzähle ich dir vielleicht, was ihr alles verpasst habt, als ihr in der osloer strasse wart.
ich muss jetzt kohlen schippen gehen. bibber! Und ausserdem hat ein lustiger Herbststurm, der an der Ostseeküste wunderschön ist, hier wieder lauter bäume auf die strasse geschmissen.
bis bald
s.
Datum: [2002]
Betreff:
Hallo M.,
war dann wohl ein missverständnis, du hattest irgendwas geschrieben von wegen bwl/jura als nebenfächer na dann prost! – womit du natürlich total recht hast, und ich dummerweise gefolgert habe, dass du davon betroffen wärst. was ja aber zum glück nicht der fall ist! ich glaube auch, dass die leute da während der vorlesungen einer gehirnwäsche unterzogen werden, ohne scheiss!!
ethnologie hört sich da schon besser an. ich studiere hier im nebenfach „europäische ethnologie“, was im grunde genommen praktische kulturwissenschaft ist, man nennt es auch anthropology at home – das ist ganz witzig. Ansonsten hab ich noch politik als nebenfach und halt geschichte – soviel zu den formalitäten, hihi.
Dein neuer Text, ich hätte ihn fast verpasst, ich checke zur Zeit aus mangel an derselben immer nur die neuesten texte und diskussionen, leider keine muße gerade, ist irgendwie verwirrend (das ist keine wertung). anfangs fiel mir dazu spontan eines meiner lieblings-kinderbücher ein, was ich schon seit 15 Jahren nicht mehr gesehen hab. es heisst „der gelbe nebel“, vielleicht kennst du es ja auch, ist glaube ich von alexander wolkow oder so (wie bewusst bist du eigentlich russisch sozialisiert? ist das eine doofe frage? ich finde nämlich schon, dass meine ddr-sozialisation auch und gerade auch auf meine texte grossen einfluss hat.).
Dann aber entglitt ich dem text, oder er mir. Damit hast du das traumhafte ganz gut umgesetzt. schön, irgendwie
Ich habe einige textideen ständig im kopf, und lustigerweise gerade auch eine übers schreiben. weil ich den prozess sehr interessant finde. bei mir ist es wie ein ritual.
ich bin vor einigen jahren auf jack kerouac gestossen, ich weiss nicht, ob er dir was sagt. seitdem bewundere ich ihn sehr, da mir sein stil und seine sprache unheimlich gut gefallen. und gerade vorgestern habe ich bei einem seminar, dass ich gerade über „social beat“ und slam poetry besuche, herausgefunden, dass er wohl ähnlich vorging wie ich – dem muss ich unbedingt weiter nachgehen.
na ja, ich schweife total ab, tschuldigung. Also, ich brauche unbedingt ruhe und ungestörtheit, die gewissheit, dass mich keiner stört in der nächsten stunde oder so. und dann habe ich wie gesagt immer ein paar ideen im kopf. wenn die sich dann irgendwann irgendwie zusammenspinnen, setzte ich mich hin, unterstütze das zusammenspinnen der gedanken und ideen noch mal ganz in ruhe mit einer tüte oder einem leckeren kakao, und dann geht es los. dann muss ich die geschichte aufschreiben, möglichst ohne unterbrechung. fast so eine art schreib-rausch. das passiert dann meistens auch nachts. und eigentlich werkel ich dann auch nicht mehr viel dran rum, ich lese nur ein paar tage später noch mal drüber, und dann ist es fertig. deswegen stelle ich mir das „grosse werk“ – den roman, der uns beiden noch fehlt ; ), auch sehr schwierig anzufertigen vor. denn dann müsste ich mich wirklich für ein paar monate komplett absetzten. nicht dass ich keine lust drauf hätte, aber diese möglichkeit hat man als abhängig beschäftigter student ja kaum.
was waren denn die interessantesten vorgehensweisen in deinem seminar? das ist echt ein spannendes thema. und wie gehst du vor, nur kurzgeschichten in der Bahn? das mit dem faden verlieren ist auch ein grund für mich, nur in einem rutsch zu schreiben, da es bei mir auch so ist, dass ich versuche, dem text eine bestimmte stimmung zu geben, mehr unbewusst, und man halt meist in zwei verschiedenen stimmungen ist, wenn man mit unterbrechung schreibt. verstehst du was ich meine?
die bäume sind übrigens alle zersägt.
stehen wahrscheinlich schon bei ikea.
die ärmsten.
bis bald
s.
ps. entschuldige bitte noch mal, dass ich annahm, du würdest jura studieren.
pps. was meint das fragezeichen im betreff?
29.04.10
Man könnte sich gut damit beruhigen,
dass das ja alles nur eine Illusion ist,
dass wir in irgendeinem schrägen
Coen-Brüder-Film leben.
Dass das ja gar nicht sein kann,
mal ehrlich: Westerwelle, Guttenberg,
Milliardenhilfen für Banken
oder Griechenland.
Kann doch gar nicht real sein.
Wenn da nur nicht ständig
irgendwo
Soldatensärge landen würden.
Über Inspiration, das Schreiben, das (Vor)Lesen, Bücher, Filme, Musik und den ganzen Rest: Von Kriegen und Frieden, und auch vom niemals zufrieden oder je ganz fertig genug sein. Kann Spuren von Drogen enthalten.
Ein einseitiger Briefroman in Fortsetzungen
(2002-2004)
[Vorrede:]
Manchmal, wenn man sich vor etwas drückt und deshalb aufräumt, zur Not halt auch Festplatten, fällt einem unverhofft etwas längst Vergessenes (oder verloren Geglaubtes) in die Hände und man wird wehmütig und nostalgisch (oder man findet ein besseres Wort dafür):
Fragmente eines Briefwechsels, bis auf wenige Ausnahmen (Kürzungen, Anonymisierung, Ausbesserung grober Schnitzer, Zeilenumbrüche) unbearbeitet. Auch eine Art Tagebuch eigentlich: ein Blick in die Zeit vor 20 Jahren und eine ganz andere Welt. Die besseren Parts sind nicht von mir, weswegen ich sie hier nicht bringen kann, leider.
Wir lernten uns über eine Literatur-Website kennen, die es schon sehr lange nicht mehr gibt, die es aber immerhin zu drei gedruckten Anthologien (soweit ich weiß) gebracht hat. Hier soll sie nur [Literatur-Website] genannt werden. Deshalb ging es auch viel und hauptsächlich ums Schreiben, unseres und das der anderen. Aber auch um so viel mehr.
Es waren die wilden, guten alten Zeiten des Internet, welches gerade noch wie frisch aus dem Ei gepellt daher kam. Auf keinen Fall hat man sich damals mit fremden Menschen – „Online-Bekanntschaften“ – verabredet, oder ist gar zu ihnen ins Auto gestiegen. Und heute gibt es Uber samt seiner räudigen Klone und in Berliner Co-Working-Spaces werden am Macbook bei einem Chai-Latte jeden Tag zehn neue Dating-Apps erfunden.
Da wir nichts auf Konventionen und Regeln gaben in unserem jugendlichen Übermut – so viel sei schon mal verraten – trafen wir uns doch irgendwann, besuchten uns gegenseitig. Und verloren uns wieder aus den Augen. Warum eigentlich – und warum eigentlich nicht? Story of my life.
Falls du das hier auf irgendwelchen kruden Umwegen zu lesen bekommen solltest, liebe M.: Ich hoffe es geht dir gut!
Falls du denkst, das ist zu gefährlich nahe an einer Enthüllung: Gib mir nur ein Wort. Meine alte Mailadresse funktioniert allerdings wegen des blöden Punktes nicht mehr, aber hier gibt es ja genügend Kontaktmöglichkeiten.
Und entschuldige die modifizierten Wir sind Helden-Zitate. Hehe!
Disclaimer: Sollten in diesem Werk illegale Aktivitäten geschildert werden, die trotz der 20-Jahre-Frist noch strafbewährt wären, dann handelt es sich hierbei natürlich um ein rein fiktionales Werk.
Der Einstieg ist recht abrupt, das hat er mit dem Ende gemeinsam.
* * * * *
Datum: Montag, 23. September 2002 2:03 am
Betreff: re: inspiration
hallo,
geht mir doch schon genau so. ich hab zwar viele texte, die sind aber alle schon ein paar monate alt, und so toll sind sie auch nicht. (oje- jetzt kommt zu der schaffens- auch noch ein sinnkrise). bei mir war es eh so, dass ich spontan geschrieben habe, ohne grosses künstlerisches herumfeilen.
dann kam nichts mehr, und dann habe ich urlaub gemacht, was genau gar nichts gebracht hat. ich dachte wunder was ich für zeit habe, aber die ging auch ohne zu schreiben problemlos vorbei.
wenigstens habe ich was gutes gelesen. mir geht es auch so, dass mir ab und zu ein paar vereinzelte ideen kommen, deren zusammengefüge aber wie von dir beschrieben dann eher eine zwangsjacke wäre. ich habe das gefühl, zur zeit alles wichtige gesagt zu haben, jetzt müssen irgendwann neue herausforderungen kommen oder so. sollte man so eine blöde blockade akzeptieren oder bekämpfen, was meinst du?
frohes schaffen
s.
Datum: Sat, 28 Sep 2002 13:48:15 +0200 (MEST) —
Betreff: Re: re: inspiration
hallo m.,
du wirst es kaum glauben, aber ich habe wirklich ernsthaft darüber nachgedacht, mit dem tennisspielen anzufangen, schon bevor du mir den tip gegeben hast…
als ich angefangen habe zu schreiben, vor langer zeit, habe ich es aus dem einfachen Grund der realitätsbewältigung gemacht. dann aus spass. und als ich auf die [Literatur-Website] gestossen bin, einerseits aus spass, andererseits kann ich ehrlicherweise nicht verleugnen, dass auch gewisse ambitionen dahinter steckten. es war (fast) das erste mal, dass ich meine texte nicht nur für mich geschrieben habe. und prompt in dem augenblick, wo ich das realisierte, kam ich ins stocken. ich warte auf echos, die aber nicht kommen…
zur zeit überlege ich, ob ich noch mehr in die öffentlichkeit gehe, vorlesen… da gibt es in berlin ja eine etablierte szene inzwischen, doch ich weiss nicht, ob ich das kann, ob ich das will und ob sich meine texte dafür überhaupt eignen.
naja, was das bücher-thema betrifft: ich finde es schon cool, meinen text auf papier zu lesen, auch wenn es nur die [Literatur-Website]-anthologie ist. Mein problem zur zeit ist eher, dass die schubladenzuordnung nicht so ganz passt.
jetzt habe ich erst mal meine homepage neu gestaltet, zur ablenkung. ein paar neue texte, neues design, spielerei eben. man denkt, man macht es für sich, da ja eh keiner sich je dorthin verirren wird, aber insgeheim hofft man doch auf kommentare, genau wie bei der [Literatur-Website]. ich muss wohl noch mal in mich gehen und genau erforschen, wie stark meine exhibitionistische ader ausgeprägt ist – und das ergebnis dann respektieren und dementsprechend handeln.
jetzt werde ich erst mal die wohnung auf den kopf stellen und nach inspiration suchen, um dann einen erneuten versuch zu starten. wenn`s nicht klappt, rufe ich mal bei air mongolia an und frage wann der nächste flug geht.
was ist eigentlich der unterschied zwischen der mongolischen volksrepublik und der äußeren bzw. inneren mongolei?
und wo sind die bodenproben ertragreicher?
bis bald und danke für die tips
s.
Datum: Wed, 9 Oct 2002 13:43:03 +0200 (MEST)
Betreff: Re: -no subject-
hallo m.,
was treibt dich denn in die mongolei? ich habe hier in berlin schon einige lesebühnen abgeklappert und dabei einen freund getroffen, der in seiner zweiten geheimen persönlichkeit auch schreibt und jetzt eben auch liest. dabei habe ich gemerkt, dass viele der vorgelesenen texte extra fürs vorlesen geschrieben wurden – was die stilistik und die pointen betrifft. andererseits habe ich auch bei einigen der interpreten gedacht, dass ich, ohne jetzt eingebildet zu sein oder so, das was die bringen, schon lange bringe. bei anderen allerdings muss ich sagen: respekt! hier war gerade vor zwei wochen so eine art gipfeltreffen der slam-poetry-szene, war sehr interessant und lustig, und wie gesagt, ein paar echte helden dabei. das hat für mich aber auch was gutes gehabt:
ich musste mich direkt danach, so um zwei uhr nachts mit einigen legalen und illegalen substanzen im blut, vor den pc setzten und was schreiben. juhu, die blockade ist weg!
jetzt bin ich also so weit und überlege ernsthaft, ob ich vorlesen gehe. obwohl, ehrlicherweise müsste ich es so sagen wie dubbelju, es ist nicht eine frage des ob, sondern des wann.
[…]
viele grüße aus berlin, und von mir würdest du jederzeit ein großes echo bekommen…
s.
Datum: Thu, 17 Oct 2002 22:14:29 +0200 (MEST)
Betreff: Re: lesen und schreiben
Hallo M.,
Mongolei, nicht schlecht, bestimmt aber sehr spannend und interessant. Aber leider, wenn mich meine geografischen Kenntnisse nicht ganz täuschen, ohne Meeresküste, oder? Von daher bei mir auf der Prioritätenliste weiter unten. Ich brauche Salzwasser.
Das mit dem Vorlesen ist echt so eine Sache. In Berlin gibt es, ich weiss nicht wie das sonst so ist, neben Poetry Slams noch Lesebühnen. Keine Ahnung wie weit die überregionale Bekanntheit inzwischen ist, aber die berühmtesten sind hier wohl die „Surfpoeten“.
Die würde ich nicht direkt zur Slam Poetry zählen, ist halt mehr Prosa, weniger bis gar kein Rhythmus und eine feste Stammmannschaft nebst open mic. Finde ich persönlich besser als klassische Poetry Slams, obwohl auch auf möglichst hohe Witzigkeit geachtet wird. Aber das ist wohl eher eine literaturwissenschaftliche Betrachtungsweise.
Jedenfalls ist in mir wie gesagt bei einer dieser Lesungen vor kurzem wieder der Schreibfluss ausgebrochen. Was dabei rauskam, kannst du hier nachlesen, wenn du willst:
[…]
Ich weiss nicht, ob das eine Stilveränderung ist. Ich weiss ehrlich gesagt nicht einmal, was mein Stil ist. Allerdings habe ich es geschafft, über etwas zu schreiben, was mir wirklich wichtig ist. Bisher glaube ich, habe ich immer zu den Objekten in meinen Texten so einen gewissen Zynismus aufgebaut. Ich schaffte es nicht, Dinge die ich an mich heranliess, wirklich zu beschreiben. Das gelang nicht und klang immer schrecklich. Doch mein letzter Text spielt da, wo sich leider bisher nur ein viel zu kleiner Teil meines Lebens abspielte. Schon allein deswegen sieht es mit der Mongolei schlecht aus, meine nächsten zehn Semesterferien sind schon verplant, wenn auch in einem touristisch ganz gut erschlossenem Land. Was nicht bedeutet, dass es da nicht auch tolle Ecken gibt. (Hört sich das an wie „Naja, man kann im Hinterland von Mallorca ja auch ganz schöne Sachen finden“? Dann entschuldige ich mich!)
[…]
Jetzt da ich vom Krankenlager auferstanden bin (danke der Nachfrage) und ich heute zu meiner ersten Veranstaltung dieses Semester war und morgen arbeiten muss, hat mich wohl die kapitalistische-Verwertungslogik-Realität wieder.
Deshalb bleibt mir nicht viel Zeit, Lesungen zu organisieren. Obwohl ich schon ein langfristiges Interesse daran habe, aber dazu muss ich erst mal schauen, welche Bühne überhaupt in Betracht kommt. Das bedeutet lange Recherche und hoffentlich ein paar gute Vorstellungen.
Zu der [Literatur-Website]: Ich finde die Idee super. Ich finde die Umsetzung auch ziemlich gut. Da ich ja auch vor kurzem den dilletantischen Versuch einer eigenen Homepage gestartet habe, vielen Dank für die konstruktive Aufbauarbeit, habe ich eine ungefähre Vorstellung, wie viel Arbeit da drin steckt. Und dann noch eine Anthologie! Ich find es schade, dass die [Literatur-Website] nicht mehr Beachtung findet, und diesmal wirklich aus völlig uneigennützigen Gründen.
Andererseits finde ich aber auch einige Texte doof, aber das ist normal. Und auch einige Forenbeiträge stören das Gesamtbild, aber ich denke auch dies ist im Rahmen des üblichen. Trotzdem weiss man natürlich nichts über die, sagen wir mal, Verantwortlichen der Seite. Naja, wenn sie so gute Ideen haben und sich soviel Mühe geben, können sie ja nicht von Grund auf schlecht sein…
Vielen Dank für deine mail und dein Lob. Auch ich kann nur sagen, dass mir deine Texte immer wieder gefallen. Immer noch mein Favorit: […]. Den finde ich echt klasse. Was macht dein Schaffen?
Übrigens viele Grüße an A., auch ihre Werke berauschen mich immer wieder. Ich habe gerade noch mal den […] genossen. Ihr habt mir immer noch nicht die Frage beantwortet, wie es kommt, dass sich zwei so geniale Talente in einem so unscheinbaren (Entschuldigung!) Ort treffen.
Viele Grüße aus dem Herbst
S.
(9.3.21)
In Nimis gewesen,
und heimlich
in Norwegen.
(Dass man sowas mal wieder sagt!)
Aber mit beiden Füßen
über der Grenze,
immerhin,
wenn auch nur kurz.
Mehr als zu hoffen war,
für dieses Jahr,
und da rede ich noch nicht mal
vom Offensichtlichen.
Tausende Kilometer abgerissen,
Roadtrip, endlich mal wieder,
und in der geliehenen Karre
sogar ganz gut gepennt.
Tausende auch auf dem Rad,
ein Ziel erreicht,
eine Stunde schneller
als gedacht.
So viele andere
gar nicht.
Nicht nur auf dem Rad.
Sogar noch einige Konzerte,
ganz- und halb- und gar nicht legal,
(dass man sowas mal wieder sagt!)
mitgenommen.
Und Meer.
Glück gehabt,
das Beste draus gemacht,
mag sein,
aber trotzdem:
Was da kaputt gegangen ist
(und da rede ich noch nicht mal
vom Offensichtlichen),
ist nicht wieder
zu kitten.
Es ist eine treffliche Einrichtung, daß Menschen hinter Schreibtischen sitzen und fragen dürfen, Menschen vor Schreibtischen zu stehen und zu antworten haben.
Hans Fallada: Wer einmal aus dem Blechnapf frisst. Berlin 1958, S.251.



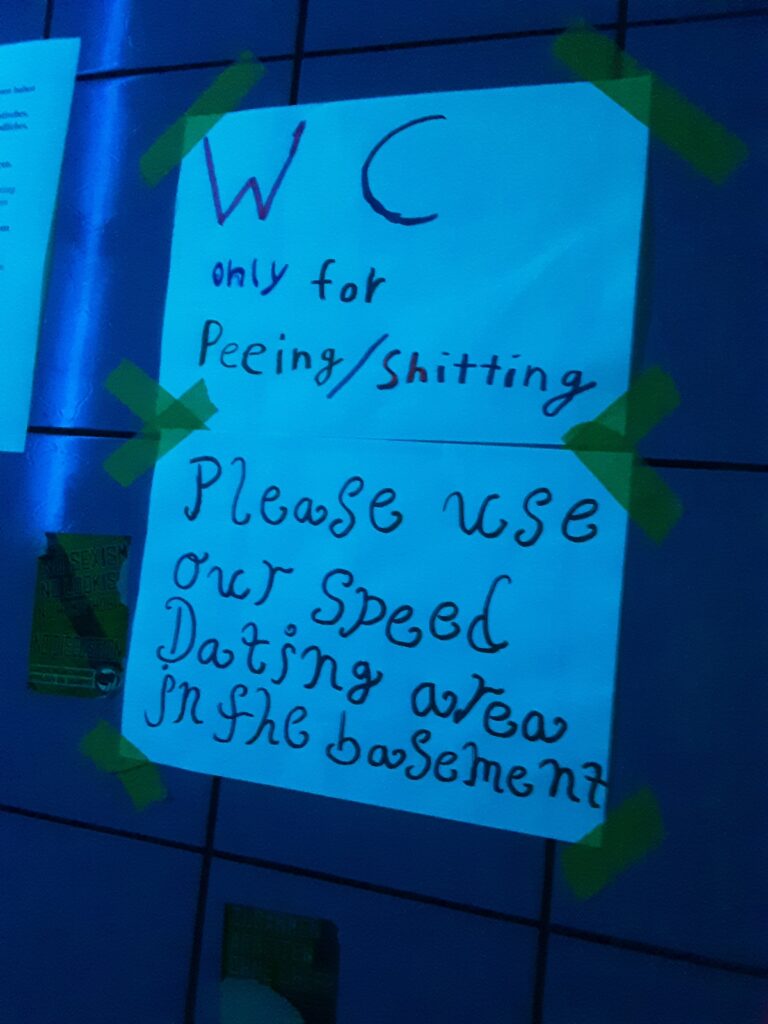
Die verzweifelte Sprachlosigkeit ist gewichen. Was bleibt, ist blankes Entsetzen.
24.03. 14
Ich versuche, es jetzt einfach so zu machen,
wie alle anderen auch.
Zu sagen, ich bin Dichter, ohne zu lachen,
von Selbstzweifel keinen Hauch.
Natürlich Blödsinn!
Und wenn ich das verhindern kann
reimen sich meine Gedichte auch nicht,
was mir nicht immer gelang,
doch sind wir mal ehrlich: das wäre zu schlicht.
Still stehen die Maschinen, nur ein dumpfes Grollen dringt ab und an aus der Tiefe hervor.
Je rasender sich die Welt da draussen änderte, desto ruhiger und eintöniger wurde es hier.
Selten schaute ich mal vorbei, um durchzufegen und den ein oder anderen Staubfänger ins Regal zu stellen. Noch seltener, eigentlich gar nicht, woanders in der Blogwelt.
Irgendwie liegt das wohl auch an der Pervertierung dessen, was die Blog-Blase früher einmal war (zumindest für mich), durch das, was heute gerne „social media“ genannt wird und das Gegenteil dessen ist. Angefeuert durch Caps-Lock-Gebrülle auf Twitter, selbst von höchster Stelle (ganz ehrlich: wie absurd war das denn bitteschön!), wird im Sekundentakt eine neue Sau durch alle sogenannten „Kanäle“ getrieben. Und da gehören Blogs leider dazu. Die Unschuld ist weg, auf eine gewisse Art und Weise. Aber natürlich war sie eigentlich nie da.
Ich habe den Anschluss verloren, mal wieder. Auf diesen Seiten treiben sich sowieso hauptsächlich nur noch russische Bots rum, sei es drum. Aus Faulheit und Trotz gegen die rasende Veränderung belasse ich hier alles beim Alten. Die Blogroll wird nicht angepasst mit aktualisierten Links. Dieses Relikt aus alten Blog-Zeiten, was eh wohl kaum jemand noch hat, bleibt zusammen mit all den anderen toten Links eine Art Gedenkstele – und ein Archiv. Das Netz vergisst nämlich viel zu viel, und ich auch.
Wer mag, kann natürlich weiterhin hier verweilen, die Regale sind ganz gut gefüllt und manchmal wird auch ein neu beschriebenes Blatt abgelegt.

28.7.20
Was ich auch nicht verstehe,
ist warum einen die Menschen
so viel komischer angucken,
wenn man auf der Parkbank
statt ein Buch zu lesen,
eines schreibt.
04.09.04
Weil ich nett bin, dachte ich mir:
Ich datiere meine Gedichte.
So können die Germanistikstudenten
der kommenden Generationen,
so sich ihr Blick auf mich richte,
ihren Verstand ein wenig schonen.




Immerhin, es war nicht alles schlecht.
Gerade jetzt in Deutschland könnte man – nach 1993 sind ja zehn Jahre vergangen fast mit ‚Terror 2000‘ – da könnte man wirklich beweisen: es hat sich seitdem in Deutschland nichts geändert. Es hat sich partout nichts geändert: Die Neonazis sind immer noch da, der Innenminister ist immer noch so bescheuert wie damals, die ganze Bagage, die sich da Verfassungsschutz nennt, oder Staatsorgane, oder was weiss ich, sind alle korrupt und sind noch korrupter denn je. Es hat sich nichts geändert![…]
Deutschland legt nur noch Kränze nieder. […] Wenn man keinen Kranz niederlegen kann, dann sind wir nicht mehr Deutschland.
Christoph Schlingensief, zitiert nach Christoph Schlingensief und seine Filme von Frieder Schlaich, 2004
(2020)
Der Wind, der uns getragen hat,
war ein zerstörerischer Sturm,
in dessen Auge es sich eine gewisse Zeit
aushalten ließ.
Weil wir nicht darauf achteten,
was um uns herum tobte.
Das Problem ist:
erst wurde ich älter als Kurt,
und all die anderem im
Klub 27.
Ok, kein Ding.
Jetzt bin ich älter als Joe,
wie Hank ihn nannte,
und hab es nicht geschafft,
mich in der Nacht vom Truck
überrollen zu lassen.
Auch wenn dieses Jahr
weißgott dafür prädestiniert war.
Zweimal Abschiedsbriefe geschrieben,
und verbrannt.
Was gar nicht so einfach ist,
wenn man keinen Ofen mehr in der Wohnung hat.
Die Frage ist:
Was bleibt da noch,
in so einer Einzimmerbude mit Zentralheizung?
Ausser Rechnungen im Briefkasten,
die man zur Abwechslung nach Jahren
sogar mal bezahlen kann.
Was für ein Scheiss!
16.12.20
Was ich an Physik
oder Mathematik, ich hab da nicht so aufgepasst,
ja auch ganz schön doof finde:
Je kleiner das Piecestück wird –
also je mehr es an Umfang abnimmt –
desto schneller wird es alle.
(Februar 2020)
Jetzt, wo du aufgehört hast zu rauchen:
Kommen dir da die Wege eigentlich länger vor?
So eine drehen und rauchen, von mir bis zur Bahn,
ganz ohne zu rauchen zum Beispiel,
ist doch jetzt bestimmt viel länger,
obwohl genauso weit?
Das ist ja etwas, was uns leider lange Zeit abhanden gekommen ist: Angst und Schrecken zu verbreiten.
Günter Netzer am Tag des 8:0 (BRD vs. Saudi-Arabien) im ARD-WM-Studio, 1. Juni 2002
28.05.10
Kurz bevor es zur Goldberg-Lesung geht
im Fernsehen
erst die obligatorischen Wirtschaftskrisennachrichten
und dann die Schlangen vor den Apple Stores
in Frankfurt, Hamburg und Berlin:
Es geht uns ja so schlecht, Leute, also kauft!
Bei der Lesung dagegen waren selbst
der Eintritt und die Getränke
frei. Und die Geschichten
spektakulär.
Gute alte IG Metall!
[Vor kurzem las ich irgendwo, wie einfach wir es vor einem Jahr doch hatten: Unsere größte Sorge war, wie schlecht die letzte Game of Thrones-Staffel geworden ist. Nun, diese kurze Momentaufnahme von vor drei Jahren erscheint in diesem Licht dann erst recht Äonen her]
07/08/17
Und ich habe mir tatsächlich The Spoils of War am gleichen Tag nocheinmal angeschaut, das erste Mal, dass ich soetwas mache. Aber nur, weil ich zwischendurch Der Fall des Hauses Usher gesehen habe, und gehört. Französischer Stummfilm von 1928, mit Live-Kinoorgelbegleitung im Babylon, wo ich seit dem Baizfilm nicht mehr war.
Wie die Zeit vergangen ist; was seitdem alles passiert ist.
Jetzt also: Erst begeistert von dem nächsten Höhepunkt der derzeit wohl besten Serie; begeistert sowieso, obwohl oft in viele Abgründe geschaut in letzter Zeit, beinahe in die eine oder andere Klamm gestürzt wäre – aber eben auch Gipfel erreichen konnte, oder wenigstens Hochplateaus. (Wie damals den Tafelberg)
Früher – 1928 – aber auch schon: Filmkunst auf höchstem Niveau, so kam es mir jedenfalls vor; Überblendung mit Kerzenlichteffekten, durchaus rasante Dollyfahrten, das Tropfenlassen der Zeit…inmitten dieser riesigen Kulissen.
Darüber hinaus ein Buñuel! – den ich noch nicht kannte, von dem ich nichts wusste bisher, auch wenn er nur am Drehbuch mitgeschrieben hat und ansonsten Regieassistent genannt wird: Was für eine Kombination mit Poe!
Dazu das Geäst, der Nebel samt Luftzug und die Farben; nicht zuletzt die schon erwähnte Musik, das Krächzen, das Schnarren, das Donnern.
Vorher vor der Volksbühne in der Abendsonne einen geraucht, und kurzzeitig eine Vorahnung von der kommenden Überwältigung erfahren: Das Rad ist weg, Luftballonschriftzüge flattern etwas unbeholfen mit einem letzten Gruss an die alte Zeit. Gegenüber die geballte historische Macht des Horst-Wessel/Karl-Liebknecht-Hauses.
Noch viel vorher Wochenenden, die sich lohnten, Wände, die verstanden wurden, immer wieder Sonnenuntergänge, und seit kurzem auch eine Hängematte. Ganz zu schweigen von den anderen Orten mit Hängematten und Liegestühlen für locker vier Personen.
Keine Anhnung, was das alles soll, während uns die Welt da draussen um die Ohren fliegt. Ich geh morgen erst mal Brombeeren pflücken.
I never thought that dragons would exist again; no one did. The people who follow you know that you made something impossible happen. Maybe that helps them believe that you can make other impossible things happen. Build a world that is different from the shit one they’ve always known. But if you use them to melt castles and burn cities you’re not different, you are just more of the same.
Mit diesen Sätzen begrüßte 1914 ein Reiseführer ganz ernstgemeint sein Publikum, man wundert sich:
Berlin, die namenreichste aller Hauptstädte, hat vor allen Großstädten des Kontinents und jenseits der Meere etwas voraus. Die einen nennen es das moderne Babel, die anderen die amerikanischste Stadt des Kontinents, die dritten die fleißigste, alle aber die sauberste Stadt der Städte.
Richters Reiseführer Berlin und Umgebung, Verlag Willy Holz. Berlin 1914, S.1.
Was diese merkwürdige Zeit so alles hervorbringt, denkt man sich manchmal. Bei mir um die Ecke war es ein Kunstwerk, welches ich so originell fand, dass ich direkt am Tag nach der Entdeckung die Kamera mitnahm.
Da war dann schon die Erklärung abgerissen, die wie im Museum daneben auf einem kleinen Schildchen nachzulesen war.

Was ich mir davon noch merken konnte: Es ging um die 1,5m Abstand und die Distanziertheit generell gerade. Deshalb war der Schriftzug auch aus entsprechend langen Zollstöcken gefertigt. Oder so ähnlich.
Fanden aber wohl nicht alle so originell wie ich.

Verstehe ich nicht, aber ich verstehe vieles nicht, was mir in letzter Zeit so vor die Linse kommt. Merkwürdige Zeiten eben.

28.11.17
Im Nachhinein betrachtet
ist das Einzige
was früher nicht besser war
die Zukunft.
(Februar 2020)
– Hej…ich habe viel an dich gedacht…
– Ja?! Ich an dich gar nicht so viel….
– Ja, das habe ich mir gedacht….

Auch schon ein Jahr her, dass aus dieser Glut Funken stoben…
23/07/14
Als ich jung war,
wollte ich Schriftsteller sein.
Als ich Schriftsteller war
wollte ich jung sein.
[Klappte beides nicht wirklich.]
27.12.08
Arbeitskämpfe und Tarifverhandlungen sind uninteressant
Für die, die sich nicht mal eine Krankheit leisten können,
wenn sie ihre Miete bezahlen wollen.
Aber dann kam ja sowieso
Diese skurrile Immobilien /Strich/ Finanz /Strich/ Wirtschaftskrise.
Und da sich nach einigen Natur- und Politikkatastrophen
In den letzten paar Jahren
Die Rate der durchs Dorf getriebenen Säue rasant erhöhte
Zum Schluss mal wieder die NPD.
Als ob es das Thema nicht vor Jahren schon mal gab,
andauernd Nazis Menschen angreifen,
und man menschenverachtende Gesinnungen
gesetzlich verbieten könnte.
Da haben die neuerlichen Bomben in Bombay
Oder Gaza und wer weiss wo noch
Gerade noch gefehlt.
20.08.04
Die Zeiten ändern sich:
Rotwein gehört inzwischen
– wenigstens für kurze Zeit –
in den Kühlschrank.
Zimmer sind nämlich
mittlerweile zu warm.
01.12.17
In Friedenszeiten
und nach offiziellen Turnierregeln
ist das Saarland ungefähr
so groß wie 359.890 Fussballfelder.
14.10.16
Das Fleisch zischt und brutzelt
so angenehm,
wenn das Metall, rot und glühend
wie die Liebe,
es berührt.
Weil sonst Nichts und Niemand
es berührt.
Weil sonst Nichts und Niemand
da ist;
was man spürt.
Überflüssig kommt es einem vor,
überdrüssig dieses Leibes, Fleisches,
das man gern und Stück für Stück
verliert.
Die eingebrannten Erinnerungen
lassen schwelgen,
wie kein Bild aus vergangenen Zeiten
es vermag.
10.11.16
Dort, wo die Zeit aufhört
bedrohlich zu ticken, und
anfängt,
zu fließen.
Dort wünsche
ich mich hin,
mich zurück.
Einfach ein Loch graben,
so tief, dass man nicht mehr
zurück kann, sondern nur noch
auf der anderen Seite heraus.
Gestern war ich ein Anderer.
Und vorgestern erst!
Trotzdem habe ich immer noch
Angst vor dem, der ich
morgen bin.
Und manchmal korrigiere ich mich:
Sein werde – oder würde –
denn wer oder ob,
das habe ich heute
in der Hand.
Meist zum Glück kein Messer.
16/04/16
Unten auf der Elbchaussee
fährt aufgeregt hupend
ein türkischer Hochzeitsautokorso
vorbei.
Die Seifenkisten, mit denen die
Touristen hier neuerdings ihre
Stadtrundfahrten machen
(als die Segways kamen, dachte ich,
schlimmer gehts nicht. Pustekuchen!)
versuchen panisch, den Weg frei zu machen
und wirken dabei wie ein aufgescheuchter
Bienenschwarm, nur lange nicht so
koordiniert.
Dahinter ziehen dicke Pötte
unbeeindruckt ihrer Wege.
Die Fußgängertouristen dazwischen,
eben noch Selfies mit der Pudelruine machend,
gaffen wie immer interessiert.
Die Frühlingssonne, die sich doch noch
gegen die Wolken durchsetzte,
fügt alles zu einem versöhnlich-
stimmigen Bild,
in das selbst die Hafenstrassendealer und
die Obdachlosen, die in so vielen Ecken kampieren,
hineinpassen.
Und irgendwo weiter oben
hat Pauli mal wieder verloren.
Nachdem ich lange auf das zugegeben wunderbare Fauser-Porträt als Profilbild zurückgegriffen habe, wurde es langsam Zeit, eines zu verwenden, auf dem wirklich ich zu erkennen bin. Zwar ohne den gesegneten Schnauzer Fausers, dafür bei einer meiner häufigsten Tätigkeiten…Man wird halt nicht jünger, muss dafür aber nachts öfter mal raus.

Ansonsten: Irgendwie bin ich noch hier. Immerhin. Aber die Maschinen stocken ab und an, es müsste einiges mal wieder geölt und geputzt werden, unzählige Fotos warten darauf, gescannt zu werden, ein neuer Computer müsste her, die Blogroll gehört entstaubt…alles Probleme, um die sich eventuell im nächsten Jahr gekümmert wird. Wer weiss das schon, ich bin schliesslich kein Hellseher und scheine sowieso mehr in der Vergangenheit als in der Zukunft zu leben. Wer will auch schon in so einer Zukunft leben…
17/07/14
Sechs Tage noch, bis
zum Geburtstag, dreizehn
bis zur Kündigung.
Was falsch ist, weil:
Ich bin ja frei.
So frei.
Schon längst erkannt,
dass die guten Zeiten
lange her sind.
Schon längst.
Vor zehn Jahren
(waren sie auch schon vorbei)
war ich richtig gut,
jedenfalls bin ich
(das ist wohl das Hauptproblem),
jedenfalls werde ich
nicht besser seitdem.
Ein paar Gedichte & Geschichten,
ob nun gut oder nicht,
konnte ich nachweisen,
und es gerade rechtzeitig
in den Klub 27
schaffen.
Das Ticket dazu
hatte ich mir schon oft
besorgt.
Eingelöst bisher noch nie.
Deshalb sitze ich jetzt also
hier,
noch 13 Tage im perfektesten Job der Welt
für mich.
Und darf zusehen,
wie ein Verrückter
(„psychiatrieerfahren“ laut Selbstauskunft)
das Gästebuch vollschreibt,
mit kruden Geschichten über das Gedächtnis
des Wassers.
Und der andere Verrückte
schreibt danach soetwas wie Gedichte,
und wollte schon längst
weg sein, und fragt sich, wie immer,
ob es dafür jetzt nicht zu spät ist.
09.08.04
Ich bin ziemlich selbstverliebt.
Das ist aber nicht so schlimm.
Reiner Schutzmechanismus.
04/06/14
Nie hätte man in den frühen 70er Jahren
damit gerechnet,
wie sich, nur wenige Dekaden später,
die Landkarte Europas verändern würde.
Um die Jahrhundertwende herum
dann eine Zäsur, wie man so sagt,
doch eigentlich war da schon viel,
bald alles,
passiert.
Es wurde nur noch vollzogen.
Und Wissen und Fortschritt,
gar technische Revolutionen, durchaus.
Wer da, nach ein paar Jahren nur,
alles unter einem Dache stand!
– nicht unbedingt zusammen zwar,
doch das Dach, das war da.
Und nun, im vierzehnten Jahr?
Man weiss natürlich immer erst danach,
dass noch in Jahrhunderten die Rede
sein wird von dieser Zeit.
Und nun, im vierzehnten Jahr?
Starb Kaiser Karl,
starb Kaiser Karl.
09/07/14
Ja seid ihr denn verrückt,
Recht auf Rausch,
schön & gut,
aber bitte:
rezeptfreie Verkaufsstellen,
wo kommen wir denn
da hin?!
Möglichst steril und
sozialverträglich, sauberes
Apothekenschalterneonlicht
statt verdreckter Kanülen.
Eingepreist in den Regelsatz.
Wer hat denn sowas
schon gehört?!
Oder gelesen?
Und eben:
Was soll man denn
darüber für Geschichten schreiben,
über geregelte legale Drogenabgabe,
ohne Knarren, Dreck & Deals?
Kann sich doch keiner ausdenken,
sowas!
20.08.05
Wenn ich mich auf meiner Loggia
-mit Blick auf die Hochbahn-
in einem bestimmten Winkel
auf das Sofa setze,
dann brauche ich mir gar nicht
anhand von Futurama-Comics
die Zukunft vorstellen:
Dann fliegen die Züge auch so schon vorbei.
28.04.14
– Schon im Flow?
– Jo.
– Oh…
05.09.04
Ist es nicht verschwurbelt,
dass man schon als verschwurbelt gilt,
nur weil man verschwurbelt sagt?
07.08.04
Spätestens zur Zeitumstellung
ist es Zeit, um Stellung
zu beziehen.
Ich springe in den Graben
zwischen gut und böse
und versinke.
Knietiefer Schlamm.
Trübe Brühe.
Kein Ufer in Sicht.
Die erste Abstraktion der Menschheit
war wohl, Grenzen zu ziehen.
Wo es ging.
Wer das nicht akzeptiert,
wird abgeschoben.
Ins Niemandsland zwischen richtig und falsch.
Die Wahrheit zu pachten
kommt nicht in den Sinn.
Oder teuer zu stehen.
08.07.14
Im O vom Seniorenheim
haben sich Spatzen eingenistet.
Es heisst Porta Westfalica,
das Heim, nicht das Nest.
Da sind noch genügend
Buchstabenrundungen frei,
bezugsfertig ab sofort.
12.08.15
Seit Wochen meilenweit
entfernt von Normalnull.
Schwankend, von beiden,
von allen Seiten.
Schwankend sowieso
viel zu oft in letzter Zeit,
soviel Ehrlichkeit muss sein.
Keine Perspektive gehabt.
Pure Verzweiflung war eine Option;
für eine Weile, schien es
die einzige.
Doch dann weitete sich,
neben den Blutgefäßen
der Horizont. Alles
schien möglich.
Ausser Normalnull.
Und das Glück prasselte nur so
auf mich ein.
Die alten Rituale, meilenweit entfernt,
ein vertrauter Ort, weg von der Stadt,
zum runterkommen.
Auf dem Rücken treibend, die Schwalben
beobachten, wie sie ihre Beute
knapp über der Wasseroberfläche
wegfangen; ein neues, vielversprechendes
Ritual.
Auf dem Rücken liegend auch später,
nachts, in der Heide, nur Fledermäuse
und der Himmel über uns, wegen dem
wir hier waren, eigentlich.
Viel zu lange her,
viel zu selten gemacht,
viel zu viele Möglichkeiten
und Glück.
19.10.16
Zu oft täuschte der strahlend
blaue Himmel des Sommers
über das Offensichtliche
hinweg.
Zu oft legte der ausgelassen
beschwingte Rausch der Nacht
seinen Schleier über die
Zweifel.
Zu selten Zeit genommen
oder gefunden,
zum Denken.
Nur fühlen.
Wo nichts zu fühlen
war.
Ausser manchmal morgens,
Mitleid. Verzweiflung.
Zu fern schienen die armen Seelen,
wild diskutierend mit ihrem Spiegelbild
oder stumm & abgerissen
mit dem Strassenfeger in den
grindigen, zittrigen Händen.
Nächte und Tage in Höhlen verbracht,
die Drogen waren gut, man merkte kaum,
dass die wilden Camps am Bahndamm
einem immer näher kamen.
Was diese Stadt mit den Seelen der Menschen
macht, fragte eine ferne Stimme.
Fressen und auskotzen,
und das Erbrochene
fressen und auskotzen,
immer wieder,
bis keine Substanz mehr
übrigbleibt.
18/10/14
Die Wassersportler aus Grünau
und wer weiss wo sonst noch her,
bepöbeln sich lautstark
beim Saisonabschlussrudern
auf fremden Terrain:
Die Boote liegen im Gras, die
Fünfliterbierfässer ebenso,
und irgendwann wohl auch
die Ruderer.
Schwäne heischen um Aufmerksamkeit,
– nein, um Futter,
und sind ansonsten
desinteressiert.
Die letzten Touristenkähne
schleichen gemächlich durchs Wasser,
Erpel machen sich gegenseitig
das Leben schwer,
ältere Herrschaften fahren
ihren bescheidenen Wohlstand
auf den Wasserwegen spazieren.
Widerwillig löst sich der Hochnebel auf
und lässt die Sonne kurz durch,
bevor sie hinter den Häusern
verschwindet.
Die eingebildeten Schwäne
entpuppen sich bei näherem Hinsehen
auch nur als Giraffenenten.
Und die Bläßrallen tauchen
langsam ab,
wie das Jahr.
24.02.10
Auch das Obdachlosenasyl
Nebst angeschlossener Sozialeinrichtung
Hat vom dutzendwöchigen Frost-Eis-und-Schneewinter
Sowas von die Schnauze voll:
Am rostigen Gitterrosttor
Verkündet trotzig ein Plakat:
Jamsession für alle,
Freitag 12-14 Uhr.
Thema: Reggae.
29/07/14
Vielleicht lag es
an den zu transportierenden
Flüssigkeitsmengen,
sagte der Wissenschaftler,
woran aber auch immer,
es ist Quatsch.
Das mit den Buchen, den Eichen
und dem Gewitter.
Immer schön weit weg
von jedwedem Baum,
das ist die Hauptsache,
sagte er auch.
Na toll, dachte ich,
hat mir sehr geholfen,
dieser fachkundige Rat,
als ich den ersten Donner
grollen hörte,
mitten im Wald.
Natürlich war auch dieses wieder ein Scheissjahr, ist ja schliesslich auch eine Scheisswelt, wie soll das sonst auch anders sein?!
Doch während in der Welt da draussen der Wahnsinn heuer besonders brodelnd kochte, ging es bei mir sogar mit ihm. Klar, vieles ist liegen geblieben – & ich auch viel zu oft. Trotzdem: Hätte man mir vor einem Jahr gesagt “Du wirst umziehen, du wirst dieses und jenes und eine Weiterbildung machen, du wirst neue Freunde finden, beste sogar, du wirst lachen, dir wird nach weinen zumute sein, dein Hund wird sterben, du wirst dich ganz viel unter Menschen begeben, mit ihnen arbeiten und Spass haben, du wirst wieder in ein Kollektiv gehen, es wird ein Familiendrama geben, und dann ist auch schon wieder Weihnachten!” – Nichts davon hätte ich geglaubt, fast nichts, denn der Hund war wirklich alt.
So war es mir am letzten Mittwoch auch scheissegal, ob das nun der Tag war, an dem Beate Zschäpe ihr Schweigen brechen würde oder der Tag, an dem Angela Merkel zur Person of the year gewählt wurde – für mich war es der Tag, an dem die Chaussee der Enthusiasten ihre letzte Vorstellung gab. Die grossartig war. Neben den ganzen Erinnerungen an die gute, alte Lesebühnenzeit um die Jahrtausendwende herum, als alles noch in Butter war in meiner kleinen Welt und in der grossen drumherum Deutschland kaum Krieg führte, wurde beim Aftershowbier in der Baiz (2 Fliegen mit 1 Klappe, die neue Lage zahlt sich aus) noch fachkundig über die Unterschiede zwischen Nieder- und Obersorbisch geplänkelt.
Keine neue Liebe zwar, aber ein neues Leben, das schon irgendwie. Allerdings noch nicht sicher, wie ich mich in dieser Rolle fühle, ob all die Kontakte, all die sozialen Bindungen wirklich richtig sind für mich. Wie soll ich denn mit anderen klarkommen, wenn ich immer noch nicht genau weiss, wie ich mit mir überhaupt klarkomme? In den dunklen Momenten lache ich mich selbst hämisch aus für diese alberne Flucht unter Leute, das Stürzen ins Getümmel. Und da die Realität einen zweifelhaften Humor hat, bietet sie mir am Ende des Jahres auch noch einigen Grund dazu.
Vor all dem und nach der Chaussee der Enthusiasten – wenn schon mal Kultur, dann richtig – besuchte ich noch die Beckmann-Ausstellung und stellte mal wieder fest, dass ich viel zu selten Kunst anschauen gehe. Schon mal ein lächerlicher Vorsatz mehr fürs nächste Jahr. Es folgten einige Zeiteinheiten, die mit Tagen nur unzureichend beschrieben wären, die ineinander übergingen, kurze Unterbrechungen und Ortswechsel beinhalteten, wiederkehrende Elemente und Momente ebenso, aber ansonsten bar jeglicher klassischer Zeiteinteilung waren. Und Drogen hatten da nicht viel, nicht mehr als sonst mit zu tun – ein brennendroter Sonnenaufgang über Kreuzberg berauschte mich um einiges mehr, beispielsweise.
Vieles ist geschehen, kaum etwas hat sich verändert.
Es wird noch dauern, dafür die richtigen Worte zu finden.
Erfahrungen wurden gemacht, immerhin.
Und Bilder, wenn auch nur wenige:

Februar, Hamburg

Februar, Hamburg, viel zu viele Häuser brannten in diesem Jahr

April, Rügen, keine adäquaten Worte für ein paar grossartige Tage

April, Rügen, nicht nur der Baum stand auf der Klippe auf der Kippe

Juni, Müritz

Juni, Müritz, geblendet…
Einer der besten ersten Sätze überhaupt. Ob es hier für einen (Neu)Anfang langt, wird sich zeigen, irgendwann…
Verrückt sein heißt ja auch nur, dass man verrückt ist, und nicht bescheuert.
Wolfgang Herrndorf: Bilder deiner großen Liebe. Ein unvollendeter Roman. Berlin 2014.
(Ein Jahr rum & vieles scheint so gleich. Dabei ist es nicht einmal ähnlich.)
27.01.15
Der 27. Januar
– aber das ist ein anderes Thema –
also erst,
und trotzdem schon so
fertig.
Der 27. Januar
also schon,
und doch erst so wenig
geschafft.
Ein anderes Thema, zum Glück;
sonst müsste man sich schämen,
für solche Belanglosigkeiten.
(06.12.15)
Monate inzwischen gearbeitet,
in allen Positionen.
Allen.
Trotz der kurzen Zeit
(&mit Berlinjahrzehnten auf dem Buckel,
traurig, aber wahr. &gar nicht traurig, eigentlich!) –
Alles schon gesehen.
Alles.
Doch nie wirklich aufgetaut.
Spass gehabt: sicherlich!
Fast alle Genres und Publikümer durch.
Nette&grossartige&überraschende Begegnungen
und versoffene Morgene,
mit Sternchen, die viel mehr brodeln als man denkt,
alten Punkrockern aus dem letzten Jahrtausend
&dem ganzen Rest: artertracks haben auch schon gedreht.
Aber: Das Eis knirschte nur, brach nicht.
Und sowieso: Ich tanze nicht!
Nie!
Unerwartet dann, nach grandiosen elf Tagen;
bei den Punkrockboys (in ihren Feinrippunterhemden)
(nicht beabsichtigt, aber passend wie Arsch auf Eimer –
wie die Punkrockboys auf die Bullen): Der Durchbruch.
Und ich tanzte.
Zuhause, nach der langen Nacht, zum runterfahren
(&weil ich bei der Recherche zum nun toten Stonetemplepilotssänger drauf kam,
auf diese eine tolle 90er Playlist, achwasbinichalt):
Erst das Creep-Cover von Eliza Dolittle – unbedingt & nur mit Kopfhörern natürlich!
Dann doch noch mal das Original, das letzte aufputschende Aufbäumen.
Und schliesslich pünktlich zum Sonnenaufgang total fertig ins Bett fallen.
Wie angekündigt, nun das erste Zitat. Als Einstieg nichts von dem grossen Bücherstapel, sondern aus der aktuellen Klolektüre (generell ein unterschätztes Literaturgenre):
…doch glaube ich, unter anderem einen hoffentlich verzeihlichen Hang zur hoffentlich nicht allzu platten Gesellschaftskritik entwickelt zu haben, wobei ich Gesellschaftskritik nie mit System- oder Regierungskritik verwechseln wollte, denn Gesellschaftskritik, die das Grölen von Fußballfans in Bahnhöfen ganz unerwähnt läßt, ist keine.
Max Goldt: Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Vorredner, Majestäten, Exzellenzen, Freunde und Präsidenten, Fremde und Magnifizenzen! (Rede zur Verleihung des Kleist-Preises, 23.11.08, Titanic 1/09)
05.09.15
Schon Wochen
bevor ich aus Kreuzberg verschwinden musste
stellte ich sicher,
dass die Bindung möglichst stark bleibt,
und ging Verpflichtungen ein.
Wie Ewigkeiten schon nicht mehr,
stärker als all die Jahre, mindestens seit damals,
seit dem letzten Plenum.
und nichts hat sich
verändert.
Die gleichen Debatten, im Großen & Ganzen.
Der gleiche Spass auch, natürlich.
Die gleichen Probleme, Fälle & Fallen, Schicksale, Süchte.
Und die gleiche Euphorie hinterm Tresen,
wenn das Konzert vorne gut ist.
Nicht nur als angenehmer Nebeneffekt, sondern
eigentlich nur, weil das mein
Zuhause ist, war, der Kiez
und die Leute,
bin ich hier.
Bleibe ich hier.
Inzwischen ist die Zeitumstellung längst Geschichte; vorbei auch die Zeiten, in denen ich morgens nach der Schicht im gleissenden Sonnenlicht mit dem Rad nach Hause fuhr und dabei ungläubig feststellte, dass der Sandstein des Reichstags im richtigen Licht beinahe so schön aussieht wie der in Jerusalem, ein unpassender, unangebrachter Vergleich natürlich. Doch zuerst das Wichtige, Drängende – ich hatte ja bereits an anderer Stelle darauf hingewiesen & kann dies jetzt mit Bild und Ton wiederholen:
Zeit, mal wieder Häuser zu besetzen, na klar. Viele Projekte in dieser Stadt feierten gerade ihr 25jähriges Bestehen, oder tun das demnächst. Was als Utopie in einer unfertigen Möchtgernmetropole begann, muss nun nach einem Vierteljahrhundert Realität oft den Verwertungsinteressen weichen. Dann bleibt vielleicht nicht viel mehr, als Filme darüber zu drehen.
Jetzt sitze ich hier und beobachte das erste Schneetreiben des Winters durch die Fensterscheiben. Das Wetter war es auch, in seiner windig-nasskalten Variante, was dazu führte, dass der Heimweg in letzter Zeit meist mit dem N6er angetreten wurde. Diese Runde wird auch immer größer; ich bin nicht der letzte, der in den Wedding ziehen musste.
Nach dem Verschwinden des Rucksacks begann ich, den König David Bericht zu lesen, das nächste Buch auf dem Noch-zu-lesen-Stapel. Versuchte hie und da, Bruchstücke und Textfragmente des Notizbuchs aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren, worin ich noch nie gut war. Vor allem schmerzte der Verlust der seitenlangen Notizen & Ideen für den einen und den anderen langen Text.
Der Rucksack samt aller darin enthaltener Schätze wurde mir dann eine halbe Woche später ausgehändigt: Er lag einfach in einer dunklen Ecke eines dunklen Zimmers unter einem Haufen schwarzer Klamotten – kein Wunder also, dass ich ihn beim oberflächlichen Suchen nicht fand.
Verzwickt wie die Mühle, anders kann ich es nicht erklären. Mein Rhythmus ist komplett im Arsch, auf den Nachtschichtmodus eingestellt für die halbe Woche. Allerdings habe ich es mir ja selbst so ausgesucht: Mir die Nächte um die Ohren zu schlagen, Ideen & Eindrücke sammeln, für deren Niederschrift kaum Zeit bleibt. Zu dem Teil gehören, der nicht aus Spass auf Konzerten ist – oder nicht nur – sondern zum Arbeiten. Auch wenn man es selten so nennt & empfindet, sondern einfach als anstrengendes Vergnügen. Ich bin im Feld, immerhin.
Vieles gelingt, vieles auch nicht. Zu viele Menschen, zu viel Menschliches. Erkenntnisse reifen, Entscheidungen fallen. Manches geht nach hinten los, manchmal geht das Kairos an einem vorbei, lässt man es ungenutzt vorbeiziehen. Perfekte Tage sind Hirngespinste, perfekte Momente aber durchaus möglich. Vieles, was ich in diesem Jahr erledigen wollte, liegt in weiter Ferne. Trotzdem wurde Einiges geschafft, auch Unerwartetes. Loslassen und Neues wagen.
Im Gegensatz zu vor einem Jahr habe ich aber auch viel weniger Möglichkeiten, einfach rumzusitzen & auf dumme Gedanken zu kommen – dafür treibe ich mich viel zu sehr rum und habe viel zu viel zu tun, vergleichsweise. Das kann natürlich auch zu Zweifeln und Missmut führen; ich habe es weder nach Hamburg noch an die Ostsee geschafft, beispielsweise.
Dass Abstriche gemacht werden müssen, sieht man hier ziemlich deutlich, wenn man sich die Mühe macht, und die Blogseiten des letzten Herbstes anschaut. Da gab es vielfältigere Texte, und viel mehr sowieso. Gerne hätte ich mal wieder eine Linkliste rausgehauen, doch dafür hätte ich viel mehr Blogs lesen müssen – zwei Vorhaben, die ich wohl in diesem Jahr nicht mehr umsetzen werde.
Ebenso steht es um die nächste Ladung Bilder – dass hier noch gewartet werden muss, kann ich wenigstens auf das schlechte Wetter in der letzten Zeit schieben. Doch dafür kommt demnächst wohl eine neue Kategorie hinzu (ganz zu schweigen von der nötigen Feinabstimmung, die hinter den Kulissen dringend nötig ist): Der Noch-zu-lesen-Bücherstapel hat immerhin ordentlich abgenommen, dementsprechend sind die Stapel gewachsen, aus denen die angestrichenen Zeilen und am Rand hingekritzelten Notizen abgeschrieben werden müssen. So könnte es also sein, dass ich ab und zu, wenn ich denn dazu komme, das eine oder andere Zitat veröffentlichen werde, denn schliesslich dient mir das Blog auch als eine Art Notizbuch.
Wobei das mit der Wiedergabe fremder Inhalte, umschreiben wir es mal so, ja nie leicht ist, man sich irgendwie immer auf unsicherem Terrain bewegt. Ich glaubte eigentlich, mich halbwegs auszukennen: Man darf strenggenommen nicht mal jemanden ohne sein vorheriges Einverständnis fotografieren, wenn er wiedererkennbar ist. So habe ich es gelernt, das letzte mal erst vor einem halben Jahr, ganz offiziell von einem Anwalt. Es sei denn, so eine der wenigen Ausnahmen, die fotografierte Person ist Teil einer öffentlichen Veranstaltung (sobald diese allerdings kommerziell ist, können die Bildrechte mit dem Ticket am Eingang abgegeben werden). Dass aber selbst das Filmen politischer Veranstaltungen zu Komplikationen (und zu einer überraschend interessanten Geschichte über das Netz) führen kann, zeigt The Story of Technoviking – ja, damals galt die Fuckparade noch als politische Veranstaltung; und ja, damals gab es noch verdammt viele verfallene Häuser in Mitte. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte und hier ist erst mal Schluss.
The Story Of Technoviking – Kurzfassung – Deutsche UT from Matthias Fritsch on Vimeo.
Die verrückte Log-Lady ist tot! sagte sie.
Das ist aber ein komischer Spitzname für Karasek, dachte ich, aber nicht ganz unpassend.
Es ist schon eine Weile her – das lässt der Titel ja erahnen – doch ich weiss noch, dass dies ungefähr die letzten Zeilen waren, die ich in mein Notizbuch schrieb. Ungefähr deshalb, weil ich es nicht genau sagen kann, weil es nämlich weg ist, das Notizbuch. Zusammen mit den Erinnerungen Walter Jankas, fast ausgelesen, einer Filmdose und den Sanddornbonbons. Mehr war zum Glück nicht drin im Rucksack, doch das reicht vollkommen aus für die nächste Sinnkrise.
Es hätte ja auch die Kamera, Geld und wasweissichnochalles verloren sein können, Scherereien ohne Ende. Dass es „nur“ das Notizbuch war – und Janka – schon wieder ein Zeichen?! Vor allem, wo ich doch gar nicht an sowas glaube?
Schliesslich beschäftigte ich mich mit Janka indirekt schon vor Jahren, seit Jahren, über einem Dutzend an der Zahl, erschreckenderweise. Indirekt deshalb, weil es über Bande geht, weil es hauptsächlich, immer mal wieder, Harich ist, der mir im Kopf rumspukt. Harich ohne Janka geht nun mal aber nicht, und dessen Autobiographie fand ich im Frühjahr auf dem Flohmarkt.
Als der Rucksack sich verabschiedete, war ich kurz vor dem Schluss angelangt, kurz vor der vermuteten Generalabrechnung mit seinem einstigen „Mitverschwörer“ – dank häufigerer Bahnfahrten wegen des beschissenen Wetters in der letzten Zeit las sich das recht schnell und interessant.
Ärgerlich, doch noch weitaus ärgerlicher ist natürlich die Sache mit dem Notizbuch. Da sollte man auf alle Fälle vermeiden, ein Zeichen zu erkennen; das könnte nur ein Menetekel werden: So viele Fragmente, angefangene Texte, fertige Verse. Und kaum etwas davon übertragen, irgendwo anders gesichert. Das, was mir bisher, vor allem in der letzten Zeit, als viel zu wenig vorkam, viel mehr hätte sein müssen, erschien auf einmal als ein unglaublich wertvoller Schatz, der nun verloren gegangen ist.
Zugegeben, diese ausufernde Thematisierung von Notizbüchern in der Literatur – vor allem natürlich derjenigen, die nach Maulwurfspelz klingen und nur beim Markennamen genannt werden – stört mich oft, selbst bei Herrndorf ein klitzekleines bisschen. Allerdings: Ich bin auch nicht so der haptische Typ, sondern eher der Praktische. Und kann jetzt nur verzweifelt lächelnd & unter Pein zustimmen, wenn ich (bei der mäandernden Recherche zu „Moleskine“) in Arbeit und Struktur lese:
Ich trage als erstes meinen Namen und 50 Euro Finderlohn vorne ein, wenig später mache ich eine 1 davor: 150 Euro. Irgendwas in meinem Innern sagt mir: Ich darf das auf keinen Fall mehr verlieren.
Das Gegenteil eines Wermutstropfens – ein Tröpfchen Manna in dem Zuber Wermut sozusagen, angesichts des befürchteten Verlusts – war der ganz und gar großartige Abend. Mehr als gelungen, überall zufriedene und meist zutiefst berauschte Gesichter; nur sehr lang, sehr früh erst vorbei. Mit dem Sonnenaufgang im Rücken, der überraschend spät einsetzt – es ist noch etwas Zeit bis zur Zeitumstellung – und einer sich diesig verabschiedenden Nacht voraus dann endlich das Durchatmen und Durchtreten der Pedalen, versuchen den Rucksack und alle anderen Probleme aus dem Kopf zu bekommen.
12.11.04
Ich bin nur so verschlossen,
damit ich sagen kann,
dass sich ja sowieso niemand
für mich interessiert.
11.07.10
Das ist also jetzt die midlife crisis,
oder wie?
Da frage ich mich bloss,
wo denn bitteschön das Leben
dazu sein soll?!
Das was das da angeblich
zur Hälfte rum ist,
war ja nun wirklich
nicht der Rede wert.
20.08.15
Dort entlang, wo es einst heimwärts ging,
tagsüber ein paar Mal,
doch noch viel öfter nachts.
Immer geradeaus, ist nunmal
die schnellste Strecke, nein:
die kürzeste.
Baustellen pflastern den Weg, überall
und immer wieder woanders.
Kaum ein Durchkommen.
Das Stückchen, was mal Prachtmeile werden sollte,
ist nichts als Kulisse mit Statisten in Uniformen
und im Kreis radelnden Stammtischen.
Vorbei zum Glück spätestens nach dem Nadelöhr
Oranienburger Tor. Das Tacheles, wie alles hier,
sah bessere, aufregendere Tage. Tristesse.
Kaum wechselt die Strasse zum zweiten Mal den Namen,
Quietschen die Reifen der Streifenwagen,
Und die viel breiteren ihrer Counterparts.
Kurz vor dem Ziel schallt eine kräftige Stimme über die Kreuzung:
“Kann es sein, dass sie gerade eine kritische Bemerkung mir gegenüber machten?”
Nochmal kräftig in die Pedale treten und um die Kurve,
bevor er die Knarre rausholt.
Anfang Oktober, kaum Spätsommer, dafür Schmuddelherbst zur Genüge.
Keine Ahnung, was die auf diesen ganzen Baustellen genau machen, aber in den letzten Nächten, immer wenn ich die Friedrichstrasse entlang fuhr, zurück in den Wedding, hatte ich den Geruch des stinkenden Schlamms vom Toten Meer in der Nase. Vielleicht war es aber auch nur die Sehnsucht, oder die Vorfreude.
Die Hinwege fallen gerade meist leichter, was nicht allein daran liegt, dass es Richtung alte Heimat geht: Am Ufer entlang, kurz bevor die Sonne untergeht, immer noch einen Blick über die Schulter werfen, auf das Abendrot über den letzten Ruinen an der anderen Seite des Ufers. Hauptsächlich sind es aber wirklich die Menschen, wegen denen ich den Weg gerne auf mich nehme, erstaunlicherweise. Vielleicht sogar ein spezieller Mensch.
Immer wieder Überraschungen & neue Welten: Erst tauchte auf der rasanten Abfahrt, genau dort, wo es scharf & eng um die Ecke geht, kurz vor dem Anstieg zum Schiffbauerdamm, wie aus einem Zeitloch gesprungen ein Hochradfahrer auf. Knapp zweieinhalb Meter über dem Boden sitzend, komplett in Frack und Zylinder.
Das Highlight später am Abend wartete dann in dem (sowieso schon spektakulären) blinkenden Merchkoffer der Schweizer Surfband: Eine Art Fanzine, so sagen sie, aber eigentlich ist es ein großartiger kleiner Fotoband über die Punkszene in Indonesien. Wo sie Inseln besetzen, um Konzerte zu feiern, als ob es kein Morgen gäbe. Wobei das Heft angenehm an das Gestern erinnert, an die Little Mags, an die Zeit, als mich das noch viel mehr beschäftigte, als ich dafür zur Minipressenmesse fuhr und mir von Hadayatullah Hübsch ebendiese Welt erklären liess.
Jetzt also ein Neuanfang, das kann man wohl inzwischen so sagen, da gibt es kein Drumherum mehr. War natürlich nicht so geplant & schon gar nicht abzusehen, aber das ist bei Neuanfängen ja ein Allgemeinplatz. Trotzdem schön.
Ganz im Gegensatz zu einem anderen Kapitel, was sich geschlossen hat, leider endgültig. Viel zu selten war ich in den letzten Wochen, sogar Monaten dort, und daran war nicht nur die Sommerpause schuld. Sondern auch der Neuanfang, zugegeben. Da hilft es jetzt auch nichts mehr, sich wieder öfter an diesem Tresen blicken lassen zu wollen: Udo wird nie wieder dahinter stehen. Was ziemlich beschissen ist.
Auf diesen faulen Zauber hätte ich gut verzichten können, Anfang hin oder her.
24.11.14
Keine Lust haben.
Auf Nichts.
Kapitulieren.
Vor Allem.
Hauptsächlich liegen.
Schlecht schlafen;
zu unmöglichen Zeiten.
Nicht gerade förderlich,
wenn eine halbe Stunde
nach dem Aufwachen
die Sonne untergeht.
Der Regen und das Grau
bleiben.
Nichts mehr wollen,
nichts mehr hoffen.
Doch: Das Ende.
Doch das Ende sieht noch
einen schwachen Funken
glimmen
(sein Name sei Angst)
und hält sich zurück.
Noch.
29.06.15
Bei den Millionen, die hier wohnen,
wird sich’s wohl lohnen, keinen schonen,
lassen sich doch alle klonen, sind wie Drohnen,
kippt einer um rückt der Nächste nach.
Keine Bange, die stehen lange
in der Schlange, Stunden, Nächte, dank dem Zwange
durchzuhalten, andre Wange, Ankunft Ende Fahnenstange,
haben keine Wahl.
I. Früher, vor über zwei Monaten
Der Krieg hängt schief, nur noch durch eine Reißzwecke mit der Wand verbunden, und flattert im Wind. Ich hatte ihn aus Hamburg mitgebracht, das Plakat zur Dix-Aussstellung, von allen für gruselig befunden, auch von der Garderobenfrau der Kunsthalle, die mir half, es graulegal einfach von der Wand zu nehmen; sie mochte es sowieso nicht.
Und jetzt, von den allabendlichen Stürmen, die vor den Gewittern kommen, wurde der Krieg zerzaust, hängt nur noch an einem Knopf an der Wand, als ob er wüsste, dass es hier zuende geht, er sowieso bald in der Umzugskiste verschwinden würde. Und ausserdem: Krieg ist ja eh gerade genug, gar so viel, dass er nurmehr zur Kenntnis genommen wird.
II. Derzeit
Irgendwie komplett aus der Bahn, passend zur Gesamtsituation. Schreiben versteckt sich noch, wartet in einer verstaubten Spinnenwebenecke darauf, abgeholt zu werden. Mit dem Lesen ist es auch nicht viel besser.
Obwohl: Die alten Titanic-Jahrgänge, geerbt & mitgenommen, nach und nach: Perfekte Klolektüre. Mit viel infantilem Müll, aber auch Perlen. Sogar etwas gelernt: Ich musste es ungläubig nachschlagen, aber es stimmt: Das Innenministerium in Ungarn heisst in der Landessprache Belügyminisztérium. Passend, irgendwie. Das ist alles so absurd.
Nicht mal geschafft, bei den zwei, drei Lieblingsblogs nach und nach wieder auf den neuesten Stand zu kommen. Spiegel online, mal kurz nachgeschaut, das war das Maximum in den letzten Wochen. Und die bringen gefühlt jeden Tag einen Artikel über Keith Richards – da läuft doch garantiert irgendein Deal mit dem Management dachte ich mir, wen zur Hölle interessiert denn noch Keith Richards? Täglich?
Ansonsten hatten sie noch eine Knallermeldung zur Drogenszene in Ulm: Es wurden acht Dealer mit insgesamt 250 Gramm Gras hops genommen. Woanders würde das unter Eigenbedarf verbucht werden, Einunddreissigeinviertelgramm pro Nase.
Am selben Tag, abends, oder am nächsten morgens, in der Realität, die mir viel zu viel Zeit stiehlt gerade (aber ich habe es mir ja selbst ausgesucht), eine Erinnerung aufgefrischt, die schon bald Jahrzehnte im Archiv lag: Menschen, die so betrunken sind, dass sie sich unbedingt prügeln wollen. Die sich dann auch nach langem Hin und Her ein paar einfangen. Und es hat mich nicht mal aufgeregt, Adrenalin hatte schon Feierabend, halb Fünf war’s.
30.03.04
Wenn ich müde bin, dann
setze ich mich jetzt so in den Sessel,
dass ich aus dem Augenwinkel noch mitbekomme,
wenn im Fernsehen mal wieder
Hamburger Studenten in Hochhäuser fliegen.
Samstagnachmittag, die Stadt dampft noch; oder wieder – jedenfalls ein letztes Aufbäumen des Sommers, wenn man dem Wetterbericht vertraut. Politik war hier lange absent, beabsichtigt. Sprachlosigkeit allerorten angesichts der erschreckenden, überspitzten Parallelen, die sich zum Anfang der 90er Jahre auftun wie Abgründe. Statt alle paar Wochen brennt jetzt jeden Tag irgendwo eine Unterkunft von Asylsuchenden. Andererseits: Beständig, mindestens seit Anfang der 90er Jahre. Und schon viel länger, fürchterlich fruchtbarer Schoß, könnte man fast eine anthropologische Konstante dahinter vermuten.
Auf dem Weg zum 20jährigen Geburtstag des Schöneberger Jugendmuseums, dreissig Prozent Lust, siebzig Prozent Pflicht, sich langsam umkehrend im Laufe des Abends. Mit dem Rad durch Moabit, Tiergarten, Schöneberg – die Eisenacher vom Anfang bis zum Ende. Viel öfter jetzt durch den Tiergarten als früher, obwohl er da viel näher dran war. Die Else, auf dem Rückweg immer noch ungleich schöner, in der Abendsonne, die von Tag zu Tag besser wird. Herbstvorfreude.
Freigehalten, trotz der alles andere als lästigen Verpflichtungen, hatte ich mir den Film, der so gar nicht zu der Feierlaune passte. Und sich doch gut in den Abend einfügte – nicht ohne Grund wurde dieses Museum vor 20 Jahren genau so aufgezogen, mit diesem IntegrationsInklusionsWasauchimmer-Ansatz. Der sich durchaus bewährt hat, vieles wurde richtig gemacht, vieles gemacht überhaupt. Auf der anderen Seite (und einer anderen Baustelle) versucht ebenjener Bezirk gerade, das älteste selbstverwaltete Jugendzentrum der Stadt aus den angestammten Räumen zu drängen.
Deshalb also – und natürlich wegen der schockstarren Aktualität – passte „Solingen 93/13“ so gut in das Festprogramm, wenn auch mit hartem Schnitt. Der Film ist zwanzig Jahre nach Solingen entstanden, etwas über eine halbe Stunde lang und besteht hauptsächlich aus Interviews und Gedankenmonologen des Regisseurs Mirza Odabaşı. Der im Übrigen den Film fast komplett selbst gestemmt hat, bis zur Finanzierung. Die im Abspann so schön zu lesende Förderung durch den nordrhein-westfälischen Integrationsrat kam – wie er nach der Vorführung trocken bemerkte – erst im Nachhinein.
Es ist das Werk eines (wenn ich mich recht erinnere) Fünfundzwanzigjährigen – und dafür recht beachtlich, nicht zuletzt wegen der Gesprächspartner, die er gewinnen konnte. Eine gute Mischung, das Spektrum reicht von Afrob bis Michel Friedman, der so gar nicht auf Krawall gebürstet war und bedächtig-kluge Sachen sagte. Höhepunkt des Films ist fraglos das Interview mit Mevlüde Genç, der Frau, die durch den rassistsichen Anschlag zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte verlor, vor ihren Augen. Schon allein deshalb ist er sehenswert.
Sicherlich, Mirza Odabaşı hätte weiter gehen können. Vergiss nicht, Thilo Sarrazin ist kein Mitglied einer rechtsradikalen Partei. gibt er zu bedenken – dass Sarrazin immer noch SPD-Mitglied ist, hätte man durchaus erwähnen können, auch um die gesellschaftliche Verfasstheit dieses Landes richtig auszuleuchten.
Doch seine Interviewpartner übernehmen diesen Schritt teilweise für ihn, etwa wenn Cem Özdemir von Trauer zweiter Klasse spricht, oder Michel Friedman meint: Ich habe im Deutschunterricht das Wort untersensibel nie gelernt, also gibt es das Wort übersensibel auch nicht. Es gibt sensibel oder nicht sensibel.
Ich konnte nach dem Film nicht mehr lange still, nicht mehr lange sitzen bleiben, musste raus in die Spätsommerabendluft tauchen, noch ein Getränk und dann durch die Nacht nach Hause fahren. Dachte mir noch, dass der Film gut war, aber dass Glumms Solingen-Erinnerungen mich noch mehr gefesselt hatten. Dass man vielleicht beides zusammen bringen sollte, und noch viel mehr. Doch wann ist ein Bild komplett? Und dass immer noch – ich hab es schon öfters erwähnt, ich weiss – The Truth Lies in Rostock derjenige Film ist, der mir zum Thema am heftigsten den Stecker zieht. Subjektiv, natürlich, und begründet.
Und dass es schon schön ist, dass so viele Leute sich an so einem heissen Abend zusammendrängen in schlechter Luft und solche Filme ansehen, aber sie ja in der Zeit auch irgendwo konkret Hilfe leisten könnten. Doch kurz bevor ich unter der Schering-Werbung abbog, die schon lange vom Mutterkonzern geschluckt wurde, verwarf ich diesen Gedanken gleich wieder, weil ich in den letzten Wochen – neben den Abgründen – auch erstaunlich viel Hilfsbereitschaft und Empathie aus den überraschendsten und unterschiedlichsten Ecken mitbekommen habe, meist ganz still & wie selbstverständlich geleistet. Und wusste dann nicht genau, ob es an der Spätsommernacht lag, dass ich auf einmal fast in versöhnlicher Stimmung war. Oder ob es wirklich Hoffnung gibt. An der neuen Haustür klebte ein Zettel mit dem allgegenwärtigen Refugees welcome-Logo und einem Aufruf, Schulsachen zu spenden. Die Ferien sind vorbei.
Mirza Odabaşı: Solingen 93/13, vom Regisseur dankenswerterweise selbst auf Youtube zur Verfügung gestellt.
Viel zu wenig Bilder habe ich von der Kreuzberger Wohnung gemacht, rückblickend betrachtet. Und vieles, was noch auf dem Film war, der während der Umzugs bis jetzt in der Kamera lag, ist leider misslungen. Trotzdem ein paar Eindrücke von den letzten Kiezstreifzügen und Wohnungsbesichtigungsexpeditionen, aus einer Zeit, die schon ewig her scheint und doch gerade mal einen Monat in der Vergangenheit liegt.
Der Blick aus dem Küchenfenster auf das Hinterhaus – an dem Haus musste wirklich was gemacht werden, in dieser Ecke stürzte bei Regen immer ein veritabler Wasserfall in den Hof (und in einige offene Fenster…). Aber es hätte auch anders gemacht werden können. Jetzt wohnt in diesem Teil des Hauses niemand mehr.
Der Blick auf die Strasse, hier auf die Häuser gegenüber, leider klemmte der Film wohl etwas. Das Banner (Wir helfen hier Flüchtlingen, wann hilft der Senat?) hing schon wochenlang, bevor ich auszog. Einiges aus unserer Wohnung konnte dort noch gebraucht werden, so hatte der Umzug auch sein Gutes, immerhin.
Gesammelte Botschaften von Hauseingängen und Häuserfronten I
Gesammelte Botschaften von Hauseingängen und Häuserfronten II
Und immer wieder das EINE Thema, schön wär’s…
Eine Frage, die sich mir immer wieder stellt: Warum dieses hässliche Grau? Hier im Bild irgendwo in Neukölln, aber ebenso & noch hässlicher schon gesehen beim Neubau auf dem Gelände der alten Filmfabrik in Köpenick: links und rechts ein paar alte Backsteinmauern, der Neubau in der Mitte hässlichgrau, aber dafür 2000 Euro kalt für die 130qm-Dachetage.
Die Fortsetzung aus Neukölln:
Zwei Strassen weiter, die Aussage etwas künstlerischer gestaltet:
Eine Botschaft aus dem neuen Kiez:
Zum Schluss: Der King ist natürlich mit umgezogen und tanzt jetzt am Waschtag im Wedding statt in Kreuzberg…
Ich habe keine Ahnung, wie ich in die alten Routinen zurückkomme. Ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt will (eher nicht, oder eher nur die Rosinen).
Ein paar neue haben sich schon etabliert, wenige alte sind neu in Angriff genommen worden, womit ich ganz glücklich bin & die Hoffnung geben, weil: Ein halbes Jahr stand das Rad in der Ecke, vernachlässigt nur wegen des Plattfusses, langsam Staub und Rost ansetzend – und kaum war es wieder fit gemacht, hat es auch schon tausend Kilometer auf dem Zähler. Wiederbelebung funktioniert also.
Neu dazugekommen ist das Schwimmen: Während ich mich in den Berliner Anfangsjahren vehement weigerte, in Süsswasser zu baden, kam dies später dank dem Hund und den Grunewaldseen schon öfter vor (& wäre jetzt de jure nicht mehr möglich). Doch das war Spass und Planscherei, regelmässig belohnt mit Hundekrallenkratzern auf den Oberschenkeln.
Durch Herrndorf kam ich auf die Idee mit dem Plötzensee (und durch die mangelnde Fitness, die mir im Frühjahr furchtbaren Rücken bescherte & mich beim Umzug erstaunt feststellen liess, dass Waschmaschinen tragen früher viel leichter war). Seitdem mindestens alle zwei Tage eine ernsthafte Runde im keine zwei Kilometer entfernten Plötzensee, möglichst früh, um die knapp über der Wasseroberfläche segelnden Schwalben auf dem Rücken treibend beobachten zu können & sich für einen Moment als einen Teil des großen Ganzen (& glücklich) zu fühlen.
Dann für zwei Tage, nachdem der gröbste Umzugsstress bewältigt war & das Hochbett stand (das dritte, welches ich in Berlin errichtete) wieder dorthin, wo es zum Jahreswechsel so toll war. Auch im Sommer nahezu perfekt, dank einem Kanal, in den man vor dem Frühstück springen konnte, um ein paar Runden zu drehen. Und der vielen Seen drumherum, auf denen wir viel zu wenig paddelten, aber immerhin.
Natürlich war ein Hund dabei, der ausgiebig bespielt, bespasst und bepuschelt wurde, reine Ersatzhandlungen. Natürlich dachte ich mir, wie es gewesen wäre, wenn…
Der Höhepunkt war sicherlich der Abend, die Nacht in der Heide. in der Dämmerung losmarschiert, um die Sternschnuppen zu erhaschen, mit Blicken und Wünschen. Irgendwann kamen sie, nachdem wir lange den sich nur allmählich herausbildenden Sternenhimmel beobachteten. Die Erkenntnis: Man müsste viel öfter mit dem Rücken im Gras und den Augen nach oben einfach so in der nächtlichen Natur liegen, ob mit Perseiden oder ohne.
Das Rad hat die Gepäck-Feuerprobe bestanden, jetzt ruft die Ostsee & ich kann es kaum abwarten, diesem Ruf zu folgen. Auch wenn die Wiedereinführung alter Gewohnheiten dadurch noch weiter hinausgezögert werden wird.
09.02.04
Die sitzen doch bloss
den ganzen Tag
auf dem Sofa
arbeitslos und schauen fern
wie der Fischer
Aussenministerquatsch
erzählt.
26.03.14
Nach fünfzehn Jahren
trennt man sich doch nicht
so einfach. Sagte er.
Hab ich ihr auch gesagt,
hat nichts genutzt,
entgegnete ich.
Und von einfach
kann sowieso
keine Rede sein.
Sechs Jahre sind vergangen, seit wir die letzte Party geschmissen haben. Geschmissen werden hier in letzter Zeit eher wackersteingrosse Putzbrocken. Aus den obersten Fenstern. In den Innenhof. Ohne dass da irgendwer steht und aufpasst. Die neuen Eigentümer lassen keinen Zweifel daran, dass sie die wenigen verbliebenen Leute aus dem Haus haben wollen, so oder so.
Trotzdem wir aus der Übung waren, lief der Abschied ganz gut & würdig ab. Sagen die, die sich daran erinnern können. Inzwischen ist es die zweite Nacht in der neuen Wohnung, begreifen kann ich das noch längst nicht, das wird wohl mindestens so lange dauern wie das Auspacken der Kisten. Vorsorglich hatte ich gestern am Tresen Bescheid gegeben, dass sie mich – wenn ich losfahre und falls mein Zustand es nahelegt – darauf hinweisen, nicht in Richtung Kreuzberg zu fahren.
Der Heimweg hat sich um enorme fünf Kilometer verkürzt, doch dank der garstigen Weddinger Wurzeln habe ich mich zur Premiere erst mal amtlich mit dem Rad auf die Fresse gepackt. Immerhin: Die Wegbierflasche blieb unversehrt; ich eher nicht, im Allgemeinen wie im Speziellen. Licht und Schatten.
Als nach der Party der Umzug vorbereitet wurde, saugte ich den Kreuzberger Hauptstrassenhochbahndreck leidlich von den Möbeln – zumindest den werde ich nicht vermissen, ebensowenig wie die unvermeidlichen Schichten feinster Kohleofenasche. Nachdem ich allerdings die Couch ausklappte und mir gleich drei große Hundehaarwollmäuse entgegenwehten, zog es mir doch nochmal den Boden unter den Füssen weg.
Wedding also. Da wusste ich wohl vor vier Monaten mehr als vor drei Wochen.
Nett hier. Natürlich muss die Gegend erst noch ausführlich erkundet werden & die Wohnung eingelebt (von eingeräumt mal ganz zu schweigen), bevor ich mir ein erstes Urteil erlauben (und meine Gedanken endlich um neue oder zumindest andere Themen kreisen lassen) kann. Aber ich deute es als gutes Omen, dass mir, als ich in die Kneipenrunde fragte, was es denn in der Gegend so Empfehlenswertes gäbe, ein Italiener in Reinickendorf ans Herz gelegt wurde. „Dit hat der Kleene im Internet gelesen und erzählt’s jetzt Jedem, der es nicht hören will. Jaja, wissen wir alle: Supertext, Superessen, blabla. Reinickendorf, Alta! Nicht dein Ernst, oder?!“ meinte die Frau hinter der Bar dazu nur. Und: „Noch ’nen Kurzen auf den Einzug?“
Gute Leute.
(Von der Berg- und Talfahrt der letzten Tage nun die Talfahrt. Und damit abschliessend das Ende jedweder Ära.)
Ich hatte schon im November abgeschlossen, zumindest ernsthaft damit angefangen; Nierenversagen, das hörte sich nicht so an, als ob da noch viel zu machen sei, vor allem bei dem Alter und der Vorgeschichte. Und dann schaffte sie es doch über die Nacht. Ich bin damals nicht hingefahren, und ich weiss nicht, ob ich es jetzt machen werde. Doch ich weiss jetzt, dass es zu Ende geht. Die Spritze ist bestellt.
Vor einem Jahr habe ich sie das letzte Mal gesehen. Noch einen schönen halben Sommer mit ihr gehabt, am Kanal und im Grunewald. Ihre alten Reviere; Westentasche. Den einen hohlen Baumstamm am Trimm-Dich-Pfad, der selbst im heissesten Sommer wenigstens immer noch ein bisschen Modderwasser für sie übrig hatte – sofort wiedergefunden. Und das, obwohl sich ihr Revier zu dem Zeitpunkt schon zwei Jahre lang am Rhein erstreckte. Davor pendelte sie, danach ebenfalls, ein Jahr noch als Scheidungskindhund. Bis zum letzten Sommer, als sie langsam schwächer wurde.
Dann beschlossen wir, dass es besser für sie wäre, an einem Ort zu bleiben, und die Vernunft sprach gegen Berlin. Entgegen den Erwartungen hat sie es doch über den Jahreswechsel geschafft, im Frühling sogar noch ihren Fünfzehnten erreicht. Sicher, sie baute merklich ab, ich konnte das nur aus der Ferne verfolgen. Das schmerzte. Anfangs sehr, dann (dachte ich – und war überrascht) nicht mehr so sehr. Dann dachte ich genau darüber nach und fand heraus, dass es noch genauso weh tat, ich nur nicht mehr ganz so oft an sie dachte.
Es mag verrückt klingen, aber es gab nichts und niemanden,den ich mehr geliebt hätte als diesen Hund. So bedingungslos, ohne jeden Groll. Nichts tat mir mehr weh und nichts machte mich ohnmächtiger als ihre gelegentlichen Panikattacken, Verletzungen, Unfälle. Sie hat nicht viel ausgelassen. Kaum etwas machte mich glücklicher, als ihr dabei zuzuschauen, wie sie sich im Schnee oder im Strandsand wälzte, wie sie spielte, rannte, träumte – und vor allem schwamm. Das wäre mein Wunsch gewesen, hätte ich einen frei gehabt: Zu wissen, wo die Angst herkommt. Wo der Schmerz sitzt. Warum sie wie irre geworden Gras frisst. Wie sich das anfühlt, mit allen Vieren in der Luft auf dem Rücken rumzuzappeln, im Gras oder im Sand, oder in einem toten Fisch.
Natürlich kann man einem Hund nichts erklären, und doch macht man es manchmal. Schlimmer ist es aber umgekehrt: Wer weiss, wie oft der Hund vergebens versuchte, einem etwas mitzuteilen. Trotz aller Hundeflüsterertips und jahrelanger Verhaltensforschung: Hunde können Menschen tausendmal besser lesen als umgekehrt. Encyclopaedia Britannica versus Räuber Hotzenplotz. Nur einmal wissen, was in diesem Kopf vorging…
Eigentlich bin ich ganz arglos und rein aus Interesse dabei geblieben, als bei der Hündin von unseren Freunden die Wehen einsetzten. Und dann war plötzlich dieses braune Fellbündel da. Und jetzt ist es weg. Bis dahin war ihre Mutter mein einziger Bezugshund: aus einem schrecklichen Haushalt gerettet, für den sie nicht Rottweiler genug war & wo sie mehr gelassen hat als ihren Schwanz, der gleich als erstes abkam. Ein großartiger Hund, die beste Mutter und viel zu früh gestorben – bei ihr schlug der Krebs mit sechs Jahren zu, ihre letzten beiden Kinder wurden erst jetzt von ihm erwischt. Neun Jahre von oben.
Endlich einmal ist auch irgendwann mal vorbei. Es ist schwer, passende Worte zu finden, doch dazu schweigen würde ihr nicht gerecht werden. Ich hoffe, ich konnte ihr mehr als einen Namen geben. Bei all dem, was ich von ihr und durch sie bekam, wäre ich froh, hätte ich ihr nur einen Bruchteil der Freude zurückgegeben, die sie mir schenkte.
Bei 60 habe ich aufgehört zu zählen, deshalb kann ich nur grob überschlagen: gute zweieinhalb Monate dauerte die Suche, es gab Wochen, in denen ich an drei oder vier Tagen fünf oder mehr Besichtigungen hatte – 80 Wohnungen waren es sicher, wahrscheinlich sogar über 100. Seit knapp einem Monat absolvierte ich die Termine meist mit dem frisch überholten Fahrrad, der Kilometerzähler hat die 500 überschritten.
Und dann war es irgendwann doch soweit, als die Zweifel schon immer größer wurden, als längst die Erkenntnis eingesetzt hatte, dass dies eine reine Lotterie war: Irgendwann ist alles in der Bewerbung drin, was man rausholen bzw. reinstecken kann; irgendwann weiss man, welche Termine man sich sparen kann, weil dort prinzipiell nicht an arme Menschen vermietet wird; irgendwann erkennt man, dass es auch eine Glückssache ist – es kann nach einer Woche klappen, oder nach einundfünfzig.
Wie bei anderen Glücksspielen auch versucht man, die beeinflussbaren Faktoren so gut wie möglich zu steuern: Der Radius wird vergrössert (Lichtenberg, Niederschöneweide, Neukölln ist sehr gross…), die günstigsten Zeiten werden abgepasst, Anzeigen werden auch jenseits der ausgetretenen Pfade gesucht.
Die eine oder andere Überraschung gab es natürlich auch: Immer noch Wohnungen mit Ofenheizungen, diversester Art sogar: Vom klassischen Kachelofen bis zur Forster Heizung, Nachtspeicheröfen und auch einige Gamats. Gamate. Wie auch immer. Ich war in Häusern, in denen vor knapp zwanzig Jahren Freunde wohnten und die bis heute nicht saniert wurden. Ich habe Schimmel dessen sich nicht geschämt wurde gesehen und totsanierte Wohnungen, wo aus 25 Quadratmetern alles rausgeholt wurde, bis auf einen Platz für die Waschmaschine.
Und dann erreichten mich an einem Tag gleich zwei gute Nachrichten (schlechte gab es jeden Tag, wenn überhaupt): Bei einer Wohnung war ich in der Runde der letzten Fünf, die andere hätte ich sicher. Natürlich wählte ich die sichere Variante, wenn dadurch auch eine mögliche Genossenschaftsmitgliedschaft verloren ging – Unsicherheit hatte ich genug gehabt in letzter Zeit. Sonst nahmen sie sich nicht viel, im Gegenteil. Und das Beste daran: Ich wohne jetzt ziemlich genau da, wo ich hinwollte, wo ich schon vor gut sechs Wochen kaum zu hoffen wagte, wohnen zu dürfen. Von Kanal zu Kanal, keine 300 Meter vom Deichgraf entfernt, was ich natürlich sofort genau mit dem Fahrrad nachgemessen habe. Danke also für all die guten Wünschen und das Daumendrücken – ich habe schon fast nicht mehr daran geglaubt, jedenfalls nicht an die Ermutigung von Rob, dass ich weiter versuchen sollte, in dieser Gegend etwas zu finden.
Wie sich herausstellte, schliesst sich damit sogar ein etwas skurriler Kreis: Die Strasse ist nach einem Adelsgeschlecht benannt, für das sich mein Urgroßvater einst auf deren Gut verdingte.
Eine sentimentale Abschiedstour werde ich mir nicht verkneifen können, zum Tabakladen, zum Getränkehändler um die Ecke, zum Casolare und zur Eisbude am Kanal. Doch es war andererseits auch längst kein Spass mehr: Die Bauarbeiten sind in vollem Gange, in den drei Hausflügeln sind nur noch sechs Wohnungen bewohnt. Sie haben gewonnen.
Natürlich werde ich weiterhin regelmässig mein zweites Wohnzimmer aufsuchen; Kreuzberg wird immer ein besonderer Ort für mich bleiben, und wer weiss, vielleicht ist genau jetzt Zeit, zu gehen. Für mich. Gestern kamen wir drauf, in der Kneipe im Wedding, in die ich jetzt schon viel zu oft gehe: Wir wohnten beide mal in der O-Strasse, Ende der Neunziger, und waren uns einig, dass das jetzt die Hölle wäre.
Ich bin also froh darüber, dass ich für zwei Zimmer (und 50qm) weniger 50 Euro mehr Miete zahle. Ehrlich glücklich. Weil ich es viel schlimmer hätte erwischen können. Verrückte Welt.
In einer Woche, habe ich mir vorgenommen, darf ich in Panik verfallen, vorher nicht. Bis dahin wird der Plan abgearbeitet, wie jeden Tag in den letzten zwei Monaten; Lottospielen als Vollzeitbeschäftigung: Inserate durchforsten, Termine ausmachen, dort auftauchen und wissen: Es muss nicht mal einer von den 30 Leuten sein, die hier rumstehen. Gut möglich, dass die denen alle nicht passen, dann steht die Anzeige halt in zwei Wochen wieder drin, alles schon gehabt.
Der Feedreader und das Lesen von Blogs (immer und bei jeder passenden Gelegenheit von mir gepriesen) – seit Wochen nichts. Unmotiviert, kraftlos, sinnlos, so kommt mir das alles gerade vor. Da ich gerade noch so merke, dass sich das auch auf meine Bloggerei auswirkt – immer die gleiche Leier & dann auch noch so monoton – sollte hier wohl erst mal Ruhe sein.
Jedoch: Ab und zu gibt es auch Lichtblicke. Letztens, auf dem Weg ins zweite Wohnzimmer, am Anfang der Friedrichstraße beispielsweise. Ein typischer, tiefergelegter und breitbereifter BMW, aus dem die Bässe wummerten. Allerdings nicht die erwarteten Gangsterrapbässe, sondern die der Zeckenrap-Ansage. Welch eine positive Überraschung, vor allem, da ich ein paar Tage zuvor gerade viel Spass mit den Zeckenrappern hatte, in ebenjenem zweiten Wohnzimmer.
Noch ein kurzer, wichtiger Hinweis bevor ich euch hier mit meinem bevorzugten Musikvideo aus dem Genre allein lasse & in den Sommer schicke:
Der Baiz-Film, über den ich an anderer Stelle schrieb, läuft am 21.08. um 21 Uhr in der Freilichtbühne Weissensee. Danke, Matthias! (Nicht, dass ich vor hätte, solange Pause zu machen, aber sicher ist sicher…)
PS. & Update: Meine Scheuklappen haben zugeschlagen, nur noch auf eine Sache fokussiert… Sonst hätte ich sicher darauf hingewiesen, dass es (in Berlin) heute gestern eine (leider sehr mäßig besuchte) Gelegenheit gab, gegen die Asylrechtsverschärfung zu demonstrieren und danach/dabei Zeckenrap zu hören. Zum Glück morgen heute auch nochmal.
22.08.04
Manchmal würde ich gern ein Buch darüber schreiben,
wie es ist, ein Schriftsteller zu sein.
Oder wenigstens ein Gedicht.
Wie es ist, früh aufzustehen und
um zwölf schon drei Seiten
geschrieben zu haben.
Die werden dann am Nachmittag
verworfen.
So richtig als zusammengeknülltes Blatt
in den Papierkorb.
Und die Schreibmaschine wird neu bespannt.
Wenn mir die Inspiration fehlt,
gehe ich eine Runde
mit dem Hund spazieren
und atme frische Luft.
Abends werde ich der Frau
die mich liebt,
ohne Scheu und Scham
vorlesen, was vom Tage übrigblieb.
Nun bin ich allein.
Habe weder Frau noch Hund
noch Schreibmaschine
und sitze den ganzen Tag nur so rum.
29.04.10
Während im Bonner Haus der Geschichte
seine Nike-Turnschuhe vor sich hin müffeln,
stellte Joseph Fischer
bei seiner Antrittsvorlesung an der Heinrich-Heine-Universität
in bewährter Oberlehrer-Ex-Aussenministermanier
eine Frage,
die natürlich nur er beantworten konnte:
Wann denn wohl die erste EU-Osterweiterung war?
Am 3. Oktober 1990
antwortete er sich stolz selbst
und grinste auch selbst gefällig.
Am gleichen Tag
gab es auch noch
bedeutende außenpolitische Vorträge
von seinen beiden
Nachfolgern.
Helmut Schmidt hatte Wichtigeres zu tun,
er musste den Aschenbecher ausleeren.
(3te Variation)
Prolog
Es war auf der ersten Südafrikareise, eine Art guilty pleasure, wofür ich immer noch keinen passenden deutschen Ausdruck gefunden habe. Dort lief mir „The Beach“ das erste Mal über den Weg. Einfach zu passend.
Südafrika war besonders. Wir waren nicht mehr frisch, aber wohl immer noch sehr verliebt. Kuba, im Jahr zuvor die erste große gemeinsame Reise, war gut & gut gegangen. Doch lange nicht so aufregend wie mein Trip von DC nach Michigan, direkt nach dem Abi. Südafrika jedoch, das war…
Eine Freundin zog dort hin, studierte und heiratete schliesslich. Irgendwann mittendrin hatten wir endlich genug Geld und Mut beisammen, um sie zu besuchen. Damals war das Land (nicht zuletzt dank deutscher Intrigen) weit entfernt von der Gastgeberrolle der Fifa-WM, dafür weit vorne in der Mord-pro-Kopf-Rate – und Mandela gerade zehn Jahre frei, die ersten freien Wahlen 6 Jahre her. Es war kompliziert und überwältigend auf so vielen Ebenen. Doch darum soll es hier ja gar nicht gehen.
Eine der unvergesslichen Erfahrungen war jedenfalls das Backpacking von Ort zu Ort, das sogar halbwegs gut ohne Mietwagen mit einem eigens dafür geschaffenen Kleinbusnetz funktionierte. In einem der Hostels (Backpacker sagte man dort) – und darauf wollte ich hinaus – gab uns eine englische Reisende ihr ausgelesenes Exemplar von „The Beach“ in die Hand; die Verfilmung davon war zu der Zeit gerade in den Kinos, aber keiner von uns hatte sie bisher gesehen. Der Dritte im Bunde nahm das Buch als Erster an sich und war sehr schnell damit fertig. Schon seine vagen Andeutungen liessen es mich kaum erwarten, es als Nächster zu lesen. Eben – das passte einfach alles & zu gut: Die Strände, die Berge, das Gras – und jeder war irgendwie auf der Suche nach den Orten, die von kaum jemanden gefunden wurden.
Schon allein deshalb, weil das Buch untrennbar mit diesen fantastischen Wochen verbunden war, wollte ich mir den Film eine ganze Weile nicht anschauen. Irgendwann war es dann aber doch so weit, es kann gut sein, dass es zusammen mit den Beiden war. Auf der Leinwand, mit dem Beamer, wie wir das so oft machten, zu viert. Ich weiss noch, dass ich von den Bildern begeistert, vom Film aber enttäuscht war. Und ich weiss, dass Sie diesen einen kitschigen Song mochte. guilty pleasure.
***
Wir lernten die Beiden kurz nach dieser Reise kennen, der Hund war gerade zehn Wochen alt. Bis dahin führten die meisten Ausflüge mit dem kleinen Tollpatsch in den Treptower Park. Dort, am Ufer eines kleinen Sees, trafen wir Sie zum ersten Mal. Und ihren zehn Wochen alten Labradorrüden.
Sie waren um die zehn Jahre älter als wir, und dies und das, doch das zählte alles nichts, eigentlich, weil: Die beiden kleinen Trottel verstanden sich einfach zu gut, als dass das nicht hätte klappen müssen.
Ein Glückstreffer, wie sich herausstellte. Sicher, diese Pärchen-Pärchen-Geschichte ist ein Klischee aus amerikanischen Fernsehserien, doch was nicht?
Ohne den Hund wäre es unwahrscheinlich – nicht unmöglich; nicht damals, nicht in Berlin – gewesen, dass wir uns gefunden hätten. Dafür waren wir doch zu unterschiedlich, in Welten unterwegs, die sich zu selten überschnitten (Er war einer der jüngsten Führungskräfte in seiner Branche, ausgestattet mit einer Senator-Karte der Lufthansa – wir wussten nicht einmal, dass es so etwas überhaupt gab). Da war Ihr Musikgeschmack noch das Geringste.
Der sorgte allerdings dafür, dass ich im Jahr darauf die (wieder fantastische, wenn auch ganz andere) Zeit in Südafrika mit dem Cafe-del-Mar-Remix von Bushs „Letting the cables sleep“ verbrachte, den Sie mir auf einer Mix-CD mitgegeben hatte. Und der passte zu einigen Sonnenuntergängen am Strand auf die selbe Art wie im Jahr zuvor „The Beach“. guilty pleasure.
Was schon mal an sich nicht schlecht ist, im Gegenteil. Doch habe ich den Beiden noch weitaus schönere Momente zu verdanken.
Ein – oder der – Wermutstropfen war, dass Sie sehr beschäftigt waren, noch viel mehr als wir. Jetzt mal ganz abgesehen von der Arbeit, die ein zehn Wochen alter Welpe macht. Das liess sich zum Glück ja verbinden – Sie waren es, die uns den Grunewaldsee und die Krumme Lanke zeigten. Trotz der rührendbesorgten Hundegrosseltern kannten wir den Grunewald noch nicht, waren aber immerhin schon mit der Welpenbande in deren siebenter Woche in einem Karren zum Wannsee gefahren, doch führten die ersten Ausflüge der Punkerhundewelpen meistens in den Görli, dahin war die Reise auch nicht so lang & anstrengend.
So sahen wir uns zwar oft einzeln mit den Hunden im Wald, aber richtig zusammen zu viert höchstens einmal im Monat. Das führte zu unvergesslichen gemeinsamen Spaziergängen, mal mit der größeren Gruppe, die sich im Grunewald gefunden hatte (&mindestens eine eigene Geschichte wert ist), mal nur zu zweit. Die Beiden hatten einen großartigen Humor, jeder von Ihnen konnte einen auf spezielle Art dazu bringen, Tränen zu lachen oder die Welt um uns herum für einen Moment zu vergessen.
Irgendwann zogen Sie in ein Dachgeschoss im tiefsten Charlottenburg, irgendwann wurden die Hunde älter und die Routinen andere. Das alles tat unserer Beziehung jedoch keinen Abbruch. Kurz nachdem Sie uns den Grunewald gezeigt hatten, machten Sie uns mit den Künsten von Mr.Hai bekannt, Olivaer Platz. Seitdem war wenigstens das gemeinsame Essengehen ein fester Termin, den wir uns alle freihielten. Oft genug kam was dazwischen, doch oft genug gab es dazwischen auch diverse Gelegenheiten, Partys, Ausflüge oder Filmabende.
Wir lernten durch Sie interessante neue Menschen kennen und umgekehrt. Nie werde ich vergessen, wie alle zusammen das Finale der WM 2002 im Kuchenkaiser begingen, zu Ehren der Brasilianer wurde ständig mit Caipirinha angestossen, mittags um eins. Für den Anfang, der Tag war ja noch lang. Nach dem Abpfiff zogen wir in die Dresdener, wo einer von unseren Freunden wohnte, und dort ein paar Bongs durch, die uns allen nicht gut taten. Danach ging es mit Seinem Firmenlexus Richtung City West, wo der Abend dann irgendwo im Nebel versank, mit Blick von ganz oben auf den Lietzensee & den klaren, schönen Sonnenuntergang. Einer der magischen Abende.
Als Madames Geburtstag mal wieder vor der Tür stand und der Berlinalestress vorbei war, schickte sie den Beiden eine Einladung zu Mr.Hai. Wir hatten Sie das letzte Mal Anfang Dezember gesehen und auch schon lange kein vernünftiges Sushi mehr gegessen: Zwei Fliegen mit einer Klappe.
Eines morgens klingelte dann ihr Handy, wir räkelten uns gerade aufwachend in den Laken, bis sie sich schliesslich doch aufraffte und ins Wohnzimmer ging, wo ihr Telefon an der Steckdose hing. Und wo sie dann nach wenigen Sekunden in ein grausames Schluchzen ausbrach; auch das wird mir unvergesslich bleiben.
Er sagte das Essen ab, lud uns aber stattdessen zu sich nach Hause ein. Für ein ausführlicheres Gespräch, am Telefon nur so viel: Sie hatten sich spontan einen Urlaub gegönnt, ein alter Arbeitgeber von Ihm hatte gerade ein schönes neues Hotel eröffnet, nach dem Stress in der letzten Zeit genau das Richtige. Die Welle riss die Beiden bei ihrem ersten Strandspaziergang mit sich, eine Weile zusammen, dann glitt Sie Ihm aus der Hand.
Fassungslos erinnerte ich mich daran, dass ich Wochen zuvor bis ins Detail die Berichterstattung verfolgt hatte, wo wieder und wieder Bilder aus einem bestimmten Hotel gezeigt wurden, Interviews mit dessen deutsch-türkischem Manager: Genau dort waren Sie.
Immer noch fassungslos saßen wir dann eine Woche später mit Ihm zusammen in der Wohnung, vor den Kleiderschränken seiner toten Frau, und wussten nicht genau, was wir sagen oder tun sollten. Vollkommen zerstört berichtete Er uns alles, was Er erlebte, woran Er sich noch erinnerte. Er würde ganz woanders hingehen und etwas ganz anderes machen, so viel war klar. Dann war auch Er weg. Im Sande verlaufen & von den Wellen verschlungen. Aber nicht vergessen.
Nun, das Zeichen kam nicht, dafür soeben die Absage für die Wohnung, die ich wirklich gerne bezogen hätte. Immerhin hat sich dadurch der Titel des letzten Beitrags bewahrheitet.
Mit den Bildern, die auf den Erkundungstouren entstanden sind, bin ich auch nicht wirklich zufrieden, aber was solls: ich nehme, was ich bekomme; das sollte ich mir generell zum Motto machen (und darauf hoffen, dass ich überhaupt etwas bekomme).
Zuerst ein Nachtrag zu dem letzten Bilder-Posting – noch einmal Daily Smile:
Auf einer Expedition sind Wegweiser immer gerne gesehen:
Ansonsten steht auf Hauswänden auch oft, wo es langgeht und was gerade angesagt ist:
An anderen Wänden gibt es Kunst statt Text:
Und manchmal sind sie auch einfach nur so für sich allein schön, die Wände, mit etwas Grünzeug garniert:
Wobei: Schönheit kann natürlich auch rau sein…
Zum Schluss: Hier hätte es sein können…
Schon früh um neun waren vereinzelte Dortmundfans unterwegs, selbst hier, oben an der Grenze Wedding/Prenzlauer Berg, immer noch irgendwie im Niemands- oder zumindest Hinterland; Wolken fegten über den Himmel. Frisch, aber ganz angenehm.
Die Stimmung ist ähnlich wechselhaft, aber deutlich im Aufwind. Keine Ahnung, weshalb. Noch vor einer Woche zog ich eine bittere Bilanz, dachte mir, über die letzten zehn Jahre betrachtet, wo soll denn da der Tiefpunkt sein, wenn nicht hier & jetzt; ist doch nichts mehr übrig. Doch eben: Genug davon.
Denn andererseits bekam ich in den letzten Tagen auch so viele schöne unentdeckte Ecken zu Gesicht, und auch einige Wohnungen, die Hoffnung machten. Unbegründet, aber trotzdem.
Mit etwas Glück passt zwischen die Besichtigungstermine immer etwas Freiraum für Erkundungstouren, heute sollte es das Kreuz sein. Die Wohnung davor war fast perfekt, unter den gegebenen Umständen. Und den Rest würde die sehr angenehme Umgebung wettmachen; dürfte nicht allzu schwer sein, hier heimisch zu werden. Wieder ein schöner Kanal um die Ecke, zum Beispiel. Und dort, wo ich schon so oft mit dem Rad langfuhr, suchte ich nun also nach dem Kreuz. Ich hätte vorher nochmal nachlesen sollen, wie Herrndorf die Stelle genau beschreibt.
Eigentlich dachte ich mir schon, dass ich sie nicht finden würde & war auch ganz froh darüber, denn was hätte ich denn dann tun sollen? So bleiben eine Handvoll spannende Vermutungen – und die flüchtige Bekanntschaft mit zwei Anglern, die sich derart häuslich eingerichtet hatten, dass einer von ihnen direkt vor Ort seinen Räucherofen betrieb.
Eigentlich ging es nur darum, die Erinnerungen wieder aufzufrischen, die Gegend einzuatmen, zu probieren, ob das gehen würde. Und ganz schnell zu merken, wie gut das gehen würde, selbst mit der anderen Wohnung, die ein bisschen weiter weg war. Und zu würdigen, dass in den letzten Tagen immerhin auch wieder ein paar hundert Wörter zusammengekommen sind, ein paar Entwürfe rumliegen. Das würde alles sehr gut passen. Wenn ich dran glauben würde, könnte ich so ein Zeichen jetzt gut gebrauchen.
09.03.06
Diese ganze Scheisse.
Hundert Tage Merkelsimulation.
Zusammenbrechende Rot-Grün-Denkmäler.
Hand in Hand stürmen
WIR Papst und DU Deutschland
in die Vergangenheit.
Kein Wunder, dass der Sternburgkonsum steigt.
Gestern wurde der neue Mietspiegel für Berlin vorgestellt, nachdem am 11. Mai der Berliner Mietspiegel an sich vom Amtsgericht Charlottenburg als unwissenschaftlich abgekanzelt & gekippt wurde. Passt alles sehr gut zusammen, vor allem, wenn man bedenkt, dass zum 01.06. die Mietpreisbremse in Kraft treten sollte – die sich wiederum nach dem Mietspiegel richtet. Aber hey – gesetzliche Vorgaben und der Mietmarkt in Berlin, das ist sowieso eher so eine lockere on-off-Beziehung, typisch Metropole halt.
Energieausweise zum Beispiel sollte inzwischen auch jeder Vermieter vorweisen, ansonsten, so hörte ich gestern nebenbei, können Strafen bis zu 15.000 Euro verhängt werden. Nun, ich sehe derzeit immer wieder Anzeigen, in denen kein Energieausweis vorhanden (oder derzeit noch in Bearbeitung) ist.
Zusammen mit der Mietpreisbremse soll auch das sogenannte Bestellerprinzip eingeführt werden – Maklerprovisionen dürfen dann nicht mehr auf die zukünftigen Mieter abgewälzt werden. Theoretisch. In einigen Anzeigen kann man jetzt schon unter der Rubrik „Provision“ lesen, sinngemäß: Hierbei handelt es sich nicht um eine Provision, sondern um eine Bearbeitungsgebühr, die bei Abschluss des Vertrages vom Mieter zu entrichten ist.
Der frisch der Öffentlichkeit vorgestellte Mietspiegel geht übrigens von einem Durchschnittswert von 5,84 Euro/qm aus. Durchschnitt heisst ja, die Hälfte ist teurer und die andere Hälfte billiger. So ganz grob. Ich persönlich habe bisher kaum Wohnungen unter 10 Euro/qm gefunden. Ein paar waren dabei, doch, sicherlich. Erdgeschoss Vorderhaus Seestrasse, da kann man Glück haben und mit 7-8 Euro davonkommen. Staffelmiete meistens.
Und nirgends und niemals sind es unter 20 Leute: Dienstag morgens um 8: 20+. Sonntag morgen um 9, gegenüber dem RAW: 30 Leute. Nur kein Makler, was auch die Vormieterin wunderte.
Das versammelte Potpourri ist auch fast immer gleich: Geschniegelte Anzug- oder Kostümträgerinnen, die von allen anderen zuerst für die Makler gehalten werden, bevor sie sich brav schweigend in die Wartemasse stellen. Bärtig-tätowierte Hipster mit müden Gesichtern und plattgelegenen Haaren, englisch, spanisch oder italienisch parlierend. Frischgebackene Studenten mit Mama, Papa und Bürgschaft an der Hand. Berliner Ureinwohner mit Migrationshintergrund, die von sechsmonatiger, trotz Bürgen und dicker Kohle auf dem Konto erfolgloser Wohnungssuche berichten. Und alle checken sich gegenseitig ab, wer wohl rein sozialdarwinistisch auf welcher Stufe steht. Ganz selten sind auch Geflüchtete in Begleitung dabei. Ein Wahnsinnsspass. Nur falls sich wer fragt, warum es hier so still war. Für Depressionen, Texte schreiben oder die Fantasie schweifen lassen ist gerade keine Zeit. Was erstere nicht immer einsehen.
Während ich für den Kohlenstofflebenumzug gerade die ersten Kisten packe (immer noch ohne zu wissen, wohin es gehen wird), scheinen hier jetzt die letzten Kisten ausgepackt und alles fein säuberlich in die Regale eingeräumt zu sein.
Der RSS-Feed wurde ergänzt, die Weiterleitungen und die Umleitung von der .wordpress.com-Seite scheinen zu funktionieren & auch die paar Follower konnte ich wohl mitnehmen (noch habe ich keine Problemberichte empfangen…), Euch allen also nochmal ein „Herzlich Willkommen!“.
Zwei, drei andere Spielereien im Hintergrund habe ich auch schon durchprobiert & wieder abgestellt, jetzt müsste erst einmal alles reibungslos laufen – bis zum nächsten Update jedenfalls. Fehlen also nur noch neue Texte oder Bilder. Tja. Bis die zustande kommen, muss ich wohl immer mal wieder ins Archiv gehen. 2013 ist auch schon zwei Jahre her, und die Fassade dieses kleinen Häuschens am Landwehrkanal hat seitdem den einen oder anderen Neuanstrich bekommen. Veränderungen, wohin man schaut…
Das mit der Galerie lass ich glaube ich, derzeit gefällt mir die einfache Variante besser.
(2014)
Selbst auf den entferntesten
Erntefesten
verkaufte er seine handgemachten Latschenkiefern-
Kiefernlatschen
und berichtete stets zuverlässig
für stattliche staatliche Honorare
nach oben.
[Ich bin nicht immer pessimistisch. Aber auch dann trotzdem irgendwie komisch drauf.]
Soundtrack: Peter Licht – Lied vom Ende des Kapitalismus
Es begann alles mit einer fixen Idee, wie meistens, wenn es funktioniert. Kein bis ins Feinste ausziseliertes Weltbild. Irgendwann schlug jemand vor, doch mal was zu machen, wo überall lauter unzufriedene Leute rumsaßen. Er meinte, man solle zur Abwechslung vielleicht versuchen, das System mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen, anstatt sich immer samstags um 13 Uhr zur Demonstration zu treffen und die Weltrevolution zu fordern.
„Nehmt irgendwas, sucht euch was aus!“ hat er gesagt. „Denn eigentlich gehört euch ja alles, keine Frage.“ Es wäre aber natürlich leichter, nicht gleich mit den Autofabriken oder den Stahlwerken zu beginnen. Und zum Glück wurden ja inzwischen so viele Sachen gehandelt, dass der Anfang geradezu ein Kinderspiel wäre. Man müsste einfach nur beweisen, dass es auch anders funktioniert, und wenn das genug Leute wollten, dann müsste es auch funktionieren. Und es stimmte: Niemand hinderte sie daran. So simpel hat das alles angefangen.
Schnell machte man sich daran, einen Gesellschaftervertrag auszuarbeiten, der allen gerecht wurde, den ersten Geldgebern wie auch den Beschäftigten, anfangs jeweils nur ein paar Handvoll und gleichermassen Besitzer der Firma. Wenn man das System schon ad absurdum führen wollte, dann richtig, dachten sie sich damals. Sie gaben grosszügig Anteilsscheine aus und zählten darauf, dass die Menschen, wenn sie sowieso etwas brauchten, dies dann auch gern von einem Unternehmen erwerben würden, das ihnen selbst gehört. „Das ist die einzige Frage, die ich euch stelle!“ sagte er. „Wieso denn nicht? Ist das so verrückt? Verrückter, als wenn wir es von irgendwelchen Riesenkonzernen kaufen und damit Kleinkriege und Großkorruption unterstützen und wer weiss was noch alles? Wir müssten uns alle einfach nur an unseren eigenen Ansprüchen messen und klein anfangen.“
Klar klang das nicht schlecht, aber es gab zu dieser Zeit viele mehr oder weniger vernünftige Manifeste und umstürzlerische Aufrufe. Inzwischen gibt es unzählige Theorien, die zu erklären versuchen, warum gerade dieser eine Vorschlag so erfolgreich werden sollte. Im Endeffekt hatte es wohl, wie so oft in der Weltgeschichte, mit dem Zufall und dem richtigen Timing zu tun. Wenn Widersprüche sich aufheben, dann resultieren in manch glücklichem Moment Situationen mit aussergewöhnlichen Möglichkeiten – so oder so ähnlich hat es einer der bedeutendsten Historiker mal formuliert.
Die Idee wurde binnen kürzester Zeit begeistert angenommen und, noch bevor das Unternehmen die Monopolstellung erreichte, auf andere Branchen ausgedehnt, so steht es weniger verschnörkelt seitdem in den Geschichtsbüchern. Relativ schnell wurden den Menschen die wirklich wichtigen Sachen wieder klar. Natürlich gab es Rückschläge und nicht alles funktionierte beim ersten Versuch. Doch wenigstens wollte sich erst einmal niemand mehr gegenseitig den Kopf einschlagen, das war schon mal ein guter Anfang.
Bis hier hin sind sie gekommen, und jetzt sitzen sie alle gespannt vor den Bildschirmen und verfolgen die Live-Übertragung, in der das erste Rendezvous gezeigt wird: Das Ergebnis von aberdutzend Jahren Forschung, die Belohnung für all die Anstrengungen und Entbehrungen, die einsamen und die tödlichen Flüge, der Höhepunkt einer Entwicklung, die konsequent auf Fortschritt und Wissensgewinn ausgerichtet war; nach ein paar so unrühmlichen Jahrhunderten durchaus ein Erfolg. Es dauerte eine Weile, bis sie begriffen, dass es wirklich eine Explosion und keine Bildstörung war, die sie sahen, kurz bevor die Übertragung abbrach.
Ohne viele Worte geht es hier nun anschluss- und hoffentlich reibungslos weiter. Bleibt zu wünschen, dass der andere Umzug ebenso sanft vonstatten gehen wird. Ich habe da allerdings so meine Zweifel – andauernd werde ich daran erinnert, was mir alles fehlen wird, sollte ich den Kiez verlassen müssen. Die Tomaten auf dem Balkon fehlen mir jetzt schon, angesichts der Umstände verzichtete ich darauf, sie für ein paar Wochen und vielleicht zweieinhalb unreife Früchte überhaupt erst zu pflanzen…
Die beiden werde ich auch vermissen, wie sie da thronen über den Hipstermassen, wenn diese sich in die U1 drängeln, die jetzt wieder U12 heisst und mit den blöden lauten quadratischen U2-Waggons fährt.
Erst vor Kurzem ist mir Daily Smile aufgefallen: mein neues Lieblings-Kiez-Street-Art-Projekt. Wird mir auch fehlen, wie er oder sie immer wieder die vorhandene Substanz mit in die Kunst einbindet….
Woanders – ich muss mich ja langsam mal in anderen Kiezen umschauen – werden Türstehergesichter großflächig an die Hauswände gemalt, weil ein Jeanshersteller seine Reputation auffrischen wollte:
Ansonsten: Im Fernseher nur Müll.
Früher war halt alles besser, vor zwei Tagen war zB. noch Wochenende…
Die Nena-Tickets für das Konzert im SO36 sollen ab 79 Euro gekostet haben. Ziemlich oldschool…und dass sie die da überhaupt reingelassen haben. Dann doch lieber den Kopf zerbrechen über das Jane-Fonda-Zitat, und damit ist auch schon wieder Schluss:
Hier ist jetzt Schluss. Also demnächst. Diese Seite wird schon bald nicht mehr erreichbar sein.
Ich war schon immer ein kleiner Ordnungsnerd, passt eigentlich gar nicht zu mir, trotzdem: Es hat mir z.B. wirklich Spass gemacht, irgendwann Anfang der 90er, für meine über 100 VHS-Kassetten Listen anzulegen, mit minutensekundengenauen Angaben zu den Lauflängen der Filme. Ähnliches gilt für Musikkassetten oder Bücher, da probierte ich später auch diverse Computerprogramme aus.
Deshalb war es nur folgerichtig, dass ich irgendwann anfangen würde, mehr mit diesem Blogdingens rumspielen zu wollen, und mit dieser Internetgeschichte an sich. Also besuchte ich in den letzten, anstrengenden Wochen einen Kurs, lernte wordpress jenseits des .com (als leichten Einstieg), html&css und schliesslich typo3. Ordentlicher Wissens- und Erkenntnisgewinn, ich bin immer noch begeistert ( & etwas verärgert, dass ich das nicht schon vor Jahren gemacht habe, wie so vieles….). Interessant auch, wie viele und was für verschiedene Leute auf die gleiche Idee kamen und da mit mir in einem Raum saßen. Auf diese gesamte Veranstaltung werde ich wohl später nochmal gesondert zu sprechen kommen müssen.
Es war gar nicht so einfach, dem Umfeld das halbwegs verständlich zu erklären: Ich halte meine Existenzen so gut es geht auseinander, es gibt kaum eine handvoll Leute, die beide kennen. Von Blogs haben die meisten schon was gehört, das war es dann aber auch (& ich will ja beileibe niemanden zu etwas zwingen, so pflegen sich Freundschaften auch gleich viel zwangloser). Daher sagte ich: Internetseiten schreiben. Was wir ja auch gemacht haben. Oder, ausführlicher: Es ist wie mit dem Autofahren – kann fast jeder, genau wie sich im Internet bewegen. Und ich lerne gerade Sachen wie Öl- und Zündkerzen wechseln, maximal vielleicht noch Ölfilter, Luftfilter und Zahnriemen dazu. Und ein Radio einbauen vielleicht. So in der Art.
Und wie beim Autofahren sollte man möglichst direkt nach dem Lernen in der Übung bleiben, also – und weil es mich sowieso in den Fingern juckte – habe ich meinen Blog komplett ab- und woanders wieder ganz neu aufgebaut. Mit wordpress, eine der wenigen Sachen, die so bleiben werden (neben allen Inhalten, hoffentlich…) Ich hätte es auch gerne in typo3 oder html ausprobiert, entschied mich dann aber doch für wordpress: weil es eben erstaunlicherweise doch einige Leute gibt, die mir dort folgen, weil es meine erste Heimat in der Blogwelt war – und von Gewohntem trennen muss ich mich sowieso viel zu viel in letzter Zeit.
Natürlich bleiben noch viele Fragen offen: Wer weiss, ob ich das mühsam ausgesuchte und per css angepasste Theme in einer Woche noch gut finde? Stelle ich die Bilder weiter einfach so in die Posts ein oder doch mittels der Galerie-Spielerei (ich habe das mal bei verschiedenen alten Beiträgen ausprobiert, bin aber noch zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen).
Und wer weiss, ob mir nicht demnächst komplett die Lust vergeht, ich auf der Strasse oder am anderen Ende der Welt lande; dann wären die Mühen der letzten Wochen für die Katz. Von wegen 1.300 Euro – Geld ist das Wenigste, was ein Blog kostet – und wenn ich nur die Hälfte des marktüblichen Stundensatzes berechnen würde, dann wären 1.300 Euro nicht annähernd die Zeit wert, die ich im letzten Monat mit diesem Projekt verbrachte. Und da sind weder Requisite noch Styling Food und Props einkalkuliert. Jeder Artikel musste noch mal „angefasst“ werden, ein paar kleine Änderungen vornehmen, Schlagwörter und Kategorien zuordnen (nicht wegen Google, sondern wegen meines eigenen Ordnungs-Listen-Faibles; wenn schon eine neue Datenbank angelegt wird, dann nutze ich das doch gleich).
Nicht zu vergessen die ganzen Bilder neu einzubinden (und wenigstens dabei versuchen, auf Barrierefreiheit zu achten)- und dann noch sämtliche Links überprüfen: Warum zur Hölle habe ich so viele Linklisten verbreitet?! Allerdings: komplett tote Links, sowohl zu Youtube als auch zu Blogs oder Artikeln oder Mediatheken, habe ich behalten, eine Art Dokumentation – von wegen „Das Internet vergisst nichts“! – nur bei geänderten urls habe ich versucht, die neuen Adressen einzubauen. Trotz der zeitraubenden Umstellung ein positives Fazit: Ich musste jeden einzelnen Text wenigstens nochmal überfliegen – und bei den wenigstens dachte ich Oh je. Eine weitere Frucht dieser Arbeit: die Texte sind halbwegs nachvollziehbar geordnet und oben im Menü in verschiedenen Schubladen abgelegt, soweit es ging.
Wahrscheinlich werde ich in der nächsten Zeit noch das eine oder andere zu feilen haben, aber soweit bin ich erst einmal zufrieden und hoffe, dass die Seite halbwegs vernünftig läuft – und, dass ich nicht allzu grossen Mist gebaut habe & sie die geneigte Leserschaft nicht zu sehr verstört. Zum Schluss die Formalia:
Ab sofort geht es weiter auf http://www.zurueckinberlin.de – für die .wordpress-Adresse ist das hier der letzte Beitrag. Das bedeutet auch, dass blogrolls, feedreader und wordpress-reader angepasst werden müssten. Nach ein paar Tagen Parallelbetrieb werde ich für die alte Seite einen Redirect anlegen, der hoffentlich auch die alten Links korrekt weiterleitet, und da ich weiter mit wordpress arbeite, hoffe ich, dass auch so wordpress-spezifische Sachen wie der Reader, Profile, Following oder die Sternchen wieder hinzubekommen sind (das entsprechende Plugin werde ich demnächst anpassen) – für Rückmeldungen zu irgendwelchen Problemen (und auch generell^^) wäre ich dankbar.
Und jetzt: Viel Vergnügen drüben, ich hab auch Schnittchen gemacht. Derweil werde ich die ganzen Artikel lesen, die ich in den letzten Wochen nur als Lesezeichen ablegen konnte. Dreistellig, schätze ich mal. Die nächste Linkliste wird wohl lang, und noch etwas dauern…
Samstag: Nach der Arbeit, spontan freiwillig ausgeholfen und komplikationslos absolviert, endlich dazu gekommen, die urls zu mieten. Demnächst wird es hier ernst, dunkel und eventuell erst einmal etwas stiller. Wenigstens ein Umzug, dem ich mit Freude entgegensehe: Endlich das umsetzen, womit ich mich schon fast zwei Monate werktags beschäftige, warum ich unter der Woche so viel zu tun habe & zu so wenig komme.
Aber Samstag, also Wochenende: Rucksack in die Ecke und wieder raus. Den Nachbarjungen, der auf dem Skateboard aus der Einfahrt schiesst, noch kurz abgeklatscht, am Hoffmann vorbei und aus der Ferne gegrüsst. Für den längeren Weg Richtung O-Platz entschieden, dafür aber komplett den alten, zugeschütteten Kanal lang gelaufen. Sonnenuntergang.
Schon von weitem sind die Bässe zu spüren. Je näher ich komme, desto mehr Leute um mich rum. Immerhin ist es also noch nicht ganz vorbei. Noch ein paar Schritte, dann kann man alles, was von der Bühne kommt, gut verstehen. Im Moment: Redebeiträge. Ich drehe eine halbe Runde um den gut gefüllten Platz, bis zum Brunnen, auf der Suche nach meiner Bezugsgruppe. Wir hatten uns lose verabredet; wenn, dann würden sie wohl hier ihr Lager aufschlagen.
Ein paar bekannte Gesichter ausgemacht, ein paar Schwätzchen gehalten. Die Bezugsgruppe meldet per SMS, dass sie noch im Hahn sitzen. Nein, denke ich mir, das wär mir grad zu rauchig und eng, da bleibe ich lieber hier. Ebenso eng bisweilen, je näher man zur Bühne kommt jedenfalls, und interessant riechende Rauchschwaden, klar – aber frische Luft, nette, friedliche Menschen und die Musik setzt auch wieder ein, nach einem Appell zur besonders unschönen Lage der geflüchteten Frauen, der mit den Worten „Herzlich willkommen zu einer weiteren sexistischen Veranstaltung“ eingeleitet wurde.
Doch die Musik ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin: Der Oranienplatz war der Stachel inmitten der Stadt, Symbol für die versagende Asylpolitik. Jeder von denen, die an diesem Ort vor Jahren ihr Lager aufschlugen, stand für werweisswieviele, die auf dem Weg hierher auf der Strecke blieben. Kurz zuvor hörte man wieder von 400 Ertrunkenen, in der Nacht darauf sollten mindestens 700 weitere dazu kommen. Nicht die, die es schaffen, sind das Problem, sondern die, die auf der Strecke bleiben – oder besser: Das Warum des auf der Strecke Bleibens, die Gründe für die Flucht und ihres vielfältigen Scheiterns sind das Problem, und dessen Ursachen liegen bei uns, zuhauf.
Aus den kurzen Gesprächen beim Rundgang war zu erfahren, dass ich sowohl Peter Fox als auch Zugezogen Maskulin verpasst hatte. Blieben also noch Irie Révoltés. Die spielten allerdings für Zehn und rissen die locker auf eine fünfstellige Zahl angewachsene Menge gut mit. Zu „Antifaschist“, wenn ich mich recht erinnere, gab es dann eine ausgeklügelte ortstypische Choreografie mit Feuerwerk und Transpis vom Dach, mittlerweile war es dunkel, passte alles. Und auf das Dach der Bushaltestelle passten 25 hüpfende Menschen.
Dann das übliche Spontandemo-Katz-und-Maus-Spiel, Zivis mit rasierten Köpfen, was den Knopf im Ohr gut erkennbar macht. Wir schauten uns das von der Seitenlinie aus eine Weile an, bis die Füße in den Chucks kalt wurden.
Der Hahn war nur über Umwege zu erreichen, ansonsten wie immer & erwartet. Deshalb (und auch, weil ich keinen Barhocker mehr erwischte) trieb es mich nach nicht allzu langer Zeit wieder nach draussen, frische Luft schnappen. Allerdings erschienen direkt hinter der geöffneten Tür ziemlich viele ziemlich breite uniformierte Rücken. Ich blieb dann doch erst mal in der Kneipe, dafür stürmte eine andere Fraktion aufgekratzt aus der Tür. Bedeutete: Einen Sitzplatz für mich.
Als das Geschehen sich etwas später verlagert hatte, nahm ich doch noch mal draussen auf den Stufen Platz, die Sirenen kamen aus Richtung Skalitzer, wo sich auch die schmalen Menschenströme hinbewegten, in der lauen Kreuzberger Frühlingsnacht. Der betrunkene Mann neben mir fragte, was denn gerade abgehe, irgendwer meinte wohl, heute würde der Kiez noch Kopf stehen, er hätte nichts mitbekommen, musste ja die ganze Zeit hinterm Tresen stehen.
Ich gab ihm eine Zusammenfassung von dem Wenigen, was ich berichten konnte, das „Eigentlich wie immer“ zum Schluss hätte vollkommen ausgereicht, eigentlich. Aber er wollte es ja genau wissen. „Den Ku’damm müsste man mal wieder platt machen“ sagte er, „jetzt, wo sie den wieder so schön aufpoliert haben. So wie damals in den 80ern, das ging ruck-zuck, von der TU-Mensa aus!“
„Jedenfalls besser als die O-Strasse…“ versuchte ich mich diplomatisch zu geben, und wollte eigentlich noch ein „Die Zeiten sind eh vorbei.“ nachschieben, aber er redete schon munter weiter. „Damals brauchtest du nur drei vernünftige Leute oben auf der Bühne, und die 2.500 unten kamen mit zum Ku’damm. Das dürfte doch kein Problem sein, ein paar Leute zusammen zu kriegen, mit der Technik heutzutage. Den Ku’damm müsste man mal wieder platt machen!“
Als ich wieder zur Tür rein kam, wurde gerade einem anderen betrunkenen Kerl ein Glas Leitungswasser quer über den Tresen ins Gesicht geschüttet, mit ordentlich Schwung. Wohl wegen penetranter sexistischer Kackscheisse.
Blöd eigentlich, dass da noch ein anderer Umzug ansteht.
„Was ist?“ fragt sie.
„Nichts, wieso?“ sagst du.
Nur so, weil du so grinst…“ sagt sie.
„Achso, nein, ich freu mich für dich, wirklich….“ sagst du.
„Ah ja, wieso das denn?“ fragt sie.
„Naja, was ist denn passiert? Du strahlst so!“ sagst du.
„Wie meinst du das?“ fragt sie.
„Keine Ahnung.“ sagst du. „Was ist denn nun mit T.?“ fragst du.
„Achso.“ sagt sie.
„Na dann…“ sagst du.
„Willst du das wirklich wissen?“ fragt sie.
„Klar!“ sagst du.
„Ich hab was Verrücktes gemacht: Ich bin mit ihm rausgegangen, B. kam uns hinterher, und als wir ihn endlich losgeworden sind, hab ich ihn geküsst.“ sagt sie.
„Und dann?“ fragst du.
„Dann hab ich gesagt, ich muss mal schnell rüber, und bin gegangen.“ sagt sie.
„Echt?!“ fragst du.
„Ja, wieso?“ fragt sie.
„Nur so…“ sagst du, deutest auf dein Handgelenk, wo sich noch nie eine Uhr befand, und sagst: „Wurde ja auch mal Zeit!“ Und denkst: Verdammt, jetzt hat sie ihn wirklich geküsst, wieso ist das damals bei uns nicht so weit gekommen? Wieso kam sie nie auf die Idee, mich zu küssen?
Und du lächelst freundlich, und du merkst, dass du dich trotz allem für sie freust. Und, dass aus diesem wohligen Schauer, den dir ihr das ganze Gesicht zum Strahlen, zum Glühen bringendes Lächeln immer über den Rücken jagte, ein kleiner, stechender Schmerz geworden ist. Weil das Glühen nicht mehr dir gilt.
20.08.05
Da drüben ist das Prinzenbad.
Dort sitzen all die berühmten Schriftsteller
und Kolumnisten, die was auf sich halten.
Und sonnen ihre feisten Wänste.
Ich wohne hier, kann nichts dagegen tun
– und schreiben kann ich selber.
Doch im Freibad war ich nicht mehr seit
der letzten Arschbombe.
Ich werde wohl nicht umhin kommen, eine Film-Rubrik einzurichten. Das war so nicht geplant (Andererseits: Diesen Film hätte ich nun wirklich nicht verpassen dürfen.). Wieder ein Dokumentarfilm, wieder spielt Gentrifizierung eine gewisse Rolle. Überraschung!
Ausserdem: Das Babylon hatte ich auch sehr lange nicht besucht. Also der denkbar beste Abschluss für ein langes Feiertagswochenende: Die Premiere von Baiz bleibt…woanders; auf einer großen Leinwand, in einem ziemlich großen Saal. Der – das kann schonmal vorweggenommen werden – wenn auch nicht ausverkauft, so doch sehr gut gefüllt war. Fast hätte ich den Termin vergessen, wäre ich nicht nochmal daran erinnert worden. Deshalb gab es hier auch keinen Hinweis, mea culpa.
Der Filmemacher Jochen Wisotzki, Autor und Dramaturg von flüstern & SCHREIEN, traf 2013 auf die/das Baiz, das zehnte Jubiläum stand bevor. Zehn Jahre bedeutete aber auch, dass der Pachtvertrag auslief. Eine fabelhafte Möglichkeit für die neue Eigentümer-Investorengruppe, dieses laute linke Unruhenest loszuwerden. Die Wohnungen in dem Haus lassen sich mit leisen Büros drunter natürlich viel besser verkaufen, direkt an der Grenze zwischen Prenzlauer Berg und Mitte. Kulturelles Umfeld gerne, kann man ja auch gut mit werben als Heuschrecke (Zitat Ahne, oder war es Gott…?), aber bitte nicht im eigenen Haus.
Als Wisotzki mit seinen Aufnahmen begann stand längst fest, dass nichts mehr zu machen ist, dass das Baiz definitiv aus dem Haus raus muss. Baiz bleibt! – der Slogan, der zu dem Zeitpunkt schon zahlreiche Widerstandsaktionen begleitet hatte, der immer noch an vielen einschlägigen Wänden klebt – galt da schon nicht mehr. Stattdessen war das einzig Sichere die Zehnjahresfeier im Dezember, und danach eine ungewisse Zukunft. Klar: Es sollte weitergehen, irgendwie, irgendwo.
Über eine Stunde begleitet der Film die Baiz-Crew bei der Suche nach einer neuen Bleibe. Er zeigt aber auch, und das sehr gelungen, dass eine Kneipe – diese Kneipe – so etwas wie die Seele des Kiezes (oder dessen, was noch davon übrig ist) sein kann. Er zeigt, was für ein Schatz verloren gehen würde, was für eine Institution solch ein Ort sein kann. In der relativ kurzen Drehzeit konnte Wisotzki einen guten Überblick über das breite Spektrum einfangen, dass das Baiz bot:
Vom klaren politischen Anspruch der linken Schülerzeitung Zeitung einer linken Jugendgruppe („Wir schreiben ja auch für Arbeiter und Lehrer!“) bis zur Altherrenschachrunde trafen sich hier die unterschiedlichsten Menschen. Über 20 Veranstaltungen im Monat gab es durchschnittlich, viele davon von Gästen und Umfeld selbst organisiert.
Der Film zeigt Ausschnitte von Auftritten der Schauspielsparte aus Weissensee bis zu Ahne (der mit einem Baiz-Zwiegespräche-mit Gott-Special vertreten ist) und Leander Sukov ebenso wie Konzerte vom Singenden Tresen über Piet Botha bis zu YOK(pocketpunkQuetschenpaua). Wobei diese Aufzählung reichlich unvollständig ist.
Und dann wirklich: Neue, brauchbare Räume sind zu haben, keinen Kilometer entfernt. Großartigerweise braucht man dank der breiten Unterstützung von Kundschaft und Freunden nicht mal eine Bank zur Finanzierung, das wäre ja auch noch schöner… Zwar muss die Viertelmillion über die nächsten 15 Jahre irgendwie zurückgezahlt werden, aber: Niemand schmeisst uns mehr raus!
Umbau und Umzug werden geplant. Die Idee wächst, aus Letzterem ein eindrucksvolles Symbol gegen den Ausverkauf der Stadt zu machen. An die Umzugsmenschenkette, die sich im Februar letzten Jahres die Schönhauser Allee hochschlängelte (und sich als roter Faden auch durch den Film zieht), mag sich vielleicht der eine oder andere noch erinnern. Immerhin: an ihr kam am Ende nicht einmal die Abendschau vorbei.
Diese Bilder, trefflich kombiniert mit der Musik, sind sicherlich einer der Höhepunkte des Films. Finale und Happy End schliesslich genau vor einem Jahr: Die Neueröffnung. So in etwa könnte eine Kurzbesprechung von Baiz bleibt…woanders aussehen. Vielleicht müsste noch etwas rumgekrittelt werden; der Musikeinsatz war oft gelungen bis hervorragend, der Ton manchmal nicht so sehr. Kann die Unschärfe als charakteristischer Charme ausgelegt werden? Gab es da nicht zwei oder drei Szenen, auf die man auch hätte verzichten können?
Keine Frage jedoch, dass der Film unbedingt zu empfehlen ist – derzeit leider nur auf DVD, hoffentlich bald auch wieder vor größerem Publikum.
***
Doch ich kann kein unvoreingenommenes Urteil zum Baiz und zum Baizfilm liefern – im Gegenteil, ich wüsste gern, welchen Eindruck man gewinnt, wenn man keinen Bezug zu dem Laden hat.
Nachdem ich ein halbes Jahr wieder in Berlin wohnte, war es das Zehnjährige, zu dem ich mich das erste Mal wieder halbwegs unter Leute begab. Schon allein deshalb, und natürlich wegen dem Gentrifizierungsscheiss. Doch eigentlich muss ich noch weiter ausholen, kurz eine Geschichte von noch viel früher erzählen, der Vollständigkeit halber:
Auf dem Weg von der Uni nach Hause landete ich als frischgebackener Student ziemlich schnell ziemlich oft im Bandito, und blieb dort meist sehr lange hängen. Billiges Bier, Kulturprogramm und Vokü, aber vor allem ein Umsonstkicker. Durchweg überzeugende Argumente; soweit, so toll. Der Kicker hatte allerdings einen Haken, der auch oft hinter dem Tresen stand und überhaupt ein netter Zeitgenosse war. Bald nannten wir ihn – nur halb im Scherz – den Meister.
Über die Jahre machten wir so manches Mal mit ihm den Laden zu und versackten noch irgendwo anders in der Gegend. Über die Jahre kam es auch manchmal – ganz selten – vor, dass wir gegen ihn gewannen. Mal verbrachten wir mehr Zeit dort, mal weniger. Leute gingen, Leute kamen, Leuten kamen wieder, Leute blieben weg. Auch wir.
Irgendwann meinte Matthias (der inzwischen seltener kickerte, weil er wie wir alle älter wurde, und ein paar Jahre Vorsprung hatte er ja sowieso), dass es vielleicht einen Versuch wert wäre, zusammen mit einem anderem Freund aus dem Haus direkt um die Ecke eine weitere gute Kneipe aufzumachen, oder besser gesagt: Überhaupt eine Kneipe. Oder besser gesagt: Eine Kultur- und Schankwirtschaft. Denn das Bandito teilten sich die unterschiedlichsten Gruppen an den verschiedenen Tagen, selbstverwaltet und so weiter.
Also: Schon kommerziell, doch so niedrigschwellig wie möglich. Und auf alle Fälle ein ambitioniertes, breites Kulturprogramm, Politik ja sowieso. Wieso sollte man das nicht einfach mal wagen?!
Nicht viel später standen wir mit Farbe und Pinsel in den Räumen Christinen- Ecke Tor. Und inzwischen – eigentlich kommt es mir auch gar nicht so viel später vor, auch weil meine Besuchsfrequenz in letzter Zeit sehr zu niedrig ist – hat dieser Laden ein zehnjähriges plus ein einjähriges Jubiläum auf dem Buckel, eine Verdrängung überstanden und ihr sowas von den Mittelfinger gezeigt. Kann man eigentlich gar nicht glauben. Muss man gesehen haben.
* KBKLKB – Kein Bex, kein Latte, kein Bullshit. Singt Yok und stand auf der alten Baiz-Markise. Und dann auch noch Selbstbedienung.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=8lUi1zmzhxQ&w=560&h=315]
Dass ich derzeit so wenig zum Bloggen komme, liegt daran, dass ich mich im Moment so viel mit dem Bloggen beschäftige. Darüber gäbe es viel zu berichten, nur fehlt mir die Zeit, das alles aufzuschreiben. Später. Fest steht: Es wird sich einiges ändern, auch hier.
Noch ärger steht es mit dem Fotografieren. Ebenfalls schade, aber da hoffe ich auf den Frühling – wie generell.
Nicht zu vergessen: Lesen, lesen und nochmals lesen.
Da Ostern ist, habe ich sogar etwas Überraschendes gefunden: Ein paar Bilder aus den Straßen Düsseldorfs, anno 2012.
Er freute sich wirklich sehr über das Geschenk. Ich dachte, wenn ich schon seinen Geburtstag vergessen hatte (wie es nun mal meine Art ist, er nahm mir das nicht krumm, er kannte mich recht gut inzwischen, wusste, mich zu nehmen), dann wenigstens ein Geschenk, das das wettmacht. Sein Anblick beim Auspacken, sein Erstaunen & seine Freude waren ein Geschenk für mich.
Wie angedacht saßen wir lange rum, redeten und tranken dabei die kleinen Flaschen isländischen Wodka, die er mitgebracht hatte. Die Gespräche drehten sich um nichts Konkretes und das große Ganze. Wie immer, wenn wir uns trafen & füreinander Zeit hatte. Wie immer schön.
Irgendwann später am Abend druckste er rum. „Ich habe morgen einen Termin mit B…“ sagte er schliesslich, „Ich hab ihn angerufen, er meinte, das Angebot gilt noch, nicht mehr und nicht weniger.“ So leise wie die Worte seinen Mund verliessen, schaute er mich auch an, erwartungsvoll zweifelnd und ängstlich.
„Klar“ sagte ich, „irgendwann musst du dich ja mal entscheiden, war doch so abgemacht: Ende des Monats, nach dem Urlaub.“ Zögerlich begann seine Miene sich aufzuhellen: „Ich werde wohl annehmen… Ich will einfach nur nicht, dass sich bei uns was verändert, dass du sauer auf mich bist…“ Es klang fast wie eine Frage. „Begeistert bin ich nicht, aber ich mach dir keinen Vorwurf, habe ich dir doch schon tausendmal gesagt. Ich finde es Mist, was hier passiert, im Großen wie im Kleinen. Dass sie jetzt um die Ecke wahnsinnigerweise ein Hotel bauen, oder dass du eben die Kohle nimmst und den Stress vermeidest. Aber das ist nichts Persönliches, das weisst du!“
Ein kurzes, unangenehmes Schweigen war trotzdem unvermeidlich. Doch wir fanden wieder zurück in die Spur, kamen vom Hundertsten ins Tausendste, von den Kriegen um uns rum, die unsere psychiatrischen Notaufnahmen mit traumatisierten Flüchtlingen fluten und überfordern, über die Systemfrage (natürlich!), bis zu der Erkenntnis, dass Maggie Thatcher mit ihrem Unwillen gegenüber der Deutschen Einheit recht behalten hatte: Kein Großdeutschland, nur ein wirklich vereintes Europa hätte die Großkotzigkeit, die wir jetzt wieder an den Tag legen, verhindern können.
Ganz viele Urlaubsgeschichten auch, da führte kein Weg dran vorbei – doch Böhmermanns Stinkefingergate konnten sie selbst auf dieser abgelegenen Vulkaninsel nicht entkommen. Und da fand ich heraus, dass er Olli Schulz nicht kannte. Ich konnte es nicht fassen. „Böhmermann, naja, diese Radiosendung mit Olli Schulz, die hab ich früher gern mal gehört.“ Sagte ich. „Was für ein Olli Schulz?“ fragte er. Keine Ahnung, gar nicht! Weder von dem alten „Hund Marie“-Olli Schulz noch von Charles Schulzkowski. Und das, wo er in Hamburg wohnt! Da kam ich nicht umhin, ihm „Koks & Nutten“ vorzuspielen. Danach saßen wir noch eine ganze Weile ergriffen rum.
Am nächsten Abend sah er ziemlich durch den Wind aus, als er nach Hause kam. „Ich habe unterschrieben.“ sagte er zerknirscht, „Der Typ hat mich voll an die Wand gequatscht.“ Vielleicht wurde es auch langsam Zeit: Zur Sonnenfinsternis in das Haus gezogen, zur Sonnenfinsternis die Entscheidung getroffen, wieder auszuziehen.
Der letzte Punkt in seinem Aufhebungsvertrag besteht aus einer Verschwiegenheitserklärung. „Die Bösen haben gewonnen“ dachte ich mir, „und man darf nicht mal darüber reden.“ Am nächsten Tag, einem Samstag, ging der Architekt durch das Haus und verteilte die Modernisierungsankündigungen. Für uns gab es keine mehr, für die anderen soll sich die Miete verdoppeln bis verdreifachen. Dafür habe ich jetzt andere Sorgen.
29.04.10
Wo auf einmal das ganze Geld herkommt
frage ich mich.
Erst Abermilliarden für Banken.
Jetzt noch für Griechenland,
und bald für Portugal,
das von jemanden regiert wird
der Socrates heisst.
Derweil im Fernsehen ein Reporter:
„Die Mehrheit der Deutschen will keine Steuersenkung, Herr Solms.“
Man stelle sich diese Aussage mal vor fünf Jahren vor.
Oder die Antwort von Hermann Otto Prinz zu Solms-Hohensolms-Lich:
„Die Mehrheit der Deutschen zahlt ja auch keine Steuern.“
Und während wir am anderen Ende der Welt
umgangssprachlich Krieg führen,
ist das Hauptgesprächsthema wie immer
dass es jetzt aber wirklich mal Zeit wurde
mit dem Frühling, nach dem Winter.
Ich wüsste jetzt alles
über die optimale Positionierung,
wenn mir sowas wichtig wäre,
wenn es mir darum ginge,
wenn ich meine Marke aufbauen
& womöglich noch nach vorne
bringen wollen würde.
[„Du bist mir ja ’ne Marke“
sagte man früher und erntete
vielleicht ein freundlich-empörtes
„Wie bitte?!“
Heute wird das als Kompliment betrachtet
und sich artignaiv dafür bedankt.]
Will ich aber gar nicht,
trotzdem gut zu wissen,
mit welchem Wasser
all diese Grosssprecher
& Wichtigtuer kochen,
um ihre heisse Luft
zu produzieren.
Gemerkt, dass man nicht alles haben kann: lesen, schreiben und leben. Jedenfalls nicht, wenn noch täglich acht Stunden mit geregelter Tätigkeit verbracht werden, die zwingend frühaufstehen voraussetzt und anderthalb Stunden bahnfahren als Dreingabe bietet. Deswegen zieht das Lesen den Kürzeren, es reicht gerade mal, um morgens kurz den feedreader zu durchforsten und alles Interessante in die Lesezeichenliste zu packen. Sonntagmorgen fragt der Browser dann, ob ich wirklich 76 Tabs öffnen will. Ja, habe ich denn eine Wahl?!
***
Angesichts der morgendlichen Massen in der U7 war ich kurz davor, wieder mit den längeren Podcasts anzufangen, da ich nun wirklich nicht im Stehen und von allen Seiten bedrängt lesen mag. Doch dann probierte ich als Alternative die Ringbahn aus, und dort gibt es, entgegen dem schlechten Ruf der S-Bahn, immer einen Sitzplatz für mich. So konnte ich mit Kischs „Marktplatz der Sensationen“ anfangen, Aufbau Verlag, 1981 – damals 3,80 Mark (der DDR), letzte Woche blind für einen Euro gekauft. Läuft das schon unter Wertsteigerung?
Jedenfalls: Blind gekauft, wie gesagt, ich vermutete eine Sammlung bunt zusammengewürfelter Reportagen, doch eigentlich ist es eine Art loser Selbst- und Weltbeschreibung. Erinnert mich in Vielem an Zweigs „Erinnerungen eines Europäers“, das ich vor knapp einem Jahr las.
Was mir bei beiden Büchern durch den Kopf ging – und in ihrem Vergleich, ihrem Zusammenspiel noch mehr auffällt: Dass wir heute die deutschsprachige Literatur (und, gottbewahre, gar die deutschsprachige Kultur) jenseits der Landesgrenzen so gut wie komplett ausgeblendet haben. Wie Zweig das k.u.k.-Wien beschreibt, komplementär dazu Kischs k.u.k.-Prag, da bekommt man eine leichte Ahnung davon, wie vielfältig und reich die deutschsprachige Literatur mal war. Was wissen wir heute über die österreichische oder gar schweizerische Kulturszene? Eigentlich gilt nur noch Berlin – als Gegenstimme aus den Provinzen gibt es ein paar Krimis, das war es dann aber auch. Ansonsten: Frankfurt bzw. Leipzig, wenn mal wieder Messe ist (und ich mich, zumindest bei letzterer, wieder ärgere, dass ich es nicht dorthin schaffe. Aber immerhin hatte ich gestern Abend eine Messebesucherin im U-Bahn-Waggon, die in ihrem lautstark geführten Telefonat eine kostenlose lebensnahe Schilderung für alle Passagiere feilbot.)
***
Apropos Berlin: Ich meinte zu dem wankelmütigen, liebenswerten Hauptmieter-Mitbewohner, dass er sich doch mal entscheiden soll. Ich fürchte, er entscheidet sich für das Geld. Dann geht es wohl entweder in den Wedding, wo ich in letzter Zeit eh‘ relativ oft Bier trinken gehe, oder ganz weit weg. Ich wage nicht zu hoffen, in Kreuzberg bleiben zu können.
***
Einer der Höhepunkte dieser Woche: Meine Lieblingsfigur aus Breaking Bad (was ich, wie ich inzwischen festgestellt habe, viel zu schnell hintereinander schaute) – Mike Ehrmantraut – bekam beim Spin-off Better call Saul eine Episode nur für sich & seine Hintergrundgeschichte. Und mit dieser einen Folge hat er meiner bescheidenen Meinung nach alles an die Wand gespielt, was bisher aus dem BB-Universum zu uns vordrang.
Was für ein Wochenende – und was für ein Mist, dass mich pünktlich zum Beginn des lohnenswerten Wetters doch noch eine Erkältung erwischte. Freitag also vier Kannen Tee und Ruhe. Samstag dann früh um fünf aufgewacht; so richtig klappt das mit dem neuen Rhythmus noch nicht.
Dafür hatte ich lange was von dem schönen Tag, und da frische Luft ja auch gesund sein soll, schnappte ich ein wenig davon. Unter anderem auf dem Bücherflohmarkt an der Museumsinsel – nicht meine Idee, aber keine schlechte. Lange nicht in dieser Gegend gewesen. Als ich hier vor langer Zeit studierte standen vor Merkels Haustür noch keine zwei verbeamteten Schlosswachen. Aber das war auch lange vor dem Frühstück in Wolfratshausen, und Gysi & de Maiziere (der Kleine aus dem Osten) hatten auch noch ihre Kanzlei im gleichen Haus. Richie Silberlocke (wie ihn der grosse Wolfgang Neuss nannte) selig residierte ebenfalls dort, genau wie der ehemalige Uni-Präsident, der immer der erste war, der die Polizei rief, wenn die Party im Innenhof gerade anfing, gut zu werden.
Erstaunlicherweise waren von den zwölf Büchern, die ich am Ende des Nachmittags im Rucksack hatte, sogar drei auf einer meiner unzähligen Noch-zu-lesen-Listen.
Der Sonntag begann ähnlich gemütlich: Der traditionelle Familien-Frauentagsausflug stand an. Da auf dem Bahnhof Warschauer Strasse ein Koffer mutterseelenallein rumstand, meinte die Staatsmacht, dass da kein Platz mehr für die Bahnreisewilligen wäre, jedenfalls kein sicherer. Früher ™ rief man die Polizei, wenn man eine Tasche vermisste. Heute, wenn man eine zuviel hat. Also die Revaler langgelaufen, komplett, wollte ich sowieso schon längst mal machen. Hinten, jenseits der Modersohnbrücke, die gruselige Aufhübschung des Viertels hautnah angeschaut und nicht nur wie sonst immer aus dem S-Bahn-Fenster. Vorne sieht es zwar noch einladend uneinladend aus, aber rentabel ist es schon: von vier Millionen auf 20 Millionen in knapp acht Jahren – und die Leute schimpfen über die armen Seelen von Grasverkäufern, deren Rendite wahrscheinlich weit geringer ist.
(Und die mich – das nur nebenbei – mit ihrer Anquatscherei weit weniger nerven als der ganze Werbemüll, der einen von Plakatwänden und der O2-Blinktafel ebenso ungefragt belästigt.)
Im Spandau des Ostens dann das erste Eis des Jahres gegessen, dafür in einer langen Schlange lange angestanden und zum Schluss Krokusse im Schlosspark bewundert. Der Weg zurück in die Stadt war nicht mehr ganz so entspannt: Während die Unionfans auf dem Hinweg noch zivilisiert und halbwegs nüchtern waren, gar einem eingeschüchtertem Rentnerehepaar Sitzplätze anboten, sah das jetzt deutlich anders & unfreundlicher aus. Freiwild-Shirts, Weinrote Scheisse-Gegröle und Rauchen in der Bahn waren dabei noch die harmloseren Vorkomnisse. Gefährlicher waren diejenigen mit kleinkarierten Hemden, Millimeterseitenscheitel und klugen, bösen Augen. Burschis, Jura und nicht nur auf dem Paukboden schlagend, wie ihre Unterhaltungsfetzen über die letzte Begegnung mit irgendwelchen BFC-Hools verriet.
Dann fing die Woche auch schon an, gar nicht so schlecht. Langsam wieder gemerkt, wie ich das früher geschafft habe: Mit Leuten zusammenarbeiten können, obwohl ich das eigentlich weder mag noch will. Ab und zu sogar Spass haben (& das auch zugeben können). Wiedereinmal sehen und staunen, wie viele verschiedene Lebenswege es gibt.
Heute kam es mir allerdings eher so vor, als hätte ich geträumt: … der Winter wär vorbei/du warst hier und wir war’n frei/und die Morgensonne schien…
Ansonsten: Ein paar Fragmente zu Papier gebracht. Aber eben auch nur ein paar Fragmente, und nur Papier. Bisher. Doch das ist ja geduldig. Immerhin.
14.03.14
Ich habe gar nichts dagegen,
dass jetzt diese ganzen Leute
hier das erste Frühlingswochenende
geniessen.
Ich mache das ja auch nicht
ohne Grund schon seit Jahren.
Es ist einfach schön, der Ort
kann doch nichts für sein Publikum.
Und wenn du Ende Februar/Anfang März,
abends, so um halb sechs,
am Urban lang gehst,
noch mit hochgeschlagenem Kragen,
musst du dir, nachdem an der Brücke
das obligatorische Augustiner gekauft wurde,
auf der anderen Seite die Jacke ausziehen.
Weil es eben doch schon so warm ist,
dort, wo die Sonne noch scheint.
[Und das, was du für die unvermeidliche
Hipsteransammlung gehalten hast,
sind einfach nur ein paar
Kreuzberger Oberstufenschüler
bei ihren ersten Kiffversuchen.
Nachtrag, Juni:
Es geht aber vielleicht doch zu weit,
wenn jetzt, wie deutlich am geparkten Bus zu lesen,
Rentner aus dem Ruppiner Land
auf das Restaurantschiff verfrachtet werden
und gaffen wie im Zoo.]
Die nicht gefassten Vorsätze konkretisieren sich, werden umgesetzt. Und ihr hier habt darunter zu leiden.
Um Struktur zurückzugewinnen und neue Erfahrungen zu sammeln stehe ich neuerdings zu Zeiten auf, zu denen ich bis letzte Woche schlafen ging. Was morgens gut klappt, trotz maximal fünf Stunden Schlaf (die Umstellung dauert wohl noch eine Weile), zieht mir am späten Nachmittag den Boden unter den Füßen weg, so dass ich auf der Couch lande, Beine nach oben. Die nächtliche Rumtreiberei leidet darunter (fast) ebenso wie das Bloggen.
Dafür höre ich jetzt täglich acht Stunden Leuten zu, die mir was vom Pferd Bloggen und der Netzwelt erzählen. Unter anderem. Schon auf der ersten Folie tauchte das Nicht-nicht-kommunizieren-Zitat auf. Dass der „Ich muss hier raus“-Reflex so schnell kommt, hätte ich nicht vermutet. Kurz darauf wurde „Das Netz vergisst nichts“ auf ein Flipchart geschrieben. Später meinte einer bei der Fragerunde, dass er Print gar nicht mehr lese, bis auf das Compact-Magazin, hätte er kürzlich entdeckt, sehr interessant und aussergewöhlich.
Die Leute um mich rum haben massenhaft Abschlüsse, Familien, Kinder und Blogs. Keine Ahnung, wie die das alles unter einen Hut bekommen. Ich könnte das nicht. Deswegen bleibt es hier wohl leider bis mindestens Ende des Monats etwas ruhiger. Es sei denn, ich finde die Veranstaltung so nichtssagend wie gerade eben…
02.06.14
Bei Fauser
– es ging irgendwie um die Startbahn West –
gerade ein neues, altes Wort gelernt:
Forstadjunkt.
Verwirrt;
erst nach mehreren Anläufen
verstand ich:
Einfach irgendwas mit dem Wald,
dem Deutschen;
das kann Fauser nämlich auch,
und vor allem immer wieder
überraschen.
Nicht das, was man
– was ich –
bei ihm eigentlich erwartet:
Vorstadtjunk.

(auch schön, und viel schärfer ist dieses Bild zum Thema)
Im Moment: Viel zu viel Leben für viel zu wenig Zeit.
Vereinzelt gab es Nachfragen, warum es hier denn so ruhig sei. Der Duderich fasst es in treffende Worte (und hat eine wunderbarpassende Begleitmusik dazu): Ah…, wenn man lange nichts gepostet hat, dann ist es schwer die Relevanz zu finden, die es wert ist, das eigene bleierne Schweigen zu durchbrechen. Selbstverständlich scheitere ich daran, aber ich kann mich gut leiden und habe Verständnis für mich.
Wobei mir der letzte Satz noch nicht über die Lippen kommt, aber auch das ist etwas besser geworden im neuen Jahr. Etwas. Manchmal. Jedenfalls: Dieser Artikel liegt hier seit dem 28. Januar rum, immer wieder wird ein bisschen dran rumgefeilt und ergänzt – und sich dann gedacht: Wirklich? Warum?
Die Veränderungen kamen schleichend, der Vorsatz nur bei genauerem Betrachten hinter einem Schleier erkennbar. Oder gar nicht, weil purer Zufall: Seit der letzten Erkältung Anfang Dezember morgens statt der Kanne Kaffee eine Kanne Tee – und einfach dabei geblieben. Seit der Scheidungskindhund im Westen ist keine langen Podcasts mehr gehört. Aber auch viel zu wenig Bewegung und Struktur, was geändert gehört, ich arbeite daran, immerhin. Doch vor allem: Rausgegangen, sehr oft; Menschen getroffen, ganz schön viele; Zeit verschwendet, mal nicht alleine. Konzerte, Geburtstage, Morgengrauen. Am Ende trotzdem – trotz dem Spass, trotz des Spasses, den es machte – das Gefühl: Ich bin zuviel rumgerannt und es ist doch nichts passiert.
Dabei blieb natürlich einiges auf der Strecke, man kann halt nicht alles haben. Schreibblockade mal anders, wenigstens aus einem guten, triftigen Grund kaum was zu Papier gebracht. Und wenn ich lese, dass Marcus Kluges Pause von 1989 bis 2013 dauerte und er dann innerhalb kurzer Zeit so viel Gutes geschrieben & gesammelt hat, dann besteht ja vielleicht doch Hoffnung.
***
Hier beisst sich übrigens die Katze in den Schwanz: Wir befinden uns ja gerade – falls sich wer fragt – am Anfang einer kleinen Linksammlung. Ab und an finden sich in diesen Sammelsurien auch Veranstaltungshinweise – und der Herr Kluge plant, ebenso wie die fabelhaften Candy Bukowski, Sabine Wirsching und Monsieur Manie in absehbarer Zeit eine Lesung. Noch mehr Grund zum rumrennen (& rausreden). Zu allem Überfluss dann noch die Berlinale.
Eigentlich wäre sie sang- und klanglos an mir vorbeigezogen (auch was Neues, früher wälzte ich Programmhefte noch und nöcher). Dann rief aber jemand an und fragte, ob ich nicht mitkommen möchte, zu ein oder zwei Filmen. Also doch, und also doch im Programm gestöbert. Der Kurt-Cobain-Film wäre naheliegend gewesen, klappte jedoch leider nicht. Den kann man sich aber garantiert später und bei anderen Gelegenheiten anschauen – und das war doch immer das Berlinalefilmhauptauswahlkriterium: Etwas schauen, was man höchstwahrscheinlich nie wieder zu Gesicht bekommt. Nun lief eines der ausgewählten Werke im Delphi, das schöne, alte Delphi mit den schönen, alten Geschichten. Wo Madame arbeitete und ich seitdem nicht mehr war. Es ging gut, ich habe wohl langsam meinen Frieden gemacht, jedenfalls die ersten Waffenstillstandsverhandlungen erfolgreich überstanden. Beate Uhse ist scheinbar schon lange weggezogen, dafür kampieren ein paar mehr Obdachlose vor dem Ullrich unter den S-Bahn-Bögen.
***
Der letzte Kinobesuch, ich hatte es ja vor zwei Beiträgen ( und drei Wochen…) kurz angesprochen, war deutlich unangenehmer. Nicht nur des Themas oder der Umsetzung wegen. Hauptsächlich war es das Kino, welches allein aufgrund der günstigen Lage und des passenden Zeitpunkts gewählt wurde: Es lag halbwegs in der Mitte unserer Wege und wir wollten danach noch ins Baiz – also Kulturbrauerei. Welch Fehler, vor allem blauäugig zwei Bier zu bestellen. Da war der zweite Zehner weg. Ich hab mir danach sagen lassen, das wäre eins der angenehmeren Multiplexe, aber zwei große Bier brauchte es schon, um erträglich zu sein.
Die Nischenpressenkritik und die Leute um mich rum hatten an Wir sind jung, wir sind stark (durchaus berechtigt) rumzukritteln. Zur Vorbereitung ignorierte ich zwar sämtliche Besprechungen, sah mir aber am Abend vorher nochmal the truth lies in rostock komplett an. Keine Frage, dass der die Geschichte viel besser, tiefer und genauer erzählt. Und krasser. So ein Anspruch ist bei Spielfilmen allerdings auch schwierig zu erfüllen (und schlechterdings zu fordern).
Da ich mit dem flauen Gefühl im Magen nicht schlafen gehen wollte, schaute ich mir danach endlich Fraktus an, der verstaubte schon länger auf der Festplatte. Ich war ganz angetan und es klappte gut mit dem Schlafen danach, was nicht zuletzt an Devid Striesow lag. Umso überraschter war ich am nächsten Abend im Kino, ihm schon wieder zuschauen zu dürfen – ich hatte im Vorfeld wirklich nichts gelesen zu dem Film. Also, mein Laienfazit: Gute Schauspieler und gute Bilder. Die Story hat den Nachteil, dass sie sich entscheiden muss – zwischen Vietnamesen und Roma – und das in diesem Fall ganz klar tut. Oder zwischen dem persönlichen und dem politischen Handlungsstrang, und beide nur in Andeutungen erzählt. Da hätte man sicherlich einiges besser machen können, aber es wurde immerhin gemacht. Als Spielfilm, der nicht an Dokumentarfilmkriterien gemessen werden sollte. Deswegen fand ich auch das „metaphorisch überhöhte Ende“ nicht schlimm.
Das Geld, welches ich zuhauf im Kino ausgab, holte ich vorher aus der gleichen Bank, die ich vor knapp einem Jahr schon besuchte. Die selbe ist es nicht mehr: Kein Obdachloser weit und breit, dafür schreckliche Musik. Erst einen Tag später erfuhr ich, dass es sich dabei um das neue Konzept zur Steigerung der Kundenfreundlichkeit im Kampf gegen die Armen handelt.
***
Zu den Nachrichten: Die DDR-Herkunft schlägt sich bei mir auch in seltsamen Sportbegeisterungspräferenzen nieder. Ein weiteres Bekenntnis: Ich schaue Skispringen. Am vergangenen Wochenende fand nun auf der (derzeit noch) größten Schanze der Welt, dem Vikersundbakken, ein Skifliegen statt. Gundula Gause verkündetete dazu am Sonntagabend im heute journal (wörtliches, komplettes Zitat aus der Mediathek):
Beim Skiflugweltcup im norwegischen Vikersund hat Severin Freund seinen fünften Saisonsieg gefeiert. Auf der größten Schanze der Welt, dem berüchtigten Monsterbakken, segelte der 26jährige über 237 und 245 Meter weit und gewann damit überlegen vor dem Norweger Fannemel. Eine perfekte Generalprobe für die am Mittwoch beginnende WM.
Ganz schön viele Informationen für eine so kurze Meldung, eigentlich. Wie sich das für eine seriöse Nachrichtensendung gehört. Allerdings: Was zählt, ist allein das Deutsche. Der Rest ist irrelevant, wurde schliesslich – wie in diesem Fall Anders Fannemel – überlegen geschlagen. Da hilft es ihm auch nicht, dass er im ersten Durchgang noch vor Freund führte. Weil er 251,5 Meter weit geflogen ist – und damit einen neuen Weltrekord aufstellte (Die 250 Meter fielen erstmals am Vortag, und vor gerade einmal 15 Jahren knackte der Goldberger Andi die 225 Meter, aber ich schweife ab…). Was dem heute journal nicht mal einen Nebensatz wert ist, so ein neuer Weltrekord. Wäre ich zynisch, würde ich bezweifeln wollen, dass der Aktuellen Kamera so ein Fehler (in der Tat fehlt ja etwas) unterlaufen wäre, selbst wenn der neue Weltrekordler aus der BRD gekommen wäre. Und dabei ist Fannemel Norweger und nicht mal Russe (der stand seine 254 Meter leider nicht…)
Klar, das ist nur eine Kleinigkeit aus einer Randgruppensportart. Trotzdem bezeichnend. Ich könnte natürlich auch grössere Fässer aufmachen, aber deren Inhalt ist ja allgemein bekannt, bis zur Ignoranz bekannt sozusagen. Im Großen wie im Kleinen. An dem einen Tag wird Lügenpresse zum Unwort des Jahres gekürt, am folgenden echauffiert sich der ARD-Nachrichtenchef darüber, bei einer Inszenierung ertappt worden zu sein. Er schreibt, nachdem das entlarvende Bild durch das Netz ging: Aber es ist doch so: Wenn sich Politiker vor eine Kamera stellen, ist das immer eine Inszenierung, jede Pressekonferenz ist eine Inszenierung.
Genau so isses, das braucht man den Leuten aber doch nicht erzählen, dass die Politiker da weit ab vom Schuss (pun not intended) einsam in der Gegend rumstehen. Oder, dass bei Bundestagssitzungen längst keine Gesetze mehr beschlossen werden. Wenn, dann in den Ausschüssen vorher, und geschrieben werden sie in den Anwaltskanzleien der Lobbyverbände. Wer wird denn so etwas gleich verlogen nennen?! Anteilnahme kann man sagen, oder – wie im Falle der Berliner Olympia-Bewerbung, deren Logo sich ein Lokalfernsehsender gleich dauerhaft oben in die Ecke pappt – Begeisterung! Selbst die BVG ist total verlogen begeistert, und mag auf einmal sogar Graffiti! Allerdings nur die mit dem richtigen Inhalt, so weit geht die Meinungsfreiheit dann doch nicht. Olympia sagen darf übrigens nur, wer bezahlt, selbst wenn er „Juhu, Olympia!“ sagen will.
***
Kurzum: Nur, weil die anderen böse sind, müssen wir längst nicht die Guten sein (& überhaupt: Was zum Teufel machen wir hier eigentlich?). Gerade eher im Gegenteil, und bevor ich mich noch zu Folterberichten, Saudibegräbnissen, Pressefreiheit oder Blasphemieparagrafen äußern muss, über eine absurde Überwachungspolitik, die unangenehme Fragen aufkommen lässt, lieber zu etwas angenehmeren.
Schöne Texte zum Beispiel. Beim Durchblättern fiel mir auf, dass ich schon lange nichts mehr von Glumm verlinkt habe – das liegt einfach daran, dass man den immer lesen kann. Sollte. Den Mann mit dem Pudel. Ebenso lassen die Fauser-Huldigungen hier in letzter Zeit arg nach; die Seite Mein Harry Gelb, die sich dem Harry-Gelb-Streetart-Duo widmet, schafft da vielleicht Abhilfe. Ein interessanter Remix auf alle Fälle, aus einer Kunstfigur eine neue Kunstfigur in einem neuen Kontext zu schaffen. Das klappt auch ganz amüsant, wenn man sich die Frage stellt, wie Philosophen sich als Nerds so geben würden.
Worte sind ein merkwürdiges Tier, und manche können es überaus kunstvoll bändigen, mit digitaler Unterstützung sogar präzise auf 18 Wörter pro Satz. Andere, wie der Kiezschreiber, versuchen sich (unbeabsichtigt?) an der Variation von Klassikern, hier: die Kuh Elsa. Zum Abschluss des Ausflugs in die Tierwelt noch eine amüsante Anekdote aus dem Dschungel vor der Supermarktkasse.
Die Bändigung kann genauso beeindruckend sein, wenn sie eher bedrückend statt amüsant vonstatten geht: Wie etwa bei Detlef Kuhlbrodt oder Peter Richter; Spaziergänge durch Kreuzberg, Dresden und das, was war und was ist. Umso schöner, ab und an eine freudige Überraschung zu erleben.
Musik: Asal hat ein Mixtape. Und etwas weiter im Osten wird sich mit noch fernöstlicherer Musik beschäftigt.
— endet hier.
(05/14)
Morgens, wenn ich aufstehe
und die Zeit anschalte.
Nur noch eine blasse Erinnerung
an den Traum:
Wir bauen uns einen Staat
voller fröhlicher, hüpfender Menschen
und nennen ihn Saltonat.
Mittwochs treffen sich alle auf dem Großen Platz
zum Springstoffanschlag
und draussen gibt es nicht nur Kännchen.
Asal lud mich unlängst ein, in den Reigen der Beichten und Geständnisse einzutreten. Bisher habe ich ein einziges Stöckchen aufgenommen – und dabei will ich es auch belassen. Dennoch möchte ich die gute asal nicht einfach so rüde abweisen, das hätte sie nicht verdient. Allerdings: Aus sieben mache ich eins, und aus dem Stöckchen einen groben Knüppel, eine Keule gar.
Nicht nur, weil aus der Blog-Nachbarschaft so charmant gefragt wurde, sondern auch, weil ich heute Abend ins Kino gehe kam mir ein älterer Blogtext in Erinnerung. Ich werde mir den Lichtenhagen-Film anschauen. („Gehen wir in den Lichtenhagen-Film?“ fragte ich. „Ja, hab ich auch schon von gehört, unbedingt. Wie hiess der doch gleich?“ sagte sie. „Keine Ahnung, war zu lang, der Titel.“)
Ursprünglich veröffentlichte ich den folgenden Text am 16. Dezember 2011, einen guten Monat nach der NSU-Enttarnung. Ausser einigen kosmetischen Korrekturen belasse ich ihn so, wie er war, inklusive der Updates am Ende. Der Trailer zu „Wir sind jung, wir sind stark“ – so heisst der Film – ist durchaus sehenswert (zum Film kann ich noch nichts sagen, Kritiken lese ich mir besser erst danach durch), als Prolog und Einführung eignet sich diese Dokumentation aber weit besser [Triggerwarnung: starker Tobak voraus, sowohl im Video als auch im Text]
Ich bin Mitte der 1990er Jahre aus der nordostdeutschen Provinz nach Berlin gezogen. Eigene Wohnung, eigenes Leben, vibrierende, unfertige Grossstadt – das bedeutete für mich hauptsächlich eins: Freiheit. Vor allem auch die Freiheit, nachts nach einem Kneipenbesuch alleine sicher nach Hause torkeln zu können, ohne sich ständig panisch umzuschauen und bei entgegenkommenden Menschengruppen auf die andere Strassenseite oder in irgendwelche dunklen Seitengassen ausweichen zu müssen. Klar, auch in Berlin gab es damals Nazis, und wirklich sicher ist man nie, aber im Gegensatz zum heutigen Berlin waren die faschistischen Schläger noch weniger sichtbar – und nach Hellersdorf, Marzahn und Hohenschönhausen fuhr man einfach nicht.
In Stralsund war das anders. Die Stadt ist nicht sehr gross, man läuft sich dort zwangsläufig über den Weg. Für langhaarige Nachwuchslinke gab es zwar zwei, drei sichere Kneipen, aber spätestens der Heimweg war niemals sicher. Nicht selten kam ich ausser Atem an der Haustür an.
Pöbeleien waren alltäglich, Brandanschläge auf “unsere” Hälfte des Jugendclubs auch nicht unüblich. (Die von den Plattenbaunazis genutzte andere Seite des Gebäudes – Oh gloriose Jugendarbeit der frühen 90er Jahre! – blieb meist unbeschadet.) Eine gewisse Zeit lang mussten wir uns auch immer mal wieder zusammenschlagen lassen – wir waren kein auf Krawall gebürsteter Schwarzer Block, unsere zahlenmässige und körperliche Unterlegenheit war uns sehr wohl bewusst. Wir provozierten lediglich mit dem “falschen” Aussehen und der “falschen” politischen Einstellung.
Bei einer der grösseren Schlägereien, zu der wir sowohl mehrere Unterstützer als auch die Polizei herbeitelefonieren konnten, kam von der zweiköpfigen Streifenwagenbesatzung nur das leidige und viel zu oft verwendete Argument “Ach, ihr haut euch doch bloss untereinander, bestimmt wegen irgendwelchen Frauengeschichten” – dann kurbelten sie schnell das Fenster hoch und machten sich aus dem Staub. Natürlich wussten sie, was los war.
Erst nachdem wir konsequent jeden Angriff zur Anzeige brachten und einige der Nazis dadurch ihre Bewährung aufs Spiel setzten, fand zumindest die physische Gewalt ein Ende. Die Stadt war klein, wie gesagt, und die Schläger kannten wir teilweise seit Kindertagen.
***
Doch nicht nur das. Zur Wahrheit gehört auch, dass ich ein paar Jahre davor – ungefähr mit 13, 14 Jahren – selbst ein kleiner Nachwuchsnazi war. Vieles aus meiner Jugend konnte ich erfolgreich verdrängen, das allerdings nicht. Ich habe in dieser Zeit nie selbst Gewalt angewendet, soweit ich mich erinnere auch kein anderer von den Leuten, mit denen ich mich umgab. Eigentlich ging es nur ums Saufen, von zu Hause wegsein, Störkraft und die Böhsen Onkelz hören und Leute schocken. Konkret handelt es sich um den Zeitraum zwischen dem Mauerfall und Hoyerswerda, es war ein schleichender Prozess, den ich mir inzwischen ganz gut erklären kann.
Meine Eltern arbeiteten in den letzten Jahren der DDR für ein paar Jahre im Ausland. Ich war schulpflichtig und somit zu alt, um sie begleiten zu dürfen (so die offizielle Version der Unterpfand-Praxis) und lebte bei Verwandten in der Lausitz. Das hatte viele gute Seiten: Ich durfte die kompletten Großen Ferien in den sonnigen Süden, dort gab es Obst, von dem man in der DDR nicht mal träumte (Nektarinen!), Comics, Westautos und lauter bunte Fische, Seesterne und Seeigel beim Tauchen. Meine Eltern sah ich aber – soviel zu der nicht so sonnigen Seite – nur im Sommer und über Weihnachten, da hatten sie ein paar Wochen Heimaturlaub.
Als ich 1989 nach den Sommerferien wieder zurück kam, fing mein damaliger bester Freund, der zwei Jahre älter und unglaublich stark war, mit dem Deutschland-Gequatsche an. Sein Elternhaus war richtig zerrüttet, so dass er tun und lassen konnte, was er wollte, es kümmerte niemanden. Für mich war er eine Art grosser Bruder. Eigentlich war ich ein vorbildlich sozialistisch sozialisiertes DDR-Kind: stolzer Thälmannpionier, stellvertretener Gruppenratsvorsitzender, Wandzeitungsredakteur und Agitator, durchaus freudig der FDJ-Aufnahme im nächsten Jahr entgegenblickend. Faschismus – soviel war klar – gab es nur jenseits der Mauer, dort allerdings zuhauf.
Und auf einmal brach der Staat, den ich bis dahin dank kindlichen Glaubens, dank frühkindlicher Indoktrination trotz allem als meinen und vor allem als den besseren deutschen ansah, zusammen – und die Ehe meiner Eltern auseinander. Das einzige, was wir noch gemeinsam machten, war wieder zurück nach Stralsund zu ziehen, was für mich bedeutete, nicht nur meine Familie, sondern auch meine Freunde – speziell den einen – zu verlieren. Der dann übrigens nicht viel später mittels eines schicken Westautos sein Leben an einem Brandenburger Alleebaum verlor, wie einige andere meiner Mitschüler auch. All das führte zu einer veritablen Klatsche, von der ich immer noch ganz gut zehre. Damals versuchte ich wohl, irgendeine Stabilität dadurch zu gewinnen, dass ich mich an dem orientierte, was mir mein verlorener Freund mit auf den Weg gab. Ich suchte mir einen dementsprechenden neuen Freundeskreis, was zu dieser Zeit an diesem Ort im Übrigen auch nicht sehr schwer war.
Wie gesagt, es war ein schleichender Prozess: Zuerst ging es nur darum, möglichst viel Alkohol zu konsumieren, dann kamen die ersten Kassetten mit entsprechender Musik, wahrscheinlich von irgendwelchen großen Brüdern. Über diese Texte wurden Phrasen transportiert, die wir nachplapperten und uns wer weiss wie rebellisch fanden. Meine Mutter war verzweifelt, noch mehr als sowieso schon, ich beschränkte den Kontakt zu ihr auf ein Minimum und trieb mich rum.
Eines Tages brachte jemand DVU-Broschüren und diverse VHS-Bänder mit einschlägigen Inhalten mit. Zum Glück interessierte ich mich nicht sonderlich für Fussball, keiner von uns eigentlich, wenn ich mich recht erinnere. Ansonsten wären wir vermutlich sehr schnell bei den Hansa-Hools gelandet. Ein weiterer Glücksfall für mich war der Wechsel auf eine andere Schule, es gab jetzt schliesslich Gymnasien und keine Polytechnischen Oberschulen mehr, auf die alle bis zur zehnten Klasse gingen. So lernte ich neue Leute kennen, aber auch dort gab es durchaus eine weit verbreitete Aktzeptanz rechten Gedankenguts; Nazis waren Mainstream-Jugendkultur.
***
Doch es gab dort auch einige wenige wunderbare Lehrer und ausserschulische Projekte. Ich setzte meine Wandzeitungsredakteurskarriere fort, jetzt bei der Schülerzeitung, die mit dem daranhängenden Verein bald mein zweites Zuhause wurde. Während sich einige meiner Freunde angesichts des in Hoyerswerda wütenden Mobs begeisterten, wurde mir übel. Schliesslich wohnte ich als kleines Kind zusammen mit meiner Mutter in einem Studentenwohnheim, und meine besten Freunde dort waren sehr nette afrikanische Freiheitskämpfer, die in der DDR Revolution studierten. Ausserdem – ich war inzwischen 14 – waren die Mädchen an dem Gymnasium, die mich interessierten, eher in der linken Ecke verortet. Sie gingen in der Pause immer in ein obskures Cafe mit lauter Punks und komischen Gerüchen.
Meine alten Freunde fingen an, sich die Köpfe zu rasieren und zu den ersten DVU-, REP- und FAP-Schulungsveranstaltungen zu fahren. Ich hingegen liess meine Haare wachsen, färbte die Springerstiefel blau, fuhr zu Jugendpresseseminaren und war kaum noch für die Nazis zu sprechen. Erst war es eine stille Abkehr, doch spätestens mit dem Pogrom von Lichtenhagen wurde ein offener Konflikt daraus, der sich dann über die Jahre fortsetzte.
Mittlerweile war ich 15 und an meiner Kinderzimmerwand hingen Edelweisspiraten-Poster. Ich hatte Glück gehabt und gerade nochmal so die Kurve gekriegt. Für einen Protest vor Ort hatten wir nicht den Mumm, während meine alten Freunde tatsächlich begeistert und durch intensive Schulung aufgeputscht dort hin fuhren und wer weiss was anstellten. Später erfuhr ich in Berlin aus erster Hand, was in und um die Plattenbauten passierte: Ein inzwischen guter Bekannter begleitete die Bewohner des Sonnenblumenhauses auf der Flucht vor den Flammen bis unters Dach in purer Todesangst. Ihm legte ich meine erste Beichte ab in meinem neuen Berliner Leben, nachdem sich mein umgedrehter Magen nach seinen Geschichten wieder beruhigt hatte.
***
So war mein Wegzug auch eine Flucht. Sicher, in Stralsund hätte ich sowieso nicht studieren können, aber auch meine Besuche wurden immer seltener. Die meisten aus meinem Freundeskreis zogen genau wie ich nach Abitur und Zivildienst weg, wenn nicht Richtung Berlin, dann halt nach Hamburg oder richtig tief in den Westen. Kaum einer entschied sich für Rostock oder Greifswald, die Gründe lagen auf der Hand.
Stralsund aber veränderte sich: neue Ortsumgehungen und eine schicke Brücke Richtung Rügen wurden gebaut, die UNESCO erhob die Altstadt zum Weltkulturerbe, das berühmte Meeresmuseum zog in einen avantgardistischen Neubau am Hafen und die CDU-Wahlkreiskandidatin schaffte es bis ins Kanzleramt. Das gelang dem NPD-Kandidaten, der übrigens mit der Stadt genausowenig zu schaffen hatte wie sie, nicht ganz. Aufgrund seiner terroristischen Vergangenheit und Prominenz zog die Stadt jedoch erstmals bundesweite Aufmerksamkeit in dieser Sache auf sich.
Ganz anders als knappe fünf Jahre vorher, als ich ein Nazi war, stellte sich die Lage inzwischen etwas anders dar. Die Überfälle wurden weniger, was nicht nur an möglichen Strafen lag oder daran, dass die Schläger gerade ebendiese hinter Gittern verbrachten. Die Szene hatte sich auch umstrukturiert: Von DVU und REPs war nicht mehr die Rede, viel zu bürgerlich und von Millionären gesteuert. Die FAP war zwar verboten, aber ihre Kader bauten munter weiter straff Kameradschaften auf, die immer näher Richtung NPD rückten. So konnte zwar von hier aus lange Zeit unbehelligt das wichtigste Nazi-Portal betrieben werden, nach aussen gaben sich die Faschisten allerdings als Biedermänner und veranstalten bis heute sehr erfolgreiche Kinderfeste.
Das Fatale daran war, dass es für die Öffentlichkeit und Lokalpolitik lange keine Naziproblematik gab. Was natürlich Quatsch ist. Dahinter steckte eine ausgeklügelte Strategie, die scheinbar aufgegangen ist. Soweit, dass sich unbehelligt eine Terrororganisation bilden konnte, die im Übrigen in Stralsund gleich zwei ihrer Banküberfälle (auf die gleiche Sparkassenfiliale) durchführte, im November 2006 und Januar 2007. Mich würde nicht wundern, wenn sie in der Zwischenzeit nicht zurück in den Süden gefahren, sondern einfach irgendwo im Norden untergetaucht sind. Bönhardt, Mundlos und Zschäpe – alle aus meiner Generation – konnten hier garantiert auf gut funktionierende Strukturen zurückgreifen. Ich kannte die betreffenden Leute, ich bin mit ihnen zur Schule gegangen, ich war kurz einer von ihnen und habe dann lange von ihnen auf die Fresse bekommen.
***
Erfahrung macht klug, sagte meine Oma immer. Und aus meinen persönlichen Erfahrungen inmitten der und gegen die Nazis konnte ich wenigstens etwas lernen. Kurzum: Niemand wird als Nazi geboren. Doch Kinder und Jugendliche lassen sich wunderbar indoktrinieren, sei es in staatssozialistischen Jugendorganisationen oder bei den Nazis.
Es geht um Zugehörigkeit, Anerkennung und Identifikation. Und es braucht engagierte Menschen, die genau das jenseits von faschistischen Ideologien oder staatlich verordnetem Politunterricht vermitteln. Sowohl Schule als auch Eltern sind hier meistens die falschen Ansprechpartner (dafür aber gute Sündenböcke) – und oft hilflos. Ich hatte Glück. Meine Vergangenheit hat mich dazu gebracht, nie wieder einer Gruppe angehören zu wollen und stattdessen lieber ewig zu zweifeln. Ich kann aber auch sehr gut nachvollziehen, wie junge Menschen in dem braunen Sumpf stecken bleiben können und im Extremfall eben auch zu Terroristen werden. Die Geschichte ist voll damit.
Wie schon an vielen Stellen bemerkt, schafft hier weder ein NPD-Verbot noch ein perfekt funktionierender Verfassungsschutz Abhilfe. Solange die Nazis die Lücken besetzen, Kinderfeste veranstalten, Einkaufsbeutel die Treppen hochtragen, Hartz IV-Bescheide ausfüllen, Jugendclubs führen oder sonst wie reizvoller sind als Demokratie und Menschenwürde, solange wird sich nichts ändern. Es gibt unzählige hart arbeitende und täglich Bedrohungen ausgesetzte Menschen, die in der ländlichen Provinz versuchen, Jugendliche vom rechten Weg abzubringen. Wenn aber deren Arbeit nicht gewürdigt wird, und zwar ständig, offensiv und öffentlich, dann wird sich nichts ändern.
Wenn Menschen nicht das Gefühl haben, wichtig, akzeptiert, gebraucht und anerkannt zu werden von diesem Staat – also dazuzugehören – dann verwundert es kaum, dass sich einige von ihnen irgendwann gegen ihn wenden. Das gilt im übrigen nicht nur für Nazikinder.
Update 19.12.2011: Jana Hensel hat sich beim Freitag Gedanken gemacht, die in eine ähnliche Richtung gehen, eine Reaktion darauf von den Ruhrbaronen (bzw. publikative.org).
Update 21.12.2011: Eigentlich sollte das hier keine never ending story werden, aber weil es so gut ist und in die gleiche Kerbe haut, hier der Link zu einem Interview mit dem Filmemacher Thomas Heise in der taz.
***
Tja, 2011. (Und: 1990ff) Da hatte man zwar gerade eine leichte Ahnung vom NSU, sich aber Pegida und die anderen Abkürzungsnazis nicht im Traume vorstellen können. Zufälligerweise weist drei Türen weiter der kiezneurotiker in einem fabelhaften Text gerade auf einen anderen fabelhaften älteren Text hin, der Erinnerungen beschwört, die ähnlich sind und doch ganz anders.
Es ist nicht die Spanish Inquisition, aber ebenso unerwartet. Sollte ich das jetzt persönlich nehmen? Sollte ich mich freuen, oder sollte ich mir eher Gedanken machen, wo das hinführen könnte? Egal, da bin ich jetzt egoistisch, kommt selten genug vor (aus meiner Sicht jedenfalls^^): Jemand kommentierte dieses Blog – nicht hier, sondern in der Kohlenstoffwelt, wie man so sagt. Da hab ich mich wohl zu weit aus dem Fenster gelehnt, das die eine Realität von der anderen trennt. Selber schuld.
Ich habe das Partyklo-Schild natürlich wieder ordnungsgemäß befestigt, und der Kommentar zum Kommentar stammt nicht von mir, meine Narrenhände beschmieren meist nur virtuelle Klowände (id est: Ich habe selten einen Edding dabei.). Da sich noch jemand anderes angesprochen fühlte, kann es ja auch sein, dass dies gar nicht mir galt. Ich nehm‘ es trotzdem mal persönlich…
30.10.13
Diese ganzen bunten
Kapitalismuswerbeplakate
und Leuchtreklamen
hängen da doch auch nur,
um die brutalen Betonwände
der Sklavenverwahranstalten
zu verdecken.
Es ist ja so: Fängt ein Text mit „Es ist ja so“ an, dann erwartet man erst mal eine Ansage, etwas Konkretes. Tja.
Und ganz ähnlich ist das mit dem neuen Jahr und den ganzen Vorhaben, die man vor hat: Erst mal den Kater auskurieren, ausschlafen, halbwegs wieder in den Alltag zurückfinden, der genau der ist, den man dachte, mit dem vergangenen Jahr hinter sich gelassen zu haben. Tja.
Eigentlich schleppt man Jahr um Jahr mehr Ballast mit sich rum, und deshalb wird es Zeit, einiges davon loszuwerden. Neuer Ansatz, zwei Fliegen/eine Klappe: Eine Linkliste, willkürlich kombiniert mit den Analogfoto-Überbleibseln des letzten Jahres. Der Film war schon so lange im Apparat, dass sogar noch ein Gruß von der Hamburger Dachterasse drauf ist. Dabei ist diese Reise schon länger her, als noch Zeit vergeht bis zur nächsten, wenn alles klappt. Egal, Katzencontent:
Beginnen wir mal ausnahmsweise am Anfang: Dort standen bei vielen westdeutsch sozialisierten Menschen oft drei Fragezeichen. Also: Die drei Fragezeichen. Sowas gab es bei uns im Osten natürlich nicht, da gab es nur Ausrufezeichen. Und im Satz, den sie beendeten, stand meist irgendwas von Sozialismus und Sieg und Solidarität. Trotzdem würde ich, hätte ich Kinder, wohl die gleiche Wahl treffen, die bei Perspektiefe mit all ihren Fährnissen anschaulich geschildert wird (& was für ein schöner Titel!). Vor allem, wenn ich so höre, was die Kinder in meinem Umfeld so hören. Meist geht es um reiche Mädchen und Pferde. Immerhin kann einer der Kleinen noch den halben Tag (wortwörtlich) total begeistert mit dem Mobiltelefon rumlaufen und die Egon-Olsen-Titelmelodie kreischend mitbrüllen.
Auf Die drei Fragezeichen stiess ich viel später und aus zweiter Hand, sozusagen: Diejenigen, die damit gross wurden, frönten ihrer Begeisterung für die Kinderhörspielkassetten ja grade auch als Studenten ausgiebig. Das machte sich eine Theatertruppe aus Wuppertal zunutze und füllte die Hallen quer durch die Republik. Selbst mit fehlendem Hintergrundwissen und der falschen Sozialisation war das stellenweise ganz unterhaltsam. Doch auch – wo wir schon mal beim Thema sind – aus ganz anderen, noch seltsameren Jugenderinnerungen mit zweifelhaftem kulturellen Background lässt sich ein krudes Theaterprojekt machen: Katholische Sexualaufklärung aus den Siebzigern? Warum nicht, ab auf die Bühne! Dorthin gehört auch Gregor Keuschnigs Schmierenkomödie Zapfenstreich, die es bisher nur in Textform gibt.
Ein harter Schnitt, da müssen wir jetzt durch: Bei den Nachdenkseiten wurde heute eine Leserin mit der Anmerkung zitiert: Der Wahlkampf 2017 wird eine Braune Schlacht. Mir graut es jetzt schon! Stimmt wohl, aber wer braucht eigentlich die AfD und Pegida, wenn Seehofer schon vor 3 Jahren „bis zur letzten Patrone“ gegen „Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme“ kämpfen wollte? Zauberlehrling usw.
Zur tagesaktuellen Situation enthalte ich mich, alles viel zu unklar, auch und vor allem in meinem Kopf, nur eins noch: Das Zusammentreffen unschöner Ereignisse kann zu einem unerwarteten Ausgang führen, sprich: Die Gunst der Stunde, oder der böse Zwilling von Kairos sprechen gerade vielleicht für die Islamhasser. Vielleicht aber auch im Gegenteil – ich bin nur etwas skeptisch, weil ich kürzlich die arte-Doku über Ishiwara Kanji gesehen habe: Eine von der Mehrheit nicht gewollte Militäroperation nationalistisch-konservativer Offiziere glückt dummerweise und macht aus der liberalen, modernen Demokratie der 20er Jahre einen von Nationalismus besoffenen Hitlerverbündeten. Platt ausgedrückt, aber so schnell kann es gehen.
Natürlich reicht es zur Erklärung aktuellen Geschehens nicht aus, nur in alte Bücher zu schauen. Aber es gibt da durchaus interessante, hochaktuelle Stellen, bei Foucault zum Beispiel, wie auf haftgrund zu lesen ist. Gemischt mit einigen der unzähligen Alltagsberichte – Keiner kommt hier lebend raus, ohne Zweifel – führt das unweigerlich zu gezielter Ignoranz. Manchmal reicht es aber auch schon, sich nur eine Statistik mal ganz genau durch den Kopf gehen zu lassen. Oder ein Taufregister zu lesen, das inzwischen wahrscheinlich schon jeder kennt, aber es passt so gut zu den nächsten beiden Bildern:
Berlin also, und die alten, leidigen Berlin-Probleme. Da es hier überraschend ruhig ist (die für spätestens zum 31.12. erwartete Modernisierungsankündigung lässt erstaunlicherweise noch auf sich warten. Wir reiben uns die Hände, nicht nur, weil die Kohlen langsam knapp werden…), ein paar nützliche Hinweise zum Berliner Winter von katjaberlin. Eine der blödesten Sachen am Winter in Berlin ist der November. Grübeln, Gedanken nachhängen, noch mehr Gedanken nachhängen und fotografieren. So ähnlich ging es mir auch, nur schaffte ich es selten bis an die Tastatur. Dann kam der Dezember und mit ihm, wenn man weihnachtsbedingt in die Heimat der Kindheit und Jugend fährt wie Thorge, auch die Erinnerungen. Auf melancholie modeste sind es die an den sonntäglichen Esstisch der Großeltern – und was dieser (nicht) mit Neukölln zu tun hat. Apropos Essen:
Gleich nebenan – aufgenommen wurde dieses Bild im Herzen von SO36 – befindet sich ein Imbiss namens Curry 61. Während das aus Funk&Fernsehen bekannte Curry 36 im tiefsten Kreuzberg 61 liegt. Muss man nicht verstehen, dieses Berlin (es hat wohl mit der Hausnummer zu tun, aber psst!). Genausowenig wie die immer noch existierende Schlange vor dem Gemüsekebap. Doch ich schweife ab, eigentlich sollte es jetzt um schöne & gute Texte gehen.
Erstmal die Theorie: In der NZZ schreibt Matthias Politycki darüber, was ihn zum Schreiben brachte. Aléa Torik setzt sich mit der zweifelhaften Notwendigkeit von Handlung auseinander und Jutta Reichelt mit der Leserperspektive. Ganz ähnlich, nur etwas weiter gesteigert (Lesen vor Publikum), in der angenehmen Reihe „Vielleicht später“ vom Suhrkamp-Blog: Bad Segeberg von Detlef Kuhlbrodt. Zum Schluss, aber immerhin, sei noch auf die Lyrik-Betrachtungen bei kleinedrei hingewiesen. Kommt ja sowieso meist zu kurz, die Lyrik.
Als Finale einige Praxisbeispiele, sozusagen. Tikerscherk lässt ungeschaffenes Licht strahlen, in Lencois, wie es der Kiezschreiber beschreibt, strahlt die Sonne etwas trostlos auf einen Säufer, Monsieur Manie beschreibt in mehreren Teilen Die Probe und Thibaud sagt etwas über eine Musikerin. Auch in diesem (einen von vielen, wie bei allen anderen Erwähnten und vielen Nichterwähnten ebenso) schönen Text von asal spielt Musik eine wichtige Rolle. Asallime, soviel Resumee muss sein, war neben Mikis Wesensbitters Mauerfall-Tagebuch meine Blog-Entdeckung des letzten Jahres.
Falls jetzt jemand angesichts des Jahresbeginns einen Ausblick erwartet hat: Da verweise ich auf Ahne, oder auf dieses Bild:
Ein altes DDR-Ferienlager, größtenteils im Originalzustand.
Die Gruppe schläft zusammen in einem Raum, Doppelstockbetten.
Ein Zwei-Stunden-Spaziergang durch den Wald, dann über den alten Truppenübungsplatz, die Hunde viel zu beschäftigt, um sich den Weg zu merken.
Verlassene Schiessstände, kleine Betonbaracken, zugetaggt.
In einem Größeren ein ausgeschlachteter Trabi.
Der Schnee schmilzt, doch noch ist genug von ihm da.
Das Holz, im Wald aus dem Schnee gefischt, gibt doch ein gutes, ein schönes, ein perfektes Lagerfeuer. Stundenlang.
Knisterndes Feuer, verpasste Gelegenheiten. Stundenlang. Dann Nebel.
Die Stadt weit genug weg: kein Lärm, kein Knallen, keine pünktlich terminierte Fröhlichkeit.
Und doch: Irgendwoher taucht die obligatorische Magnumsektflasche auf, die keiner trinken will & die dann doch irgendwann leer ist.
Aufgeweckt von der Sonne, die den Schnee verscheuchte. Auch in diesem Jahr hat jede Medaille also mindestens zwei Seiten und der Hof ist voller Pfützen.
Erste kleine Dramen, erste Beruhigungen.
Zum Bus, schon wieder im Dunkeln, schon wieder Frost. Glatteis statt Schnee auf den Wegen.
An der Haltestelle Knöpfe, die man drücken muss, will man mitgenommen werden. Was trotz unserer inkompetenten Bedienung funktioniert.
Die Stadt empfängt uns in ihren Vororten mit absurd blinkenden Vorgartenschmuck. Lichtvöllerei.
Tagelang noch das Gefühl, nicht angekommen zu sein, weder im Raum, noch in der Zeit.
Es war gut, es war die richtige Entscheidung.
Eigentlich wollte ich mich sang- und klanglos verabschieden aus diesem Jahr. Doch die gute tikerscherk löste mit ihrem letzten Beitrag etwas in mir aus: Also bin ich schnell die Treppen runter – der Ascheeimer quoll sowieso schon wieder über – und machte fix ein Foto, oder das, was das antike Mobiltelefon dafür hält. Deswegen, statt vieler Worte, ein paar räudige Bilder als letzter Gruss aus einem räudigen Jahr:
Da Morgen ja gefeiert wird (zum Glück habe ich mich überreden lassen, mich vor die Tore der Stadt des Bürgerkriegsgebiets zu verziehen), ist eine dementsprechende Örtlichkeit unverzichtbar:
Dieses befindet sich übrigens in einer Lokalität, die im gerade auf dem letzten Loch pfeifenden Jahr mehr und mehr zu meinem zweiten Wohnzimmer wurde. Schon alleine wegen der Gespräche dort: „Ist Keks da?“ – „Der mit dem Feuerzeug im Ohr?“ – „Nee, das ist Dose.“ – „Die sollten ma heiraten, wär‘ doch ’n schnieker Doppelname!“
Nach einer längeren Nacht verewigte sich hier eine durchreisende Musikgruppe, die ich vergeblich versuchte zu überzeugen, ihren Namen in „Die herrenlosen Koffer“ zu ändern, mit einem inzwischen langsam verblassenden Schriftzug unter der Dartscheibe (Kreide, kein Edding, stilvoll wie sie sind): Reisegruppe Unangenehm. Passt auch.
Politik gibt es da natürlich auch:
Wie an fast jeder Ecke in dem Kiez. Hier eine meiner liebsten:
Eine Zugabe für den Kiezneurotiker:
Ein Panorama für alle:
Kölner Dom, Innenansicht Dach, ca. 2011:
Mit diesen Worten, ebenfalls Köln und leider ebenfalls in ganz mieser Qualität, lass ich das Jahr dann mal ausklingen. Gehabt Euch wohl:
Kein Rant, kein Appell, kein Rückblick.
Keine guten Vorsätze.
Keine Empörung, nur stummes Verzweifeln.
Kein Schnee, keine Geschenke und keine Lieder.
Keine Party, nichts zu feiern.
Kein Kater, immerhin.
Kein Mut und kein Sinn.
Kein Glaube, keine Liebe, keine Hoffnung.
Keine Ahnung, wie das weitergehen soll.
Kein Ende in Sicht.
Keine letzten Worte.
Keine Lügen mehr.
Keine Schuldzuschreibungen.
Keine Ausflüchte und keine Kompromisse.
Kein Warten auf Besserung.
Kein Aber und kein Was wäre wenn.
Keine Ahnung, ob das klappt.
Keine andere Möglichkeit.
Keine letzten Worte.
Doch wo die Vergangenheit schweigt,
nicht wo sie spricht, läßt sie hoffen.
Bei dem Kneipengespräch im Wedding kamen wir auch auf Hochhuth zu sprechen. Wir waren uns soweit einig, dass dessen Werk heute unterschätzt wird, dass seine Bedeutung für die (bundes)deutsche Geschichte nicht genug gewürdigt wird. Was natürlich auch an den Berliner-Ensemble-Possen des Autors selbst liegt, und an seinen anderen Altmänner-Marotten. Eine der Ursachen des komisch-wirren Verhaltens Hochhuths ist wohl auch sein eigenes Erkennen des Bedeutungsverlusts seiner Person. Das wurmt, keine Frage.
Das letzte Gute, was man von ihm hörte, war sein – schliesslich und endlich von Erfolg gekröntes – Engagement für das Georg-Elser-Denkmal in der Wilhelmstrasse. Seine letzten Stücke kannte, wenn ich mich recht erinnere, selbst die Regisseurin nicht, sondern nur die Possen, aber auch von denen längst nicht alle. Aus zehnjähriger Erinnerung erwähnte ich „Soldaten“ – das sollte man mal lesen, das sollte ich auch mal wieder lesen, meinte ich.
Und tat es dann auch. Literarisch ist es kein Meisterwerk, zugegeben. Schon 1963 schreibt Hochhuth an Golo Mann (dankbar für dessen Zuspruch) – und das gilt wohl bis heute: Meine Situation ist ja so: Die Historiker klopfen mir auf die Schulter und finden, ich hätte bei totaler Verzerrung der Geschichte immerhin literarische Verdienste. Die Literaten finden, ich hätte wenigstens historische. (zit. nach: Sie sind ein Fanatiker der Gerechtigkeit, Der Bund, 24.3.2001).
Das Thema von „Soldaten“(oder besser: die Verknüpfung der Themen) ist – noch mehr als vor zehn Jahren, als ich es das erste Mal las – hochaktuell: In den Rahmen einer Theateraufführung zum hundertjährigen Jubiläum der ersten Genfer Konvention 1964 eingepasst (Aufführungsort: Coventry), spielt der größte Teil des Stücks in den Monaten April bis Juli 1943. Er verwebt darin zwei Komplexe, die sich beide in der Hauptfigur Churchill (der im Stück nur „PM“ genannt wird) kristallisieren – wer Gutes will, muss Böses tun, oder wie Hochhuth selbst sagt: Leider trifft eben zu, daß Gegner immer auch Eigenschaften austauschen, wenn sie sich nur lange genug gegenüberstehen. [a]
Einerseits dreht sich die Handlung um den Tod (bzw. die Ermordung) des polnischen Exilpremiers und „letzten Reitergenerals“ Sikorski, andererseits um den Luftkrieg generell und die Operation Gomorrha im Speziellen. Deshalb auch der Untertitel „Nekrolog auf Genf“.
Es geht also um das lübecken und coventrieren, Hochhuth klagt an, dass es analog zum Landkriegsrecht keines für die Lüfte gibt (das kam – ansatzweise – erst 1977). Das moralische Dilemma Churchills wird schnell klar, ebenso die Unschärfe der Grenzen des Erlaubten. Es spricht, im ersten Akt, also 1964, der Autor-Regisseur und ehemalige Group-Captain des britischen Bomberkommandos:
DORLAND galgenlustig: Nein? – Und: S o l d a t e n!
Vorsicht, Soldat ist, wer Soldaten bekämpft, Kampfflieger, die Panzer anzielen, Brücken, Industrien, Staudämme. Du bist keiner – sowenig wie ich über Dresden einer war.SOHN aufstehend: Was bin ich sonst als Planungsassistent?
DORLAND affektlos, ganz ruhig, ein Sachwort:
Ein Berufsverbrecher. Ein potentieller Berufsverbrecher.[…]
DORLAND: Piloten töten Wehrlose, als g ä b e es kein Rotes Kreuz.
Doch nur M i n u t e n später,
wenn sie abgeschossen, selbst wehrlos
denen in die Hände fallen, die sie bombten:
d a n n soll es gelten, das Rote Kreuz – für s i e. (S.30f.)
Von Vietnam bis zu den Killerdrohnen in Pakistan, vom Bombergate (und den alljährlichen Verrenkungen, wie man in Dresden denn am besten mit diesem “Gedenktag” umgehen sollte) bis zu den Morddrohungen gegen den “Landesverräter” Gideon Levy (weil er die Rolle der Bomberpiloten im letzten Gaza-Krieg hinterfragte) – der Luftkrieg begleitet uns seit knapp einhundert Jahren. Doch Luftkrieg ist natürlich nicht gleich Luftkrieg, und Abfangjäger sind etwas anderes als Bomberpiloten, worüber sich Sir Arthur Harris (als “Traumpartner”) auch in “Soldaten” echauffiert:
TRAUMPARTNER: […]
Der Dank der Nation – daß sechsundfünfzigtausend Briten
und über vierzigtausend Amerikaner
in Bombern über Deutschland gefallen sind…
Er ist erschüttert, Dorland auch.
Die Gefallenen des Jägerkommandos, alle, j e d e r einzelne,
der in der Battle of Britain fiel,
hat seinen N a m e n auf der Ehrentafel in Westminster.
Von e u c h , von m e i n e n Männern, den Bombern:
ist nicht einmal die Z a h l in Westminster zu lesen.
DORLAND bestürzt: Weil es so viele sind, Air-Marshall – zu viele.
TRAUMPARTNER lacht schauerlich: Wem reden Sie das ein, Major:
die Z a h l meiner toten Männer – die Z a h l, wie:
ließe sich doch wohl unterbringen in Westminster.
Aber u n s r e geopferten Kameraden, wie – die sind,
plötzlich, nicht wahr: nicht mehr gesellschaftsfähig. (S.45)
Was soll man denn auch entgegnen auf die Frage, ob das area bombing nun ein Kriegsverbrechen war oder ein legitimer Versuch, den Krieg vorzeitig und unter womöglich insgesamt weniger Verlusten zu beenden? Ein letztes Mal Bomber Harris:
TRAUMPARTNER: […]
Hitlers Rüstungschef, sein Speer, hat nach dem Kriege zugegeben:
sechs weitere Städte angeflogen wie Gomorra,
die Nazis hätten ihre Bude schließen müssen.
Ich bitte Sie: Hamburg erbrachte vierzigtausend Tote.
Mal sechs – was wäre das, verglichen mit d e r Zahl,
die w i r k l i c h umkam bis zum Kriegsschluß!
Jedoch, Soldat ist, wer beschimpft wird. (S.44)
Die Antwort – zumindest in der Literatur – war meist Schweigen, bis 1997 W.G. Sebald in seiner Zürcher Poetikvorlesung ebenjenes kritisierte und damit eine Debatte, begleitet von einer kleinen Veröffentlichungsflut, lostrat. Sebald schrieb 1997 von einem
bis heute nicht zum Versiegen gekommene Strom psychischer Energie, dessen Quelle das von allen gehütete Geheimnis der in die Grundfesten unseres Staatswesens eingemauerten Leichen ist, ein Geheimnis, was die Deutschen in den Jahren nach dem Krieg fester aneinander band und heute noch aneinander bindet, als jede positive Zielsetzung, im Sinne etwa der Verwirklichung der Demokratie, es jemals vermochte. Vielleicht ist es nicht verkehrt, an diese Zusammenhänge gerade jetzt (1997) zu erinnern, da das zweimal bereits gescheiterte großeuropäische Projekt in eine neue Phase eintritt und der Einflussbereich der D-Mark – die Geschichte hat eine Art, sich zu wiederholen – ziemlich genau so weit sich ausdehnt wie im Jahr 1941 das von der Wehrmacht besetzte Gebiet. [zit. nach Hayner, Elende Patrioten, Link oben]
Wie nun im Zuge solcher Ausdehnungen ein Land zwischen den Fronten unter die Räder kommen kann, das lässt sich momentan gut an der Ukraine beobachten. In “Soldaten” kommt diese Rolle dem Polen Sikorskis zu. Erst von England und Frankreich mit nichts als Lippenbekenntnis-Kriegserklärungen alleingelassen und feinsäuberlich seziert von Hitler und Stalin, muss er nun mit Letzterem als Verbündeten, nicht mehr als Feind und Besatzer, umgehen. Was zunehmend schwieriger wird: Einerseits wegen der strittigen sowjetisch-polnischen Grenzfrage, andererseits, weil ein Teil seiner seit Jahren vermissten Offiziere bei Katyn in Massengräbern gefunden wurden. Die NS-Propaganda schlachtet diesen Fund genüsslich aus und beschuldigt Stalin, Sikorski ist geneigt, den Deutschen zu glauben und eine Untersuchung beim Internationalen Roten Kreuz in Auftrag zu geben.
Churchill, Gastgeber Sikorskis, bittet ihn vergeblich, keine weiteren Schritte zu unternehmen, Stalin bittet Churchill um eine Auswechslung der polnischen Exilregierung. Als weder die USA noch Grossbritannien dem Insistieren des Diktators nachgeben, beruft dieser seine Botschafter aus Washington und London ab – eine der grössten Krisen der Anti-Hitler-Koalition und geeignete Kulisse, um auf der Theaterbühne einen absichtsvollen Flugzeugabsturz zu konstruieren und ihn implizit Churchill in die Schuhe zu schieben.
PM, während Cherwell liest, zu Brooke:
Schlimmer als ein Desaster an der Front.CHERWELL, indem er Brooke das Kabel hinüberreicht:
Stalin hat die Beziehungen zu Polen abgebrochen!PM: Wie habe ich Stalin a n g e f l e h t ,
d i e s e n Trumpf dem Hitler nicht zu gönnen!CHERWELL – das einzige Mal im Stück, da er tiefes Betroffensein zeigt. Er preßt sich die Worte ab:
Jetzt aber runter vom Schlitten mit dem Polacken.[…]
BROOKE: Ich war zum Lunchen mit Sikorski:
trotz Katyn will er seinen Frieden mit Stalin.
Aber er m u ß t e doch zunächst …PM, als wolle er Brooke umrennen („Er hielt mir die Faust unter die Nase“):
M u ß t e! — Was mußte er!
Hinter meinem Rücken im Weißen Haus
dreimal, d r e i m a l den Präsidenten überreden,
der britischen Regierung zu v e r b i e t e n,
dem Kreml die Wiedergewinnung zaristisch-russischer Provinzen zu garantieren!CHERWELL, da PM vor Erregung nicht weitersprechen kann:
Solange d i e s e r Pole da ist, Sir Alan,
hat Großbritannien k e i n e Garantie,
daß nicht der Kreml aus dem Kriege aussteigt
und sich erneut mit Hitler arrangiert.BROOKE ratlos: Warum gibt Roosevelt Sikorski nach?
PM ungeduldig, barsch: Weil Sikorski acht Millionen Polen in USA die Wahl vorschreibt, natürlich! (S.108f.)
“Soldaten” wurde 1967 veröffentlicht und ist Hochhuths zweites Stück – er war also nach dem “Stellvertreter“ schon einiges an Kritik und Trubel gewohnt, hatte aber auch bedeutende Fürsprecher wie Hannah Arendt gewinnen können, die in New York für ihn Partei ergriff, kurzum: Sein Debüt war ein bahnbrechendes Ereignis, das weit über die Grenzen des Literatur- und Theaterbetriebs hinaus wirkte.
Keine Frage, dass der Nachfolger eines solchen Durchbruchs besonders beäugt wird, ganz zu Schweigen von der Situation des Autors, der nachlegen muss. Doch zum Glück fiel Hochhuth die Sikorski-Handlung aus heiterem Himmel in den Schoss, welch grossartiger Zufall für jemanden, der ein neues, provokant-spektakuläres Stück Dokumentartheater braucht. Im Spiegel erklärte er: „Ich habe von Sikorski nichts gewußt bis zu einer bestimmten, sehr zufälligen Begegnung. Dieser Mann wäre mir als Zeuge absolut unverläßlich, wenn ich ihn nicht durch einen Sack voll Indizien hätte ernst nehmen müssen.“
Passenderweise hatte sich Hochhuth – beginnend mit einem Stern-Gespräch 1965, einen Tag nach Churchills Tod – mit einem jungen britischen Autor angefreundet, der ebenfalls vor Kurzem ein aufsehenerregendes Buch geschrieben hatte – das erste Standardwerk über die Bombardierung Dresdens, laut ihm Hochhuths ursprüngliche Inspiration für „Soldaten“. Er bat seinen Freund, zum Sikorski-Fall Nachforschungen anzustellen, denn das war dessen Domäne: Quellen auftun, so unmöglich es auch scheint. Der Freund war anfangs wenig begeistert, stiess dann aber doch auf so viele Ungereimtheiten, dass er selbst ein Buch darüber schrieb – es sollte pünktlich zur englischen Uraufführung von „Soldaten“ erscheinen.
Hochhuth schlägt mit seinem so erworbenen Recherchematerial in dem Stück und in den langen Vor- und Zwischenreden geradezu um sich. Er erläuterte in zwei langen Spiegel-Beiträgen seine Theorie (das Hamburger Magazin druckte darüber hinaus auch den – leicht gekürzten – zweiten Akt des Stückes ab), ansonsten beharrte er darauf, seine Informanten schützen zu wollen und deshalb für 50 Jahre seine Dokumente in einem Schweizer Banktresor aufzubewahren. Obwohl er viele weitere interessante, bedeutende und nicht so bedeutende Fakten einstreut (die Geschichten der Herren Lindemann (Baron Cherwell) und Bell beispielsweise) und in der moralischen Bombenkriegsfrage den eigentlichen Schwerpunkt setzt, ist doch die Churchill-Anklage das, was am meisten Aufmerksamkeit bekam.
Auch wenn Hochhuth derjenige ist, den der Kanzler Erhardt 1965 einen Pinscher nannte und damit eine ganze Zunft gegen sich aufbrachte, auch wenn er der ist, der später Filbinger zu Fall brachte (was – oh Ironie! – Weikersheim gebar) – leicht in Schubladen einzuordnen war er bereits damals nicht. Es wurde ihm schon anlässlich „Soldaten“ eine Nähe zu Spengler und Jünger attestiert, deren „heroischer Nihilismus“ nicht weit entfernt sei von Hochhuths Geschichtspessismus.
So verwundert es nicht, dass angesichts der verwirrenden Person Hochhuth und der Premiere von „Soldaten“ im sowieso schon verwirrten Westberlin anno 1967 auch die K1 ein Wörtchen mitreden wollte beim bevorstehenden Theaterskandal:
Der grossartige Wolfgang Neuss – im Stück mit einer kleiner Nebenrolle betraut – sollte für die „Berliner Horror-Kommune“ sein Garderobenfenster offen lassen, damit Kunzelmann, Langhans und Co. dann auf den Brettern der Freien Volksbühne ihre Forderung nach der Freilassung Fritz Teufels vortragen konnten. Die Flugblätter waren schon gedruckt: „Auf der Bühne die großen Gauner. Im Parkett die kleinen.“ Dummerweise löschte der Nieselregen die Zündung der Signalrakete.
Aus dem Skandal wurde also nichts und auch die Kritiken waren höchst verhalten. Hochhuths Verleger führte das auf Rudolf Augsteins missmütige Besprechung zurück – ein interessantes Schlaglicht zum Thema Journalismus damals und heute, wenn man bedenkt, dass das Blatt über zwei Ausgaben in unglaublich ausführlicher Form anlässlich der Premiere ein Stück pushte, welches dem Chef scheinbar nicht zusagte. Der Spiegel selbst zitiert genüsslich: Verdorben war der Abend, meint der „Soldaten“ – Verleger Rowohlt, dennoch – durch den Dolchstoß eines deutschen Nachrichten – Magazins; schon bei der morgendlichen Pressekonferenz am Premieren-Montag schien es dem „Theater heute“ – Chef Henning Rischbieter „überflüssig, daß noch der Vorhang aufgeht, nachdem heute morgen im SPIEGEL ein zutreffender Verriß des Stückes gestanden hat“. Der Artikel liefert auch gleich noch einen Überblick über die Besprechungen in der internationalen Presse:
Rolf Hochhuths „Soldaten“ hatten keine Fortüne. Die 150 Rezensenten und Sendboten von 44 Rundfunk- und TV-Anstalten, die am vergangenen Montag in Berlins Freier Volksbühne das Churchill-Pasquill besahen, urteilten meist nörgelnd:
Die „Bombe detonierte wie ein feuchtter Knallfrosch“ („Financial Times“); im „Römerdrama eines edel denkenden Studienrates“ („Süddeutsche Zeitung“) „langweilte man sich mächtig“ („Die Welt“).
Dem „Volkshochschulkurs in Geschichte“ („The Guardian“) gebrach es an „Klarheit und Schwungkraft“ („Herald Tribüne“). „FAZ“: „Wir haben noch keinem kühneren Mißlingen zugesehen.“
Augstein äußerte dagegen fast nüchtern hauptsächlich handwerklich-thematische Kritik, sprach von einem „unglücklichen Einfall“ Hochhuths und war gespannt, wie es den Regisseuren gelingt, den ganz untheatralischen Widerstand zu überspielen, der sich im Zuschauer regen könnte, weil Hochhuth nicht den Anschein eines Beweises bringt. Die Zeit resümierte, daß der Haupteindruck der einer großen Fernseh-Sondersendung ist, aber nicht der von intensivierender Kunst. In Anlehnung an die vermeintlichen Beweise, von Hochhuth im Schweizer Banktresor gesichert, meinte der Tagesspiegel 1969, er hätte lieber die Dokumente veröffentlichen und sein Stück für fünfzig Jahre wegschließen sollen. Anlässlich der zweiten Inszenierung in Bochum stellte der Autor resigniert fest: Ich werde auch mein zweites Stück gegen die deutsche Theaterkritik durchsetzen müssen.
Ganz anders in England – hier war der Skandal praktisch programmiert, schliesslich klagte Hochhuth mehrere hochdekorierte Personen direkt mit dem Stück an. Eigentlich war die Welturaufführung in London geplant, doch es sollte anders kommen. Sir Laurence Olivier, der künstlerische Leiter des National Theatre, berief 1963 Kenneth Tynan zum neuen Chefdramaturg. Um Profilierung – nicht nur seiner Person, sondern auch des National Theatre gegen die Konkurrenz der Royal Shakespeare Company – bemüht, suchte dieser nach einem passenden (möglichst provokativem) Stück. Als er 1966 „Soldaten“ entdeckte, schrieb er an Olivier: I don’t know whether this is a great play, but I think it’s one of the most extraordinary things that has happened to British theatre in my lifetime.
Olivier (der angeblich den Inhalt des Schweizer Banktresors kannte) mochte das „bloody play“ nicht, verteidigte es aber auf dem Boardmeeting des National Theaters mit einem Verweis auf Aristoteles‘ Poetik: the artist’s function is to describe not the thing that happened, but a kind of thing that might happen. Es half nichts, das Gremium entschied sich gegen eine Aufführung, was vielleicht auch daran lag, dass dessen Vorsitzender, Lord Chandos, als Mitglied von Churchills Kriegskabinett „Soldaten“ naturgemäß nichts abgewinnen konnte.
Tynan wollte nicht von dem Stück lassen und bemühte sich weiter um eine Inszenierung. Nun existierte damals in Grossbritannien noch eine Theaterzensur, die es nicht gestattete, noch lebende Personen unvorteilhaft in Szene zu setzen. So beschwerte sich Sir Arthur Harris bei dem für Zensur zuständigen Lord Chamberlain und der Vorhang blieb weiter geschlossen. Das Getöse um „Soldaten“ befeuerte allerdings die Anti-Zensur-Kampagne kräftig, die schliesslich 1968 ihr Ziel erreichte: Die Zensur wurde abgeschafft und Hochhuth durfte gespielt werden. Die englischsprachige Premiere war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon auf einer kanadischen Bühne gelaufen, Tynan selbst inszenierte das Stück im Dezember 1968 in Londons West End New Theatre – dort lief es nur drei Monate.
Bomber Harris sollte nicht der letzte gewesen sein, der sich juristisch gegen „Soldaten“ wehrte. Der einzige Überlebende des Absturzes, der inzwischen in den USA lebende Tscheche Eduard Prchal, empfand die Darstellung seiner Person als diffamierend und verklagte Hochhuth. Er bekam 50.000 Pfund zugesprochen, damals 420.000 DM – Hochhuth, mit sicherem Wohnsitz in der Schweiz, weigerte sich zu zahlen. Und noch einen weiteren – weitaus schillernderen – Gegner hatte sich Hochhuth eingehandelt.
Ein ehemaliger Schauspieler, inzwischen Ehemann Lili Palmers und Schriftsteller, außerdem Geheimdienstoffizier und eventueller zukünftiger Präsident Argentiniens hatte sich vorgenommen, aus Hochhuth einen tragischen Witz zu machen. Zur Londoner Premiere druckte der Sunday Telegraph Passagen aus Thompsons Buch über Hochhuths Theorie ab. Thompson arrangierte den Kontakt zu Hochhuth über Friedrich Dürrenmatt und half als Dolmetscher bei den Gesprächen zur englischen „Soldaten“-Premiere aus. Im Zuge dessen gelangte er zu dem Eindruck, bei Hochhuths „Rufmord an Churchill“ wäre alles Vermutung und Erfindung, der Dramatiker leide an einem Trauma und wolle eine poetische Rache für das deutsche Volk ausüben. Hochhuth: Ich habe ihn mir zugezogen wie andere sich eine Schleimhautentzündung zuziehen.
Wer bis hierher vorgedrungen sein sollte, der wird sich vielleicht langsam die Frage stellen, was das überhaupt soll. Deshalb einige erklärende Worte: Es hängt mit besagtem Freund Hochhuths zusammen, der in einigen Links schon enttarnt wurde. Und mit der aktuellen Querfront-Debatte.
Ich versuche ja, mich zum politischen Tagesgeschäft zunehmend zurückzuhalten (das klappt, trotz aller Appelle, nicht immer), wollte es mir aber nicht nehmen lassen, in die nächsten Linksammlung einen bestimmten Artikel aufzunehmen. Weil er es wert ist, und weil mich dieses Thema immer noch triggert.Ich suchte nach einer Anmoderation und da kam mir ein (inzwischen unauffindbarer) Text, ein Projekt von 2005 in den Sinn: Die Freundschaft zwischen David Irving und Rolf Hochhuth, (mal wieder) öffentlich aufgedeckt im Zuge des Skandals um Hochhuths Interview in der Jungen Freiheit, in dem er behauptete, er kenne keinen „Fall Irving“ und dessen Holocaustleugnungen mit unfassbarer Ignoranz vom Tisch fegte. [b]
Auch hier ging es – nicht zum ersten Mal, gerade was die Junge Freiheit betrifft nicht zum ersten Mal – darum, wer wem Interviews geben sollte, oder eben nicht. Auch hier spielten Antisemitismus und der Antisemitismusvorwurf eine entscheidende Rolle. Auch hier gab es kein Schwarz-Weiss-Urteil, dafür Grauzonen, Querfronten und eine Medienkampagne, teils fern jeglicher journalistischer Recherchepflicht.
Erstaunlicherweise kaum thematisiert im Rahmen des Skandals wurde der Umstand, dass dies beileibe nicht Hochhuths erster Beitrag für die Junge Freiheit war. Im Jahr 1998 lieferte er einen Ernst-Jünger-Nachruf und zwei Jahre später ein Interview, in dem er pikanterweise an Martin Walser gerichtet meint, bezogen auf dessen Paulskirchen-Rede: Aber so voraussehend mußte er doch sein, um zu erkennen, daß das mißverstanden werden würde.
Genau das könnte man Hochhuth auch entgegenhalten. Pünktlich zum fünfzigsten Jahrestag der Bombardierung Dresdens befragte die JF Hochhuth nach seiner Freundschaft zu Irving. Hochhuth empörte sich darüber, daß die Stadt Dresden es nicht für nötig befunden hat, Irving als Ehrengast zu den Feierlichkeiten einzuladen, schliesslich habe er mit „Der Untergang Dresdens“ viel für die Aufarbeitung dieses Kapitels getan: Ein fabelhafter Pionier der Zeitgeschichte nennt er ihn, ein Historiker von der Größe eines Joachim Fest. Der Vorwurf, er sei ein Holocaustleugner ist einfach idiotisch! Solche Äußerungen im Jahr 2005, zumal von jemanden, der Irving sehr nahe steht, sind, gelinde gesagt, zumindest ebenso idiotisch. Das sollte auch Hochhuth später einsehen – doch ersteinmal musste der Skandal eingetütet werden, was scheinbar nicht so einfach war. In der Zeit schreibt Jens Jessen:
Der Berliner Tagesspiegel hat das Interview entdeckt und seinerseits Hochhuth befragt, der aber, weit entfernt, davon abzurücken, noch eins draufsetzte und Irving für »sehr viel seriöser als viele deutsche Historiker« erklärte.
Das war letzten Sonnabend. Der Tagesspiegel wartete, was passieren würde. Als am Montagmorgen noch nichts passiert war, schrieb er, es sei ein Skandal, dass der Skandal nicht bemerkt worden sei.
Es folgten unzählige Artikel und Äusserungen zu dem Interview, die Hochhuth unisono vorwarfen, für Irving, den schon seit Jahren überführten und verurteilten Holocaustleugner ein Ehrenerklärung abgegeben zu habe. Die Deutsche Verlagsanstalt (nicht aber, wie fälschlich verbreitet, der dtv) rückte im Zuge des Skandals davon ab, ein geplante Ausgabe autobiografischer Schriften Hochhuths zu veröffentlichen: so jemand könne nicht in einem Verlag veröffentlichen, der selber sehr viele jüdische Autoren im Programm hat. Die angesprochenen jüdischen Autoren hatten mit keiner Silbe einen Bann Hochhuths gefordert. Den Höhepunkt der Kampagne sahen sowohl die NZZ als auch der Autor selbst in einer Spiegel-Bildunterschrift zu einem Interview mit dem neuen Präsidenten des Zentralrats der Juden (unter dem Bild Hochhuths stand: Antisemitismus in akademischen Kreisen?)
Wird jemand, der eine „Ehrenerklärung“ für einen Holocaustleugner abgibt, gar mit diesem befreundet ist, also automatisch zum Antisemiten? Wenn man das Interview in der JF komplett gelesen hat, drängt sich einem dieser Eindruck nicht gerade auf: Hochhuth bekennt sich darin unter anderem zum Anhänger der Kollektivschuldthese, bezeichnet den Eintritt Grossbritanniens in den 2. Weltkrieg als „humane Großtat der europäischen Geschichte“ und Churchill als einzige Jahrtausendgestalt unter den Staatsmännern des sich so nennenden „christlichen Abendlandes“. Jörg Friedrichs „Der Brand“ bezeichnet Hochhuth als wertlos, weil es sich nur einem einzigen Aspekt widmet – allein dem Bombenkrieg – aber zu tausend andere Aspekte des Krieges keine Beziehung herstellt. Und nicht zuletzt stellte er fest: Ich habe noch nie einen Deutschen getroffen, der, wenn er zu Recht über die Verbrennung Dresden klagt, auch den Namen des „benachbarten“ Dörfchens Auschwitz nennt. Es ist eine Schande, daß wir noch immer nicht anerkennen: Die Weltgeschichte kennt kein mit unserem Holocaust vergleichbares Verbrechen.
Wenig überraschend wurden Äußerungen dieser Art (anfangs) kaum thematisiert – ein Skandal lebt schliesslich von der Verkürzung und Verknappung, differenzierte Betrachtungen waren also rar gesät. Der unlängst verstorbene Ralph Giordano (jetzt ist er wieder zusammen mit Wolfgang Leonhard, mit dem ich ihn oft verwechselte) bildete eine rühmliche Ausnahme: Während er in einem offenen Brief Hochhuths Äußerungen noch als eine der größten Enttäuschungen der letzten 60 Jahre bezeichnete, revidierte er nach Lektüre des Interviews und nach Hochhuths Eingeständnis, die Äußerungen zu Irving seien idiotisch gewesen, seine Meinung:
Noch einmal also, und noch drastischer: Hochhuth hat mit seiner deplazierten Philippika für den britischen Schmutzfink Mist gebaut. Aber diese Verdammnis, dieses Feuer auf seinem Haupt – das hat der Mann nun wirklich nicht verdient. Man kann die political correctness auch übertreiben. Gibt es doch eine Art des Nachtretens, die nicht den Getretenen, sondern den Treter charakterisiert. Muss berechtigte Forderung nach Entschuldigung denn in Demutszwang ausarten? Er hat gebüßt, und da will ich ihn wissen lassen, dass seine Auschwitzgedichte mich tief angerührt haben, wie so manches noch in der Vita dieses streitbaren Zeitgenossen.
Doch halt: So einfach ist es auch wieder nicht. Hochhuth trifft in dem JF-Interview und in den darauf folgenden Wortmeldungen Aussagen, die sich teilweise widersprechen, vor allem was den Kontakt zu Irving betrifft. Und wiederholt eine Behauptung, die er schon 1978 gegenüber Golo Mann äußerte, die von Irving stets abgestritten wurde und die nicht gerade für ein reflektiertes Verhältnis zum Antisemitismus steht: Der Brite hätte eine jüdische Mutter und sei deshalb als „Halbjude“ zu seinem Judenhass gekommen (vgl. Der Bund, s.o. und hier).
Gemein ist den meisten Presseberichten anlässlich des JF-Interviews Hochhuths die Frage, warum sich jemand wie Hochhuth mit einem Antisemiten und Holocaustleugner anfreunden kann. Auch bei der Besprechung von „Soldaten“ anlässlich der englischen Wiederaufführung vierzig Jahre nach der Premiere in London heisst es: Trouble was, these were in a Swiss bank vault and couldn’t be opened for 50 years. And the only historian who supported Hochhuth was David Irving, an admirer of Hitler and a Holocaust denier.
Als sich die beiden 1965 kennen lernten, war Irving noch kein Holocaustleugner. Er kam 1959 in die BRD, um sein Deutsch zu verbessern und bei Thyssen zu arbeiten. Anfang der 1960er Jahre nahm ihn Werner Höfer für eine Serie („So starben Deutschlands Städte“) in der Neuen Illustrierten unter Vertrag – aus der 37-teiligen Serie entstand schliesslich das Dresden-Buch. Wie schon erwähnt galt es lange als Referenzwerk zum Thema, auch Vonnegut (der den Angriff im Schlachthauskeller ja selbst miterlebte) zitierte in „Schlachthof 5“ Irving und dessen (später als falsch identifizierte) Opferzahl von 135.000 Toten.
Der Bombenkrieg war wohl auch Thema des Stern-Gesprächs im Januar 1965, als sich Hochhuth und Irving das erste Mal trafen. Hochhuth kannte den „Untergang Dresdens“ und konnte einige Anregungen für „Soldaten“ daraus gewinnen. Wenn es später so gut wie durchgehend (von Martin Broszat anno 1977 bis zur Wikipedia) heisst, Hochhuth wäre den Thesen Irvings zur Sikorski-Ermordung aufgesessen (1967 unter dem Namen „Accident“ veröffentlicht), dann ist trotzdem das Gegenteil der Fall: Die Idee kam von Hochhuth.
Scheinbar freundeten die beiden sich schnell an, arbeiteten jedenfalls recht zügig zusammen an den Recherchen zu „Soldaten“. Irving entdeckte beispielsweise im Kalender des Gouverneurs von Gibraltar, MacFarlane, eine Notiz, die darauf hindeutete, dass der britische Geheimdienstoffizier Sweet-Escott am Tag des Absturzes (4. Juli) in Gibraltar weilte. Dieser stritt das ab (er machte sich seiner Biografie zufolge am 3. Juli von England aus auf den Weg nach Algiers, wo er am 5. Juli ankam…), Irving warnte aber nach eigener Aussage Hochhuth davor, diesen Namen zu nennen. Dieser schlug die Warnung jedoch in den Wind und veröffentlichte eine entsprechende Passage auch in dem Spiegel-Beitrag, was prompt zu einer Klage und Verurteilung des Spiegel führte. Später wurde die Kalendereintragung als „Swear Carrara“ gedeutet.
Vielleicht empfand Hochhuth eine Art freundschaftliche Treuepflicht gegenüber Irving, der sich – nicht ganz unbegründet – seit seiner Assoziierung mit dem Dramatiker und der gemeinsamen Sikorski-Arbeit in Grossbritannien einer Kampagne des Establishments ausgesetzt sah. So verfügte der Sunday Telegraph 1969 in einem Redaktions-Memo, dass Irving nicht mehr wie bisher als Historiker, sondern als Autor zu bezeichnen sei.
Irving behauptet weiter, dass der schon erwähnte Carlos Thompson direkt von den Churchills, namentlich dem Sohn Randolph, auf ihn und Hochhuth angesetzt wurde, Ergebnis sei das 1969 erschienene Buch The Assassination of Winston Churchill. Thompson war, neben Irving, Kenneth Tynan und dem Piloten Prchal auch zu einer Fernsehsendung im Dezember 1968 eingeladen – die englische Presse war zur Zeit der Londoner Premiere verständlicherweise sehr interessiert an dem Thema. Der Gastgeber der Sendung, David Frost, sollte es später mit seinen Nixon-Interviews sogar auf die Kinoleinwand schaffen.
Die Sendung selbst sah Irving als Teil der Verschwörung gegen ihn und Hochhuth, Hauptgegner blieb aber weiter Thompson. Angeblich entschuldigte sich seine Frau, Lili Palmer, persönlich bei Hochhuth für dessen Verhalten. Er trat über zehn Jahre später, 1981, wieder in Kontakt mit Irving und Hochhuth, bzw. dessen Mutter, der er angeblich erzählte, dass ihr Sohn ein von der SED bezahlter Agent sei. Irving berichtet auch, dass ein ähnlicher Verdacht zur Zeit der „Soldaten“-Premiere und der Turbulenzen darum im Lager ihrer Gegner auftauchte: Moskau steckte hinter dem Stück und würde den beiden finanzielle Unterstützung leisten.
Interessanterweise „enthüllte“ 2007 der dreissig Jahre zuvor in die USA geflohene rumänische Securitate-General Pacepa, dass Hochhuths „Stellvertreter“ Teil einer Geheimdienstaktion namens Seat 12 war, gesteuert aus Moskau und gerichtet gegen den Vatikan. Hochhuth stritt dies in einem Spiegel-Gespräch natürlich ab: Warum hätten die östlichen Geheimdienste ihre Papiere einem jungen Mann in Gütersloh zustecken sollen, der noch nie zuvor ein Wort publiziert hatte? Das ist absurd. (Absurd, sagt er. Stimmt nicht sagt er nicht…). Sowohl Irving als auch – deutlich drastischer – Thompson berichten von Hochhuths genereller Furcht vor der Verfolgung durch Geheimdienste.
Wenn Irving behauptet, er hätte den Historikerstreit ausgelöst, dann ist das natürlich maßlos übertrieben. Dennoch spielte er darin eine Rolle – er trat generell bis in die 1980er Jahre sehr oft in der deutschen Öffentlichkeit in Erscheinung, wenn es um die Zeit des Nationalsozialismus ging. Mindestens bis 1977, bis zur Veröffentlichung von „Hitlers War“ galt er als halbwegs seriöser Historiker, der ein Händchen dafür hat, Menschen aus dem engsten Kreis der NS-Führung zum Reden zu bringen. Dabei spielte Irving schon sehr früh – als Verfasser profaschistischer „satirischer“ Texte seiner College-Zeitung – mit dem Feuer (sein Bruder meinte, Irving treibe allein die Lust an der Provokation).
Aufgrund der These, Hitler hätte mindestens ein Jahr lang nichts von der industriellen Vernichtung der Juden im Osten gewusst, da Himmler diese hinter seinem Rücken vorantrieb und es keine schriftlichen Zeugnisse aus Hitlers Hand dazu gäbe, kam es zum Bruch mit seinem deutschen Verleger Ullstein. Martin Broszat widmete Irvings Thesen 1977 einen ganzen Aufsatz in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte (Vierteljahreshefte 4/77: Hitler und die Genesis der Endlösung. Aus Anlass der Thesen von David Irving) – verfemt und nicht ernstgenommen sieht anders aus.
Als der Stern 1983 auf einer Pressekonferenz seine Hitler-Tagebücher präsentierte, war Irving als Abgesandter der Bild vor Ort. Er kannte die Sammlung, aus der sie stammten und verkündete lautstark, dass es sich um Fälschungen handelt. Das war sein Element: Etablierten Historikern ihr eigenes Versagen vorwerfen, sie der Ungenauigkeit und handwerklicher Fehler zu überführen. Allerdings änderte Irving seine Meinung zu den Hitler-Tagebüchern, vielleicht auch, weil sie seine Thesen stützten. So kam es zu dem Bonmot eines Reporters, der auf Irving Aussage, er wäre der erste gewesen, der die Tagebücher für eine Fälschung hielt, entgegnete: Ja, aber auch der letzte, der sie für echt hielt!
Der nächste Absturz kam Mitte der 80er Jahre, als Irving Gerhard Freys Einladung annahm, vor dessen DVU-Publikum Vorträge über Rommel zu halten, obwohl ihn sein Verleger Albrecht Knaus eindringlich davor gewarnt hatte. Doch noch 1985 wollte der spätere Kulturstaatsminister und damalige Rowohlt-Chef Naumann unbedingt Irvings Churchill-Biografie verlegen. Endgültig auf dem Tiefpunkt jeglichen Niveaus angekommen war er schliesslich, als er 1989 den Leuchter-Report in Großbritannien herausgab und mit einem Vorwort versah. Trotzdem setzten sich 1996, als Irvings Goebbels-Biografie wegen verschiedener Boykottaufrufe vom Verlag zurückgezogen wurde, Intellektuelle wie Noam Chomsky oder Pierre Vidal-Naquet für ihn ein. Irving besiegelte sein Schicksal schliesslich selbst, indem er Ende der 1990er eine Verleumdungsklage gegen Deborah Lipstadt und ihren Verlag Penguin Books anstrengte – sie bezeichnete ihn als einen der Hauptprotagonisten der Holocaustleugner-Szene. Der Sachverständige Richard Evans wies ihm unzählige absichtsvolle Fälschungen nach und bereitete seinen Bericht zu einem eindrucksvollen Buch (Lying About Hitler: History, Holocaust, And The David Irving Trial) auf, für die FAZ berichtete Eva Menasse ausführlich vom Prozess. Ihre Beobachtungen sind im Buch „Der Holocaust vor Gericht – Der Prozeß um David Irving“ zusammengefasst.
Während sich, bei aller Kritik, lange Zeit die Meinung hielt, Irving wäre zumindest ein guter Quellenarbeiter (er hat, das sollte nicht vergessen werden, viele seiner Unterlagen anderen Forschern zugänglich gemacht, einiges davon lagert – jetzt für ihn unerreichbar – als Schenkung im Münchener Institut für Zeitgeschichte oder im Bundesarchiv), stellte Evans ein vernichtendes Urteil aus:
Irving is essentially an ideologue who uses history for his own political purposes; he is not primarily concerned with discovering and interpreting what happened in the past, he is concerned merely to give a selective and tendentious account of it in order to further his own ideological ends in the present. The true historian’s primary concern, however, is with the past. That is why, in the end, Irving is not a historian.
Bis zu Irvings Einreiseverbot in die Bundesrepublik 1993 unterhielten er und Hochhuth regen Kontakt. Irving begleitete die Hochhuths zur Berliner Soldaten-Premiere und besuchte auch die englischsprachige Uraufführung in Kanada. Hochhuth nahm Irving mit zu Jaspers, dieser revanchierte sich und lud den Dramatiker zu Treffen mit Arno Breker oder einer der Sekretärinnen Hitlers ein. Der Brite berichtet, wie er auf Initiative Hochhuths für die deutsche Penthouse-Ausgabe ein Interview mit Edward Teller führte.
Ohne Zweifel waren Hochhuth die verqueren Ansichten seines Freundes bekannt. Golo Mann machte ihm dies immer wieder zum Vorwurf, schliesslich war die Freundschaft zu Irving einer der Gründe, warum der Kontakt zwischen Mann und Hochhuth abbrach (neben Manns Rechtsrutsch, der Filbinger verteidigte und Diwald positiv besprach. Vgl. der Bund, s.o.). Hochhuth führte Mann gegenüber aus, wie oft er öffentlich Irvings Thesen widersprochen habe, Freunde seien sie trotzdem: nur ich nehme ihn in diesem Punkt nicht ernst und sage ihm das ins Gesicht und öffentlich.
Es ist möglich, wenn auch schwer vorstellbar, mit einem Holocaustleugner befreundet zu sein, ohne selbst einer zu werden. Nur weil man bestimmten Medien Interviews gibt, macht man sich noch nicht deren Ideologie zu eigen. Es ist aber nicht klug – the medium is the message – und man gerät in Gefahr, zum Steigbügelhalter solcher Ideologien zu werden.
Die fünfzig Jahre sind für Hochhuths Schweizer Banktresor so gut wie abgelaufen – allerdings hat er diesen scheinbar schon vorzeitig aufgelöst. Von dem englischen Gentleman war jetzt keine Rede mehr, dafür aber von der Ehefrau des Hochhuth’schen Verlegers: Jane Ledig-Rowohlt soll im Zweiten Weltkrieg für den britischen Geheimdienst tätig gewesen sein und äußerte gegenüber Hochhuth: Es ist hundertprozentig sicher, ich kenne jemanden sehr gut, der persönlich deswegen zu Churchill musste. Churchill war furchtbar niedergeschlagen, aber er habe keine Wahl. Seine Aussage, dass in fünfzig Jahren keiner mehr daran zweifeln wird, daß Sikorski von Whitehall ermordet werden mußte, hat sich nicht bewahrheitet, der Absturz gilt weiterhin als nicht aufgeklärt, trotz neuer Untersuchungen der Polnischen Behörden (die bei ihren Ermittlungen auch Hochhuth befragten). Zuletzt machte eine arte-Dokumentation aus dem Jahr 2011 zum Thema von sich reden, ansonsten herrscht Schweigen.
Den Bogen schliessend zu dem Müller-Jebsen-Interview und der aktuellen Querfront-Thematik (zu der an vielen Stellen schon viel geschrieben steht) kann gesagt werden, dass Hochhuth dieses Interview nicht gerade genützt hat. Sichtlich in Panik sprach er in seiner ersten längeren Einlassung im Rahmen des Skandals in der Weltwoche von einer „geistigen Existenztilgung“: Obwohl ich öffentlich bekannte, dass ich mich für meine senilen Irving-Äusserungen schäme, reiht man mich als Antisemit ein. Eine regelrechte Treibjagd! Die Junge Freiheit dagegen ist inzwischen etabliert und selbst in den Pressedienst des Bundestags aufgenommen – keine Rede mehr davon, sie vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen, die Schmuddelkinder sind längst sowas von angekommen, während Hochhuth merk- und merkwürdiger wird.
Der größte Teil der Recherchen zu diesem Text beruht noch auf meinem Projekt aus dem Jahr 2005, ich habe versucht, die neuen Nachforschungen nicht zu sehr ausufern zu lassen. Es hat nicht ganz geklappt, welch Überraschung. Doch andererseits: Zum Glück! Die letzten Buchstaben waren eigentlich schon getippt, da kam ich plötzlich auf den Gedanken, doch mal – zum krönenden Abschluss und Ausklang dieses Kapitels – auf Youtube ein wenig nach Hochhuth zu stöbern. (Sola scriptura, eine altbekannte Historikerkrankheit.)
Und siehe da: Dort findet sich der zitierte Hochhuth-Kongress in Weimar in aller Ausführlichkeit, diverse Interviews und Fernsehauftritte und – ein Compact-Podium von 2011, bei dem Hochhuth stolz und ausführlich von Elsässer präsentiert vorgeführt wird (und das Trauerspiel dreht sich – natürlich! – um Churchill und Hitler und Elser…und natürlich lässt es sich Elsässer nicht nehmen, ihn auf Irving anzusprechen – das JF-Interview ist längst nicht so platt wie dieses – und natürlich windet sich Hochhuth, lobt viel, redet sich um Kopf und Kragen, sagt aber auch zu Irvings 77er Hitler-Buch als Zäsur: Dann ist ihm das zugestossen, was der Stefan Zweig in seiner Biografie Die Welt von gestern beschrieben hat, was mir mit Churchill passiert ist (!) – man kann nicht umhin, sich in seinen Helden zu verlieben. ).
Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich den ganzen Spass vielleicht gleich ganz gelassen. In diesem Sinne lässt sich die fatale (und hoffentlich überspitzte) Frage stellen, wie viele Jahre vergehen werden, bis die Nachdenkseiten auf dem zwischentag vertreten seien werden. Trotzdem: Hochhuth ist weiterhin relevant; es gibt wirklich weitaus Schlimmeres und Belangloseres zu lesen. (Ich nehm mir jetzt Wessis in Weimar vor – aus aktuellem Anlass, könnte man fast meinen.) Und auch trotzdem gilt, was Eva Menasse schrieb: Rolf Hochhuth ist ein alter, aufgeregter, wirrköpfiger und unbesonnener Mann. Der aus der Vergangenheit kommt und sich in der Gegenwart scheinbar nicht mehr zurecht findet. Mal sehen, was die Zukunft bringt.
[a] Alle Zitate aus „Soldaten“ nach der Rowohlt-Erstauflage von 1967 (So auch jenes ganz am Anfang des Textes, S.104). Das Zitat an dieser Stelle stammt aus dem Interview, siehe unten, 2.Akt.
[b] Das fragliche Interview verlinke ich hier nicht direkt, wer es an der Quelle lesen will, das lässt sich sehr leicht finden. Es gibt allerdings auch eine Spiegelung auf indymedia 😉
[c] Alle Äußerungen D. Irvings, wenn nicht anders vermerkt, sind seiner umfangreichen Homepage entnommen, die hier nicht verlinkt wird. Sie lässt sich nicht ganz so leicht mit einer Suchmaschine finden, aber in Liechtenstein gibt es ja auch Google.
[Nein, das ist nicht mein längster Blogtext. Er hat aber ziemlich lange gebraucht, zugegeben, und einiges musste im Zuge dessen auf der Strecke bleiben. Was mit der Linksammlung passiert ist? Würde mich wundern, wenn die in diesem Jahr noch kommt…]
[Über den 2005er Recherchen fand ich ein Textfragment, das ich hier einfach mal in Rohform ans Ende setze. Passt irgendwie immer noch:
der autor zog den stecker seines laptops heraus, packte alles ordnungsgemäß in die tasche und verschwand für das nächste halbe jahr ans andere ende der welt. dorthin, wo er sich sicher sein konnte, keine informationen mehr zu bekommen.
er las sich all das durch, was er im zuge seiner hochhuth-irving-chomsky -recherche gesammelt hatte. er las es sich durch und schrieb ein buch darüber.
nachdem er all die fakten abgehandelt hatte, nachdem ihm all die widersprüchlichkeiten auffielen, kam er zu dem schluss, dass er in einer vollkommen illusionierten welt lebte. er berief sich auf robert capa, die tanger-connection und hunter thompson. er gab als parole aus, die wirklichkeit zu verachten.
in seinem nächsten bahnbrechenden erfolg legte er die grundlagen der diktatur der statistik dar, unterhaltsam beschrieben anhand der durch 5041 personen diktierten tv-einschaltquote.
seitdem wird behauptet, er säße irgendwo in einer irrenanstalt. er selbst verkündete in einem abschiedsbrief, er sei on the road to]
„Sich nur mit einfachen Leuten zu umgeben, das ist ja auch ganz schön einfach.“ sagte ich, als der Mitbewohner sein Augenbrauenrunzeln wegen der Paranoia der Nachbarin über das gesamte Gesicht verteilte. Sie sah in jedem vor der Tür parkenden Auto einen Schnüffler der Hauseigentümer, abgehört werden wir auch, natürlich.
„Versteh ich nicht.“ Meinte der Mitbewohner. Ich erklärte ihm, dass die gute Frau zweifelsohne einen Knall hat, also beileibe nicht einfach sei, ganz im Gegenteil, aber doch trotzdem unsere Unterstützung verdient. Klar, ein paar Wahnvorstellungen, wortreich ausgeschmückt und gepaart mit dem naiven Rassismus der geborenen Kreuzbergerin mit italienischem Vater, das alles in einem Redefluss, der gerade tosend einen Felsabgrund herunterstürzt – das kann einen durchaus sprachlos machen, nicht nur, weil man eh nie zum Zuge kommt. Aber es kann auch eine Herausforderung sein: Den Rassismus bloßzustellen und zu dekonstruieren, auf eine Erkenntnis hoffend; ähnlich vergeblich wie die Verschwörungstheorien und Privatsendernews zu entkräften.
Hat man nur Leute um sich, die nicht den geringsten Widerspruch in einem auslösen, dann entgehen einem all die Möglichkeiten, andere und sich selbst zu hinterfragen. Erklärungen zu finden und zu liefern. Vor Augen geführt zu bekommen, was in manchen Köpfen so für Gedanken rumschwirren, bei denen man annahm, dass auf soetwas ja wohl wirklich niemand reinfallen könnte.
Sicher, die Geduld reicht nicht immer aus, und jeden Tag das Gleiche zum gleichen Thema erzählt zu bekommen, hat mich in letzter Zeit sowieso dünnhäutig und missmutig werden lassen. Vor allem, da ihr Konterpart aus dem Stock drüber ebenfalls täglich zum gleichen Thema vorspricht. Viel elaborierter, mit grundsolidem intellektuellen Fundament, etwas zu selbstgefällig vorgetragen und angestrengt schlau daherkommend, aber eben genau so ausführlich wie die Paranoia-Verdächtigungen.
Sie wissen, glaube ich, wie sie es zu nehmen haben, wenn ich mich wie kürzlich dem ewiggleichen Thema verweigerte, deutlich sagte, dass es mich anwidert, vor allem, da nichts passiert, da nur spekuliert wird. Sie nahm es auch nicht krumm, dass ich vor Monaten nur knapp meinte „Vergiss das ganz schnell, das ist Schwachsinn, wirklich. Glaub mir.“ Damals wurde noch über dies und das gesprochen, in besagtem Fall, so machte es den Eindruck, hatte sie gerade Galileo geschaut und ist dabei irgendwie auf den Chemtrail-Trichter gekommen. Immerhin erst vor ein paar Monaten.
Also: Sich immer nur mit einfachen Menschen zu umgeben, das wäre doch zu einfach, oder? Oder liegt es daran, dass sie bei ihren beinahe täglichen Besuchen die besten Grastüten weit und breit mitbringt?
22.05.03
Auf einem wilden Baulücken-Parkplatz, glücklich
überhaupt noch solch einen gefunden zu haben,
heute morgen, früh raus, viel zu tun.
Geldeintreiben, keine große Sache.
Parkplätze sind hier selten.
Und teuer.
Vielleicht war es ja auch ein Baugrundstück mit insolventem Investor.
Bürotürme sehen ähnlich scheisse aus wie ein Fünfzig-Auto-Haufen.
Sand-matschig, Pfützen, ein freier Platz, nicht ohne Grund.
Ein kleiner See.
Eine Riesenpfütze.
Mir egal,
ich hatte offene Rechnungen zu begleichen.
Und Gummistiefel im Kofferraum.
Beim Aussteigen, im Augenwinkel, ein verwirrter Blick.
Optische Täuschung,
kennt man ja.
Am Nebenauto. Erst: Wohl ein Spassgesellschafts-Spass.
Dann genauer. Zwischen Motorhaube und Kotflügel,
direkt vorne an der Ecke bei der Scheibe.
In diesem winzigen Spalt. Klemmte ein Fuß
–
kopfüber dran die Amsel.
05.05.14
Ach was, von wegen friedliche Zeiten:
Dummes Zeug von Menschen, die es besser wissen müssten.
Beschwören ihr Europa, hat ja so viel Frieden gebracht
und garantiert.
Als ich ankam in diesem Europa,
rüstete es sich gerade zum Einmarsch
zusammen mit dem großen Bruder
Leader of the free world
um die Wiege der Zivilisation
platt zu machen.
Aber das war ja weit weg.
Und trotzdem gingen wir auf die Strasse
statt in die Kasernen.
Ein paar Jahre Ruhe
und Ernüchterung später
tobten die Gräuel dort
wo ich als Kind glaubte,
das Paradies auf Erden
gefunden zu haben.
Jetzt rückten einige von uns
in die Kasernen ein: zivilisiert –haha!-
in ordentlichen Uniformen.
Arbeitsplatz sicher bis zum Tod,
Karrierechancen immerhin,
sowas wächst in der Provinz
nicht auf den Bäumen.
Andere zogen eher verwegen,
verschlagen und verblendet
in die Schlacht,
als Handlanger und Handschar
der jeweiligen Nationalisten.
Eine bahnbrechende Wahl später
eröffneten dann die regierenden Friedensaktivisten
– wer waren denn die Guten, wenn nicht sie! –
drei Ecken weiter das nächste Gemetzel.
Begründung: Auschwitz.
Für einen weiteren Krieg reichte der Atem noch:
Wegen der Solidarität, wir waren jetzt schliesslich
alle Amerikaner.
Der nächste wurde dann aber ausgelassen,
wegen der Wahlen, und ausserdem
waren wir da doch schon mal.
Seitdem ist die Lage unübersichtlich,
erst wurde mit implodierenden Banken geschossen,
die in Europas Süden verwüstete Schlachtfelder hinterliessen.
Doch nun endlich wird auch wieder Platz gemacht
in den Munitionsdepots der Militärs,
um dem Russen zu zeigen,
was so eine richtige Harke ist.
Mitten im ach so friedlichen Europa.
Derweil gibt es immer mehr von denen,
die den Krieg erlebt, gesehen, erkannt.
Zurückgekehrt mit einer neuen Diagnose
für den alten Wahnsinn, dem man verfällt,
der einen schüttelt, für Jahre die Sprache
oder den Verstand raubt.
Weil das Töten so leicht und distanziert geworden ist,
wird es Zeit, dass denen,
die begeistert in den Krieg ziehen
oder andere hineintreiben
dieser Krieg entgegenkommt
und sie mal in ihren eigenen vier Wänden
besucht.
Seit Wochen rollen die Panzer
nun mitten durch Europa,
oder brennen aus, weil zu allem
Überfluss da genügend Leute
mit Panzerfäusten rumlaufen.
Seit fünfzig Jahren Garant
für Frieden und Sicherheit
my ass!
20.08.04
Letztens fiel mir auf,
dass ich schon lange
nicht mehr versucht habe,
meinen großen Zeh
in den Mund zu stecken.
Schade eigentlich.
Ich hab ihn letztens in der U-Bahn getroffen, als bei der U6 dieser blöde Pendelverkehr war und man vom Mehringdamm bis Tempelhof dreimal umsteigen musste und ne halbe Stunde gebraucht hat. Der sah ganz schön verpeilt aus und schien gar nicht klarzukommen. Meinte, er wäre schon zweimal in die falsche Richtung gefahren. Kifft wahrscheinlich immer noch zu viel. Hat erzählt, seine Frau hätte ihn sitzengelassen und er ist jetzt wieder in Berlin.
So ungefähr könnte C. es ihnen erzählen, es wäre ihm nicht zu verübeln. Ich war an diesem Tag wirklich schlecht drauf. Wieso also sollte ich das machen, in die alte Heimat fahren? Dort wohnt niemand mehr, der mir wichtig wäre. Oder andersrum. Eher. Und eben, C. meinte, O. würde jetzt wieder dort wohnen, im alten Haus der Eltern. Nur der Landschaft und des Meeres wegen zieht es mich nicht dort hin, da mag es noch so viel Sommer sein, das reicht nicht, das zieht nicht.
Heimat? Ich habe den Verdacht, es geht eher darum, in überzuckerten Erinnerungen zu schwelgen und zu recht verflossenen Gelegenheiten noch eine Chance geben zu wollen. Zeitverschwendung. Um die andere Heimat kümmerst du dich ja auch nicht, sagt das Teufelchen auf der rechten Schulter, eigentlich kümmerst du dich doch um so etwas nie, für gewöhnlich. Und die ist schliesslich um die Ecke, die andere Heimat, da könnte man mit dem Rad hinfahren. Was du ja auch mal gemacht hast, als noch jemand dort wohnte, im Familienstammsitz. Mal ganz abgesehen davon, dass da auch einige Gräber schon jahrelang auf deinen Besuch warten. Aber eben keine Verflossenen, deswegen denkst du da auch nicht mal ansatzweise drüber nach.
Das unverhofft auftauchende Boateng-Wandbild (Ach hier war das!) unterbrach dann zum Glück diese Gedankenspiele und setzte neue in Gang. Die WM war gerade mal einen Monat vorbei, besoffen von dem Titel war längst keiner mehr. Mit einer so schnellen Ernüchterung hätte ich nicht gerechnet, dieser unspektakulär schnelle Übergang zum Tagesgeschäft überraschte mich. Sollte es wirklich noch fünf Monate Ruhe geben, bis die ganzen ‘Schland-Idioten in den Jahresrückblicken wieder ins Bild dürfen?
Über das Boateng-Mural freue ich mich immer wieder, nicht nur, weil ich nie genau weiss, wo es ist und daher jedes Mal aufs Neue überrascht bin. Sondern auch, weil ich dabei immer leise skeptisch denke, das sind wirklich unsere Jungs, die kennen das dreckige, das Guten Morgen Berlin, du kannst so schön hässlich sein-Berlin. Und dass wenigstens einer von ihnen Weltmeister geworden ist, freut mich wirklich. Ebenso wie der Gedanke daran, dass er in 30, 40 Jahren als älterer Herr, mit kleinem Bierbauch vielleicht, ganz selbstverständlich im Aktuellen Sportstudio aus dem Nähkästchen der Erinnerung plaudern wird. Mit viel Glück werden die Zuschauer dann ungläubig den Kopf schütteln und sich denken: Bananen auf das Spielfeld geworfen? Wirklich?! Wie dumm ist das denn?!
Mein Großvater war schon tot, als ich mit dem Schreiben anfing. Und doch war er der Grund dafür. Ich weiss das noch so genau, weil es frühmorgens war. Ich schlich aus dem Haus, bevor Großmutter wenig später den Hof betrat, um die Hühner und Karnickel zu füttern. Das war vorher seine Aufgabe.
Vor dem Haus stand eine Haselnuss, die mir knapp zwei Jahrzehnte später eine veritable Allergie bescheren sollte. Gleich neben der Schaukel und dem Sandkasten, der eigentlich ein großer, alter Traktorreifen war. Dort stießen wir, wenn wir tief genug gruben, immer mal wieder auf verwitterte Nazimünzen. Was Großvater als kriegserfahrenen Kommunisten jedes Mal aufregte, wenn er fand, was wir vor ihm verstecken wollten. Von seinen Funden auf diesem Grund und Boden hat er uns zeitlebens nichts erzählt: Wir waren wohl noch zu jung für die Geschichten über Pistolen und Dolche mit eingravierten Hakenkreuzen, die er nach dem Hauskauf entdeckte, gar nicht mal so gut versteckt. Natürlich wurde er in dieser Angelegenheit sofort auf der Kreisleitung vorstellig und bereinigte sie.
Noch vor Sonnenaufgang wollte ich auf der Astgabel des Haselnussbaums sein, meinem Lieblingsplatz. Von hier aus hatte man den besten Überblick über die Umgebung: Die Wiese vor dem Haus, links davon die Gemüsebeete, dahinter die Heuwiese. Die durften wir Kinder nicht betreten, dafür war sie bunt gefärbt von den vielen Blüten, bis Großmutter mit Sense und Sichel das Grünfutter erntete. Geradezu, hinter der Hecke und den Obstbäumen, führte der Weg an den Schuppen vorbei zur Garage und zur Werkstatt, bis er an den Ställen und vor dem Hühnerhof endete. Selbst die kleine Laube ganz hinten an der Grenze zum Uhrmacher-Nachbarn war von hier aus über die Kirschbäume hinweg gut zu erkennen. Rechts von dem Weg bildete eine Reihe Blumenbeete die Begrenzung zum anderen Nachbargrundstück, das so gross und auch ein wenig hügelig war, dass man das Haus nicht mal von meinem Ausguck aus sehen konnte.
Ich hatte einen Bleistift dabei und eines der grobfaserigen blassgrünen Schulhefte, blau liniert. Und konnte es gar nicht erwarten, dass die Natur im Gleichklang mit der Sonne aufwachte, was ich dann sogleich protokollieren würde, genau so, wie ich es in meinem damaligen Lieblingsbuch gelesen hatte. Dessen Titel habe ich längst vergessen, die meisten Tier- und Pflanzennamen, die ich damals aus dem Effeff beherrschte und zuordnen konnte, ebenfalls. Doch ich weiss noch, dass das der Moment war, in dem ich anfing, zu schreiben. Weil ich Bücher liebte, und Geschichten. Und die besten davon erzählte mein Großvater, einige schrieb er sogar für uns Enkel auf: Erst handschriftlich auf Briefpapier, dann tippte er sie mit der Erika-Schreibmaschine ab. In ihnen hörte ich zum ersten Mal von den Möwen und dem Meer, an dem ich bald darauf wohnen würde. Eine Zeit lang – die Seemannsgeschichten waren wohl schuld – dachte ich, mit den Schreibmaschinen sei das wie mit den Schiffen, was die Namensgebung betraf: Meine Großmutter hiess Erika, also benannte mein Großvater seine Schreibmaschine dementsprechend.
Er war also schuld daran, dass ich anfing, zu schreiben. Obwohl ich doch wegen ihm eigentlich Oberförster im Lieschenpark werden wollte. Trotz des Namens handelt es sich hier durchaus um einen Wald, in dem sich sogar ein kleiner Angelteich befindet. Als Revier für einen Oberförster wäre er aber wohl wirklich etwas klein gewesen. Ich weiss nicht viel von meinem Großvater, das wenigste davon aus seinem Mund: Er war der Sohn eines Melkers, geriet bei El Alamein glücklich in amerikanische Kriegsgefangenschaft (Huntsville, Texas) studierte Agrarwissenschaften, war LPG-Vorsitzender und starb, als ich sechs Jahre alt war. Mir ist er jedoch hauptsächlich als Geschichtenerzähler in Erinnerung, und viele seiner Geschichten spielten in den Wäldern um uns herum, in denen er als Jäger unterwegs war und wo er die unglaublichsten Sachen erlebte.
So hatte er sich beispielsweise einmal verlaufen, nach einigem Umherirren stieß er auf eine kleine Brücke, von der aus der Waldweg direkt zu einer Hütte führte, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um das Haus des Weihnachtsmanns. Als wir Kinder leise Zweifel daran hegten, dass der nun ausgerechnet bei uns um die Ecke wohnen würde, nahm er uns eines Tages – wie so oft, aber doch viel zu selten – mit, um uns die Hütte zu zeigen. Es war leider Sommer, und der Weihnachtsmann samt Helfern im Urlaub. So las er es vor, von dem Schild, das in dem verstaubten Fenster der Hütte hing. Unsere Zweifel waren zerstreut, schliesslich standen wir vor der Hütte und konnten die Botschaft des Weihnachtsmanns mit eigenen Augen sehen, auch wenn wir noch nicht lesen konnten. Ich liebte diese Geschichten, liebte es, mich durch die Wälder und über Wiesen und Felder treiben zu lassen und die Tiere zu beobachten: Oberförster also, keine Frage.
Doch dann fing ich an diesem einen Morgen mit dem Schreiben an und habe bis heute nicht damit aufhören können. Vorher stieg ich allerdings nochmal von meinem Lieblingsplatz in der Astgabel des Haselnussbaums herunter und ging in den grünen Schuppen, den Futterschuppen. Von hier aus ließ Großvater ein paar Jahre zuvor einen selbstgebastelten Osterhasen an einer Seilwinde zum Hühnerhof laufen, er hatte sogar eine Weidenkiepe auf dem Rücken, wenn ich mich recht erinnere. Wir Kinder bestaunten dieses Schauspiel mit verschlafenen Augen vom Küchenfenster aus. Unser Großvater kannte also nicht nur den Weihnachtsmann persönlich, sondern sorgte auch dafür, dass wir die einzigen waren, die im Kindergarten stolz berichten konnten, den Osterhasen tatsächlich bei der Arbeit beobachtet zu haben.
Meine Großmutter kippte gerade das Futter für die Hühner und die Karnickel zusammen. Ich half ihr immer wieder gerne beim morgendlichen Füttern, es war eine meiner liebsten Tätigkeiten im Haushalt: Die frische klare Luft um diese Zeit, besonders im Winter, noch unschuldig vom Dreck des Tages. Die gerade erwachende Sonne und die Ruhe, selbst die Hühner schliefen manchmal noch und mussten von uns erst geweckt werden. Meine Aufgabe war es, trockenes Brot mit Wasser und Getreide zu vermanschen und danach die gelegten Eier einzusammeln. „Weisst du noch, der Osterhase….?“ Fragte ich Großmutter, während wir vom Stall zurück Richtung Haus gingen. „Ist schon gut, mein Junge.“ Sagte sie. Ich kletterte zurück auf die Astgabel und schrieb eine Geschichte über den Eisvogel, der in den riesigen Birken des Nachbargrundstücks wohnte.
Seit zwei Stunden saß er inzwischen auf gepackten Koffern. Und alle fünfzehn Minuten dachte er, dass das ja wohl totaler Quatsch wäre, nur wegen ein paar Heuschrecken.
„Das Heu kannst du weglassen“ hat Paul gesagt, „das sind Stabschrecken, so indische. Die haben es da wohl nicht so mit Heu.“
Er würde doch nie wieder hier in der Gegend was finden, jedenfalls nichts, was er sich leisten könnte. Und was sollte er erzählen, wenn ihn jemand fragt? Eine letzte Möglichkeit gab es noch, aber er hegte keine großen Hoffnungen, als er die Nummer aus dem Branchenbuch ins Telefon tippte. Reine Formsache, es sollte keiner sagen können, er hätte nicht alles versucht.
Nur ein paar Brombeerzweige und ein paar Wochen, mehr kostete es nicht, meinte Paul, als sie zusammen das riesige Terrarium die Treppen hochwuchteten. Die Zweige müssten allerdings regelmässig ausgetauscht werden und alle paar Tage sollte man mal ein bisschen Wasser zerstäuben. Kein Thema, eigentlich.
„Das heisst die bewegen sich so gut wie nie?“ fragte er, „Nichts als schlafen, fressen, ficken?“ Paul lachte nur: „Von wegen, nicht mal das! Das sind alles Mädels. Klone. Die gibt es seit 17 Jahren, die haben schon auf der ersten Fusion getanzt. Also, ihre DNA jedenfalls.“
Sie bestückten das Terrarium großzügig mit den erstaunlich stacheligen Zweigen und gestatten sich nach getaner Arbeit ein gut gefülltes Pfeifchen. Er fand, dass diese Viecher und ihr beschaulich eingerichtetes Gehege etwas ungemein Beruhigendes hatten, auch wenn sie sich inzwischen – es war längst dunkel geworden draussen – für seinen Geschmack doch fast etwas zu schnell bewegten. „Und vergiß nicht“ meinte Paul, „das sind Insekten. Da kann ruhig mal was kaputt gehen, ich hab die jetzt nicht nachgezählt. Also, keine Sorge! Und Tommi soll sich so viele rausnehmen, wie er will.“
Tommi war sein Teilzeit-Mitbewohner und als solcher den größten Teil der Zeit nicht da. Bei seinem letzten Besuch in der Stadt fand er die Schrecken so toll, dass ihm Paul jetzt ein paar zum Geburtstag schenken wollte, samt eines weiteren, etwas kleinerem Terrariums.
„Eigentlich kann er auch das Riesenteil mitnehmen, ich hab zu Hause eh noch ein anderes Grosses. Und du packst die, die übrig bleiben, in das Kleine…“ Er konnte es Paul nicht verdenken, dass dieser den schweren Glaskasten nicht noch einmal all die Treppen hoch- und runtertragen wollte. „Mir egal“ antwortete er und begann, das Fitzelchen Hasch in seine letzten Brösel aufzulösen.
Nachdem alles aufgeraucht war, brachte ihm Paul die Umsiedlung – bzw. das Umsetzen, wie er belehrt wurde – bei. Einige der Viecher waren schon ziemlich groß, und ihre Beine ganz schön widerborstig, oder besser -hakig. Mit etwas Übung klappte es jedoch ganz gut, zur Not half man mit einem kräftigen Pusten nach, um die Tiere von der Kleidung zu bekommen. Er sah eigentlich ein paar unkomplizierten Wochen entgegen.
***
„Boah, sind die garstig!“ Tommi weigerte sich beharrlich, auch nur eine Nacht mit den Monstern alleine in einem Zimmer zu verbringen. Er legte mit den Drogen gerade eine Pause ein und begann, sich wieder an seine Träume zu erinnern. Und hatte Angst vor den Ängsten in ihnen, da passten die Schrecken nicht gut rein. Soviel dazu.
Was bei Pauls weisen Ratschlägen zur Insektenhaltung nicht zur Sprache kam, war, dass sich die Viecher häuten. Kann man sich denken, sicher, aber als er eines Morgens das erste Mal eine abgestreifte Schrecken-Hülle fand, geriet er leicht in Panik. Denn nachhaltig, wie die Natur nun mal ist, knabberten die Tiere ihre abgelegte Haut gern auf. Er befürchtete natürlich sofort, die Schrecken wären dem Kannibalismus anheimgefallen.
In den folgenden zwei Wochen pendelte sich alles einigermassen ein: Er kannte inzwischen sämtliche Brombeer-Reviere in der näheren Umgebung und war erstaunt, wie viele grüne Blätter noch an den Pflanzen waren, obwohl sich der Winter schon dem Ende zuneigte. Noch erstaunter war er allerdings, als die ersten warmen Frühlingssonnenstrahlen das wahre Potential der Brombeeren entfalteten; selbst abgeschnitten im Wassereimer auf dem Balkon trieben die Zweige aus, was das Zeug hielt. Ungefähr zu dieser Zeit bemerkte er auch erstmals die Veränderungen an den Schrecken: Nach und nach färbten sie sich rot.
Zuerst stellte er noch die Klon-Theorie in Frage und vermutete, dass sich vielleicht doch ein Männchen eingeschlichen hätte, oder geschlüpft war. Dann kam er aber relativ schnell auf die Möglichkeit einer Mutation. Überhaupt schienen sich die Insekten ziemlich wohl zu fühlen, oder es lag am Frühling, jedenfalls wurden sie mehr und mehr. „Die schmeissen ihre Eier einfach ab, keine Ahnung, wie viele da rumliegen.“ Mehr war aus Paul zu diesem Thema nicht herauszukriegen. Die Zweige boten längst nicht mehr genügend Platz, so dass die Schrecken jetzt hauptsächlich aufeinander sassen. Und bei dieser Gelegenheit liessen sie es sich nicht nehmen, sich gegenseitig die Beine abzufressen. Jetzt war er da, der Kannibalismus. Das Terrarium war eindeutig zu eng geworden.
Die Roten schienen sich dabei am besten zu schlagen, irgendwann waren sie in der Überzahl. Ab da wurde auch das Tauschen der Zweige und des Wassers ungleich komplizierter: Nicht nur, dass die Tiere generell viel zu viele waren inzwischen, sondern sie schienen auch aktiver und fluchtwilliger zu werden. Die graubraunen Schrecken, die er vor zwölf Wochen bekommen hatte, wackelten auf ihren dünnen Beinchen ein paar Mal vor und zurück, bevor sie überhaupt einen Schritt machten. Von den Roten entwischten ihm immer ein oder zwei Exemplare, sobald er nur den Deckel anhob. Und obwohl es in der einschlägigen Literatur hiess, dass Temperaturen deutlich unter 18 Grad Celsius tödlich wären, sah er den einen oder anderen Ausreisser noch Tage später auf dem nachts weiter winterlich kalten Balkon.
Da Tommi sehr deutlich gemacht hatte, dass er keinerlei Wert auf sein Geburtstagsgeschenk legte und Paul auf der Mailbox die Nachricht hinterlassen hatte, dass sich seine Rückkehr erheblich verzögern würde, musste er sich langsam was einfallen lassen, um der Überbevölkerung Herr zu werden. Zwischenzeitlich hatte er sämtliche verfügbaren Informationen geprüft, aber einen Fall wie seinen nirgends auch nur annähernd beschrieben gefunden. Viele andere interessante Fakten, das ja, aber nichts zu der Verfärbung. Könnte am Futter liegen, war die generelle Vermutung. Doch mit dem flammenden Rot und einer spontanen Mutation konnte niemand etwas anfangen. Allerdings waren die meisten seiner Gesprächspartner auch eher Reptilienzüchter und weniger am Leben der Schrecken interessiert als an ihrem Nährwert.
Er müsste sie umsetzen, soviel war klar. Gerade, als er dabei war, das kleinere Terrarium zu präparieren – die Brombeeren sprossen nur so, überall, und er wunderte sich noch, warum ihm die unzähligen Büsche in seiner unmittelbaren Umgebung bisher entgangen waren – hörte er die Stimme zum ersten Mal: „Du bist ein guter Mensch. Du solltest besser gehen.“
„Da wär ich mir nicht so sicher.“ Murmelte er, bevor sich ihm die Frage stellen konnte, wo diese Stimme auf einmal herkam. Er entfernte das Tuch vom großen Glaskasten, keine einzige Schrecke bewegte sich. Das war schon komisch, da sie in der letzten Zeit ja immer so flink unterwegs waren, aber auch darauf achtete er nicht weiter. Die Frage nach dem Modus der Aufteilung beanspruchte in diesem Moment seine ganze Aufmerksamkeit, er hatte darüber vorher gar nicht nachgedacht: Groß und klein zusammen, bunt gemischt? Oder nach Alter und Größe sortieren? Einfach das nehmen, was ihm zuerst unter die Finger kam? Und wie viele sollte er überhaupt in das kleine Terrarium packen, um nicht in ein paar Tagen wieder den Kannibalismus das natürliche Gleichgewicht herstellen lassen zu müssen? Er müsste sich schnell entscheiden, bevor die Hälfte der Viecher von alleine wer weiss wohin auswandert, überlegte er noch. Doch dann bemerkte er die Ruhe, die Bewegungslosigkeit, die komplette Erstarrung jedes einzelnen Tieres. Ungewöhnlich, dachte er, was ist denn jetzt schon wieder los?
„Geh!“
***
Der Kammerjäger war anfangs etwas ratlos, dann griff er zum Telefon.
„Ja, Kurt, icke. Hier, hörmal, bin grad in der Weser 13, komische Sache, dit. Deine Frau arbeitet doch inner Klappse, oder? Sach ma, jibt dit da so ‘ne Art Notruf? Oder soll ick da den normalen Krankenwagen rufen?“
…
„Ja, nee, Folgendet: Der Typ sitzt hier direkt neben mir, dit is dem vollkommen ejal, allet. Aber is eben ooch nich agressiv oder verwirrt uff den ersten Blick, deswejen dachte ick, da wär’n paar Spezijalisten jebraucht, vastehste? Wenn dem so erstma nüscht fehlt, nimmt den doch keener mit, dacht ick mir. Polizei, meenste?“
…
„Jut, danke dir, dit is jut, der Rudi, klar. Da wär ick jar nich drauf jekommen. Dachte, der wär längst in Rente. Ick meene, wie soll der den bitteschön die Türkenbengels jagen mit sein kaputtet Knie und den zweieinhalb Zentnern? Naja, soll mir ejal sein, wa. Sach ihm, er soll sich beeilen. Tschö.“
„Es ist gut, dass Sie die Polizei gerufen haben. Hoffe ich.“ Er schaute den Kammerjäger traurig an. „So wird es wenigstens aktenkundig, wissen Sie? Aber Sie müssen schon zugeben, dass sich diese Tiere seltsam verhalten, oder?“
Dem Kammerjäger war deutlich anzumerken, dass er in diesem Moment lieber woanders wäre. Schaben, Ratten, Motten, das waren seine Gegner. Mit verwirrten Menschen, die friedlich in ihrem Gehege hockende Heuschrecken für eine Bedrohung hielten, konnte er dagegen nicht viel anfangen. „Müssen muss ick jarnüscht, damit dit schon mal klar is. Und wo wa schon ma dabei sind: Ooch wenn ick jetzt hier nüscht ausrichten kann, die Anfahrt muss bezahlt wern, sonst reisst mir meen Chef den Kopp ab.“
„Herr König, nehme ich an?“ Der Polizist nahm seine Mütze ab und streckte die Hand aus, er machte einen netten, offenen Eindruck. Etwas ausser Atem, aber nett.
„Nein, Caesar. Aber das ist jetzt nicht so wichtig…“ Nach einem kurzen Händedruck fingerte der Beamte Block und Stift aus der Jackentasche. „Für mich ist erst mal alles wichtig, leider. Also Cäsar, so wie der aus Rom, ja?“
„Genau der.“ antwortete er. Der Kammerjäger hustete kurz auf, kratzte sich am Kopf und hielt dem Polizisten die Hand hin: „Rudi, ick bin wech, wenn dit ok is. Is ja wohl nich mehr meen Metier hier…“
„Sicher. Also, Herr Cäsar, was genau ist hier das Problem?“
„Wissen Sie, wie man den Hunger in der Welt bekämpfen kann?“ Er schaute dem Polizisten in die fragenden Augen, erwartete aber keine Antwort. „Insekten! Stabschrecken, insbesondere. Reines Protein. Es gibt erstaunliche Studien, der Energiebedarf, die Kosten für die Erzeugung von einem Kilo Rind und einem Kilo Stabschrecken verglichen, das ist ein Riesenunterschied!“
„Das mag ja sein, aber ich glaube nicht, dass uns das hier weiterbringt, Herr Cäsar. Und ich möchte mir auch ungern einen Teller voller Insekten auf dem Mittagstisch vorstellen…“
„Uns wird gar nichts anderes übrigbleiben, über kurz oder lang.“ Unterbrach er den Beamten. „Das Dumme ist nur, die Schrecken wissen das jetzt auch, und ich bin schuld. Ich wollte das alles nicht…
Immerhin haben sie mich gewarnt. Sie organisieren sich. Sie haben ein kollektives Bewusstsein aufgebaut. Sagt ihnen der Begriff Hive Mind etwas? Es sind verdammte mutierte Klone, und sie haben schon im ganzen Haus Eier gelegt, sie sind mir entwischt, das tote Treppenhaus ist bestimmt schon voll von ihnen. Am Besten, das ganze Haus wird komplett abgerissen, oder ausgeräuchert, was weiss ich. Vielleicht bringt das noch was. Wenn es schnell genug geht. Ansonsten werden sie uns mit ihrer schieren Masse erschlagen, das haben sie mir verraten. Sie sagten, ich solle weit weg von den großen Städten versuchen, zu überleben. Dort würden sie nämlich ihr leichtestes Spiel haben, nur ein wenig die Infrastruktur überlasten und die Menschen würden sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Verstehen sie jetzt, wie dringend es ist?!“
Der Polizist schien unbeeindruckt, steckte den Schreibblock wieder in die Tasche und öffnete den Knopf des Handschellentäschchens an seinem Gürtel. „Wir bringen Sie jetzt wirklich besser gleich zu Bonnies Ranch, Herr Cäsar, spart auch ‘ne Menge Papierkram, wenn‘s Recht ist. Gut, dass Sie ihre Tasche schon gepackt haben. Und um die Heuschrecken brauchen Sie sich keine Sorgen mehr machen, um die kümmern wir uns schon!“
„Es sind Stabschrecken, so indische. Werden Sie schon noch sehen.“ Sagte er matt und liess sich umstandslos mitnehmen. Vielleicht war er da draussen wirklich sicherer.
„So, jetzt bist du also zwei Jahre alt. Das ist ja für ein Hundeleben sozusagen volljährig. Wie fühlt man sich denn da so?“
„Ich hab Hunger.“
„Ach, du hast immer Hunger. Mach dir mal lieber ’nen Kopf um deine Zukunft. Kannst jetzt ja schließlich den Hundeführerschein machen. Und Alkohol trinken, Hundebier und so. Aber nicht zusammen. Nicht betrunken fahren, das ist doof!“
„Ich will gar nicht Auto fahren, ich habe Hunger. Außerdem kannst du mir ruhig weiter die Ohren kraulen.“
„So leicht geht das nicht. Und sowieso, du könntest ruhig mal für dein Futter selbst sorgen. Such dir doch einen Job! Als ich in deinem Alter war, da konnte ich mein Brot schon selbst bezahlen!“
„Mit zwei Jahren? Das glaube ich kaum. Ich habe übrigens immer noch Hunger, komm schon, wenigstens ein Leckerli!“
„Nein, mit zwanzig. Hör auf zu betteln, so etwas macht man nicht. Andere Hunde sind Filmstars und retten Leben, Bernhardiner zum Beispiel. Nimm dir mal an denen ein Beispiel!“
„Du willst also, dass ich tierisch haare und sabbere? Kannst du haben. Außerdem fressen Bernhardiner auch viel mehr. Und sie stinken!“
„Jetzt lenkst du vom Thema ab. Hier hast du eine Kaustange. Mal ehrlich, soll das die nächsten 10, 15 Jahre so weitergehen? Wozu waren wir denn bei der Hundeschule?!“
„Ich wollte da nicht hin! Mich hat ja keiner gefragt. Mich fragt ja sowieso nie jemand! Es heißt immer nur sitz, platz, pfui. Und ich finde es nett, dass du schon festlegst, wann ich zu sterben habe. Wieder werde ich nicht gefragt.“
„Nun sei nicht gleich wieder eingeschnappt. Ich weiss, dass du super gut beleidigt tun kannst. Geh doch zum Fernsehen!“
„Jetzt lenkst du aber vom Thema ab! Hast du dir denn auch schon Gedanken darüber gemacht, was du dir für einen Hund nach meinem Tod anschaffst, he? Einen Bernhardiner vielleicht?! Mit denen kannst du so was machen, die sind nicht nur fett, sondern auch blöd!“
„Entschuldige bitte vielmals, Sauertopfgesicht! Aber im Ernst, meinst du nicht das könnte dir Spaß machen? Da triffst du dann auch andere Hunde, mit denen du spielen kannst.“
„Ey weißt du wie mich das nervt?! Immer soll ich mit anderen Hunden spielen. Ich will meine Ruhe haben und den ganzen Tag pennen, verstehst du?! Und weißt du was, Hunde können gar nicht sprechen. Du solltest dir mal `nen Kopf machen, und zwar über deinen Drogenkonsum. Und jetzt lass mich in Ruhe!“
(März 2002)
06.07.14
Im Wald unterwegs.
Ein Bier mitgenommen
& aufgemacht:
Die Hitze!
In der inzwischen pubertären
Kiefernschonung
mich dann die ganze Zeit gewundert
was das für seltsame Tiergeräusche sind:
Vögel eher nicht, es summt mehr,
als es zwitschert.
Vielleicht ein Moskitoschwarm,
oder andere komische Insekten,
man weiss ja nie, heutzutage.
Es flog nur nichts,
schon gar nicht im Zusammenhang
mit den Geräuschen,
die mich konstant begleiteten.
Bevor ich kirre wurde,
wollte ich dem auf den Grund gehen;
vorher aber noch
ein kräftiger Schluck.
Und siehe da, der schiefe Kronkorken
war schuld:
Er ließ ein paar Schaumbläschen durch,
die ihre Freiheit besangen,
ehe sie zerplatzten.
Da sonst gerade wenig Neues hier passiert, wenigstens ein paar Hinweise auf andere interessante Texte. Derzeit geht es mir mal wieder ähnlich wie Claudia Klinger – die Welt um mich herum ist mir unbegreiflich. Da will ich nichts mit zu tun haben, egal ob es jetzt „das Netz“ ist oder Berlin, was da schlechte Laune macht. Und ich frage mich mit zunehmender Frequenz, was mich davon abhält, den Daumen in den Wind zu halten, das Netz Netz sein zu lassen und mir irgendwo eine Hütte im Wald zu suchen. Wäre wahrscheinlich auch für mein Schreibfluss viel besser, der stockt nämlich gerade wie ein fauliger Tümpel.
Vielleicht liegt es am Wetter, vielleicht an mir. Obwohl: Das Wetter ist eigentlich ganz gut, keine Beschwerden soweit. Doch bevor das, was in drei Koffer passt, gepackt wird, bleiben wir noch kurz in Berlin. Ich durfte ja am Rande ein wenig daran teilhaben, wie die Frau Wiaaasching jr. gerade ihren Berlin-Nichtliebesroman auf die Beine stellt; eine weitere fiktive Liebesgeschichte aus Berlin, die aber wirklich so passiert ist, schildert Andreas Bock im Dummy Magazin. Klingt verwirrend, ist aber so.
Doch wohin? Weit, weit weg, nach Japan etwa, über das Leopold Feldmaier immer wieder so schön schreibt? Oder doch nur nach Dänemark, wo ich schon unzählige Male war, aber jetzt schon länger nicht mehr, vor allem nicht in dessen Hauptstadt, die einen neuen Stadtteil übergeholfen bekommen hat? Oder nach Atlanta, wo mit grauer Farbe gegen Gentrifizierungevents gekämpft wird?
Wenn jedoch eigentlich die Weltflucht immer die Flucht vor einem Selbst ist, dann kann ich auch gleich in Berlin bleiben. Hier erzählt das Leben immerhin auch ziemlich harte Geschichten. Und wenn man Glück hat, so wie die hochgeschätzte tikerscherk, dann verlängert einem die flächendeckende Gesundheitsversorgung dieser Stadt das Leben ein wenig. Es kann aber auch passieren, dass sich auf den Krankenhausfluren einfach nur die Tage ins Unendliche ziehen. Und im allerschlimmsten Fall laufen hier tagelang Menschen an einem toten Kleinkind vorbei, ohne auch nur die Nase ob des Geruchs zu rümpfen.
Ja, starker Tobak, das alles. Und bevor es besser wird, noch ein Blick in die Klassenzimmer, mithin in die Zukunft. Wenn einen nicht ständig die eigenen Gedanken nerven würden, könnte man sich jahreszeitenadäquat unter eine dicke Decke legen, lesen oder fernsehen. Hab ich aber schon: Breaking Bad in drei Wochen, begeistert. Den letzten Herrndorf, zwei Tage, nicht so begeistert (Gut, nicht großartig. Obwohl es großartige Stellen gibt, wie den Anfang beispielsweise.).
Was bleibt, ist die Einsicht, dass die Hölle in uns selbst liegt – idealerweise verpackt in wunderbar berührende Worte, wie asallime das tut. Und drei gute Texte mit Bildern: Im Falle von disputnik mit einer wunderbaren Photographie, bei der wolkenbeobachterin und Kennedy Calling sogar mit aufschlussreichen bewegten Bildern.
Und mit einem Video will auch ich diesen Beitrag hier beenden. Zu meinem Erstaunen konnte der Mitbewohner nichts mit The Streets anfangen (Er ist eigentlich der Hip-Hop-Fan von uns beiden). Aber er hatte eine gute Antwort: Kennst du Sleaford Mods, fragte er mich. Kannte ich nicht. Ein Erlebnis seien die, der eine Typ meckert die ganze Zeit, der andere sitzt daneben und drückt ein paar Knöpfe. Und beide scheinen ein veritables Drogenproblem zu haben. Recht hatte er, mit allem. Und als wäre das noch nicht genug, spielte mein Lieblingsbarmann in meiner Stammkneipe letztens die komplette Platte durch, purer Zufall.
Bonustrack: Der Kiezneurotiker feiert sein Zweijähriges. Klar, wissen alle längst, Gratulation und so weiter. Kurz vor dem Jubiläum hat er sich durch die Hintertür meiner Kommentarspalte hier als Gastblogger eingeschlichen und gibt ein Roadmovie – betrunken zu Fuß durch den Prenzlauer Berg, auf der verzweifelten Suche nach Jacky Cola – zum Besten.
24.02.04
Der Hubschrauber sah gefährlich aus. Gefährlich, weil aus den beiden Seiten riesige Geschütze ragten, gefährlich, weil in den offenen Seitentüren jeweils zwei gepanzerte Soldaten saßen und gefährlich, weil er nur ungefähr 50 Meter über dem Boden schwebte und einen dumpfen Höllenlärm machte.
Die Bäume, die die Straße säumten, bogen ihre Kronen vom Wind weg, und die Fenster in der Einfamilienhaussiedlung vibrierten. Sie klirrten nicht und sie sprangen nicht, nie. Es gab immer nur ein mattes Vibrieren.
„Papa! PAPA!!“
„Ja mein Sohn, was ist?“
„Du sagst mir immer bloß, dass ich mich ans Fenster stellen soll und winken.“
„Genau das solltest du jetzt auch tun, mein Sohn.“
„Aber du sagst mir nie, warum!“
„Doch mein Sohn, ich habe es dir schon tausendmal gesagt: Du sollst winken, damit sie sehen, dass es dir gut geht. Die guten Soldaten passen auf, dass die Kinder alle wohlauf sind, sie beschützen euch.“
„Aber Papa, was ist, wenn der Hubschrauber einmal nicht mehr kommt? Wird es uns dann schlecht gehen?“
„Das wird nie passieren, mein Sohn. Oder hast du schon eine Nacht erlebt, in der sie nicht nachgeschaut haben, ob du in Ordnung bist?“
„Nein Papa.“
„Na also, und jetzt geh schlafen.“
Er wusste beim besten Willen nicht, wie er es seinem Sohn anders erklären sollte. Vor fünf Jahren, ein Jahr nach seiner Geburt, fing es an. Seitdem flog der Armeehubschrauber jeden einzelnen Abend Patrouille in dieser Strasse, immer zwischen zehn und elf Uhr.
Niemand, der hier wohnte, hatte das auch nur mal am Rande erwähnt. Keiner regte sich darüber auf, nicht ein Anwohner dieser Strasse beschwerte sich in irgendeiner Form über die allnächtliche Militärpräsenz. Es wurde als alltägliches Ereignis hingenommen, so wie die morgendliche Tour des Zeitungsjungen. Da wäre er der letzte, der seinem Sohn irgendwelche Flausen in den Kopf setzten würde. Kinder haben schließlich genug Probleme, mit denen sie fertig werden müssen, da sollten sie sich nicht zusätzlich dumme Gedanken um einen blöden Hubschrauber machen müssen, über den sowieso nicht gesprochen wird.
Wie immer, wenn der Lärm abgeklungen und das Kind zugedeckt war, öffnete er eine Flasche Wein. Wie immer, seitdem er alleine war, würde er für zwei trinken, mindestens. Und wie immer überlegte er, sich einen anderen Job zu suchen. Jeden Abend die gleichen Gedanken, jede Nacht der gleiche Absturz und jeden Morgen die gleiche Resignation, auf dem Weg vom Kindergarten ins Büro: Er würde hier nicht rauskommen. Sein Sohn vielleicht, aber er nicht.
Am Kanal hängen Zettel, eine Wohnung wird angeboten: Knappe 150 Quadratmeter, knappe 1.500 Euro Miete. So weit, so schlecht. Doch wer sich das leisten kann und will: Es gibt noch einen kleinen Haken, Abstand genannt. Läppische 95.000 Euro. Was sagt uns das?
Eine andere Botschaft hängt in Köpenick, diesmal hatte ich wenigstens das Mobiltelefon dabei und konnte sie mehr schlecht als recht fotografieren. Dort wurde am Wochenende das Bürgerbüro des NPD-Europaabgeordneten Voigt eröffnet. Vorher gab es für das Haus, in dem auch die Parteizentrale residiert, noch einen neuen Anstrich und ein neues Klingelschild. Auch zwei Häuser weiter wird an der Fassade gearbeitet:
Die Nähe des Gerüstbauobjekts zur Parteizentrale ist bestimmt nur geographisch und ansonsten rein zufällig. Und die Antifaspinner bauschen das wahrscheinlich alles auf, um rechtschaffene, hart arbeitende deutsche Männer zu verunglimpfen. Ostdeutsche, da legen die glaube ich wert drauf, während sie auf ihren Mopeds durch die Gegend fahren und unpolitischen Rechtsrock hören.
Bei der Gelegenheit fand ich – als Antwort, sozusagen – noch ein weiteres Bild auf dem Mobiltelefon. Von jemanden, der auch ganz schön scheisse gesungen hat.
Und wo wir schon mal bei Musik mit Aussage sind, bitteschön:
Mehr habe ich derzeit nicht zu sagen.
07.12.04
die bei den massenveranstaltungen von einst
freigelassenen friedenstauben fristen
nunmehr ihrem dasein dreckiggrau
mit halbverkrüppelten füßen
unter hochbahnbahnbögen.
Vom Heimatdichter aus dem wendischen Nachbardorf meiner Kindheit habe ich früh gelernt, empfindlich uff die Wörter zu sein. Später waren es dann Klemperer, Orwell und zuletzt die Tagebücher Friedrich Kellners: Immer wieder zeigte sich, wie manipulativ Sprache verwendet werden kann. Und wird.
Der 17. Oktober 1989 war in dieser Hinsicht ein historischer Tag. Der denkwürdige 40. Republikgeburtstag (mit Gorbi im Palast und dem Volk davor) war gerade erst zehn Tage her – doch es sollte der letzte gewesen sein, nicht umsonst wurde der Tag der Deutschen Einheit bewusst auf ein Datum vor dem 7. Oktober 1990 gelegt. Das eigentliche bedeutende Ereignis dieses Tages – und das ist ebenso bemerkenswert – spielt in der kollektiven Erinnerung allerdings kaum noch eine Rolle: Das Zentralkomitee der SED trat zu seiner 9. Tagung zusammen und Erich Honecker zurück. Dass er beim Vortrag seiner Rücktrittserklärung zum Schluss seinen Namen mit vorliest, spricht allein schon Bände.
Anschliessend wird Egon Krenz zum Nachfolger Honeckers gewählt und hält sein 59-minütiges Antrittsreferat mit dem Titel Aktuelle politische Lage und Aufgaben der Partei*:
Wir schöpfen unsere Zuversicht aus dem unbestreitbaren gesellschaftlichen Fortschritt, den unser Volk und die Völker der Bruderländer – bei allem, was noch zu vollbringen ist – in historisch kurzer Zeitspanne errungen haben. Dieses Wissen und das Geschaffene geben uns die unerschütterliche Gewißheit, auch den Herausforderungen des kommenden Jahrzehnts gewachsen zu sein.
Die erste Voraussetzung dafür ist (allerdings) eine reale Einschätzung der Lage. Fest steht, wir haben in den vergangenen Monaten die gesellschaftliche Entwicklung in unserem Lande in ihrem Wesen nicht real genug eingeschätzt und nicht rechtzeitig die richtigen Schlußfolgerungen gezogen. Mit dem heutigen Tag werden wir eine Wende einleiten, werden wir vor allem die politische und ideologische Offensive wiedererlangen.
Wäre es aufgefallen, wenn ich es nicht gefettet hätte? Genau da kommt er her, der Begriff Wende. Unglücklich gewählt für die spätere Verwendung, aber in dieser Unglücklichkeit und dem Scheitern, sowohl des Krenz’schen Vorhabens als auch der Sache insgesamt, eigentlich die perfekte Wahl. Ich versuche trotzdem, das Wort so gut es geht zu vermeiden. Denn es stellt sich – wahrscheinlich nicht einmal (immer) mit Absicht, sondern weil es so bequem im Mund liegt – vor die viel passendere Revolution. Die wird ja meist noch mit einem erklärenden Zusatz versehen, und bis man friedliche Revolution gesagt hat, ist der Schalter für die Bahnsteigkarten längst geschlossen.
Während man also Wende sagt, summt es dazu im Kopf zur Blumfeld-Melodie Lass uns nicht von Revolution reden, ich weiss gar nicht, wie das gehen soll… Doch noch ein weiterer Grund spricht gegen diesen Begriff, und das ist die Tradition vor Krenz: Die geistig-moralische Wende des Helmut Kohl. Nicht nur eine Parallele in der Wortwahl, sondern auch bei dem, was hinten rauskam: Ein Rohrkrepierer allererster Güte.
* Quellen/Dokumente:
– Bundesarchiv/BStU: Dokumente zur 9. Tagung des ZK der SED am 18. Oktober 1989, Büro Egon Krenz. (Für Komplettansicht auf die einzelnen Ausschnitte klicken)
– Bundesarchiv: Tonmitschnitt der 9. Tagung des ZK der SED (TonY 1/1463). Besonders interessant die verschiedenen Diskussionsbeiträge ab ca. 1h 10min, durch die klar wird, wie kritisch die Lage war
– dazu: Zeitprotokoll der einzelnen Punkte.
– 2+4 Chronik zum 18.10.1989: Aus den Krenz-Erinnerungen/Kohl empfängt Andreotti
– Tagesschau – Nachbericht am 19.10.1989
– Schabowski zu Honeckers Absetzung
(ot: Und ich hatte noch versprochen, die Geschichten aus dem alten Heimatdorf zu erzählen. Das würde ich gerne noch einlösen.)
Ich werde durch einen schmalen Spalt gezerrt. Das massive Stahltor – eines von so vielen in dieser Stadt, an denen man achtlos vorbeigeht und sich nie fragt, was sich wohl dahinter verbirgt – bewegte sich kurz davor wie von Geisterhand gesteuert um dreissig oder vierzig Zentimeter nach rechts, gerade breit genug, um nacheinander durch die Öffnung hindurchzuschlüpfen. Oder gestossen zu werden.
„Bitte kommen Sie mit, zur Klärung eines Sachverhalts!“ sagte die zierliche Frau, bevor sie mich am Arm packte und in eine kleine Nebenstrasse manövrierte, Richtung Stahltor, wie ich jetzt weiss. Berlin Mitte, es ist der 11. Oktober 2014, vielleicht halb elf abends, die Nacht liegt dunkel und nasskalt über der Stadt. Oder war es doch schon Wedding? Ich habe die Orientierung verloren, kein Wunder, so wie ich in den letzten Stunden durch die Stadt geirrt bin.
Schweigend gehen wir nebeneinander die Auffahrt hinunter. Meine Frage nach dem Wohin wurde mit einem spöttischen Lächeln ignoriert, also werde ich keine weiteren Kommunikationsversuche unternehmen, denke ich mir. Schweigen ist Gold. Das Tor schliesst sich hinter uns und die Frau lässt jetzt wenigstens meinen Arm los. Unten angekommen werden wir von einer weiteren Person empfangen: strenger Blick, der Griff nach meinem Rucksack. Wir befinden uns in einem Krematorium.
Wenige Augenblicke zuvor, als wir auf das sich öffnende Tor zusteuerten, brüllte noch jemand von der Strassenecke ein paar Meter weiter: „Was ist das denn für eine Scheisse, Verfassungschutz oder was? Fangt ihr die Leute jetzt schon von der Strasse weg oder wie?!“ Wohl eine der wenigen nicht kalkulierbaren Aktionen an diesem Abend, aber es machte nichts, es war nur ein einsamer Rufer. Ich hatte keine Zeit, mich umzudrehen, sein Gesicht zu erkennen oder einen Hilferuf abzusetzen. Ich war schon längst in den weissgekachelten Räumen.
Noch vor einer Stunde hatte ich Angst, meinen Kontakt zu verpassen. Ich wartete an der Tram-Schleife vor dem Jahn-Stadion auf einen Anruf, doch das Feuerwerk dort war so laut, dass ich fürchtete, das Klingeln des Telefons nicht zu hören. Nur wenige Minuten später war mir jedoch klar, dass Sie mich im Blick haben, ständig. „Warten Sie, bis der Mann in der schwarzen Jacke aufsteht, dann dürfen Sie weitergehen.“ sagte die Stimme am Telefon.
Es war nicht weit entfernt von einem relativ belebten Platz, als die kleine Frau meinen Oberarm ergriff. Irgendein türkisches Fest wurde dort gefeiert, Kinder standen in einem Kreis und tanzten, die Erwachsenen klatschten den Rhythmus dazu. Die Lichter der Spielotheken, Kneipen und Spätis beleuchteten die breite Strasseneinmündung; kein Zwielicht, nichts, wovor man Angst haben müsste, eigentlich. Ich war gerade dabei, das Vermissten-Plakat mit dem Antlitz von Murat Kurnaz, das an einem Stromverteilerkasten hing, etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, im Begriff, es abzureissen, auf der Suche nach einem Hinweis. Ich dachte, das wäre mein Auftrag gewesen. Dann der Griff, das Tor, der Spalt und die Kacheln.
Inzwischen sitze ich auf einem unbequemen Hocker in einem langen, schlauchigen Raum. Vor mir ein Schreibtisch, darauf ein Stapel Papier und eine Lampe, die mich blendet. In meinem Rücken wäscht sich die zierliche Frau gerade die Hände, dann raschelt etwas. Eine Tüte? Für meinen Kopf? Ich will mich nicht umdrehen, sondern mustere lieber so unauffällig wie möglich meine unmittelbare Umgebung.
So oft habe ich darüber gelesen, und immer wieder hiess es: Anna und Arthur halten das Maul. Nach allem, was ich an diesem Abend erlebt habe, scheint mir das auch die beste Lösung zu sein: Keine Spielchen spielen, kein Kräftemessen mit der älteren Frau, die mir, inzwischen auf dem viel bequemeren Stuhl auf der anderen Seite des Tisches sitzend, schweigend in die Augen starrt. Stattdessen versuche ich, das „Kein offenes Feuer“-Schild zu fixieren, das ein paar Zentimeter über ihrem Kopf an der Wand hinter ihr auf den weissen Kacheln klebt, möglichst unverkrampft. Was folgt, ist das grelle Licht. Und Schweigen: Ihres und meines.
Ich beginne, Kacheln zu zählen und Szenarien durchzuspielen. Auf dem Tisch liegt meine Akte, eine stumme Anklage, doch sie genügt vollkommen, bedarf keiner Worte. Ich bemerke, dass eines der Oberlichter in dem langen, schmalen Raum blank liegt, seine Verkleidung heruntergeklappt wurde. Die zwei Neonröhren, auf halbem Weg zwischen mir und dem Schreibtisch an der Decke hängend, scheinen selbst ausgeschaltet angriffslustig in meine Richtung zu zwinkern. Schräg hinter mir höre ich auf einmal Wasser tropfen.
***
Als ich mit dem Freund und Mitbewohner auf der Suche nach ein oder zwei OZ we miss you-Stickern für unseren Kreuzberger Kühlschrank durch Hamburgs Straßen lief, erzählte er mir von einer Idee für das folgende Wochenende: Sie würden beide nach Berlin kommen und es gäbe da ein Projekt von ihren Münchener Leuten, das ziemlich aufregend und spannend klang. Und das mich letztendlich auf den unbequemen Hocker in dem stillgelegten Krematorium gebracht hat.
Nachdem ich dort ungefähr 15 Minuten hin und herrutschte und mit den Händen rang (meine Variante des Vorhabens, keine Nervosität zu zeigen), hörte ich hinter mir die Tür klappen. „Okay, es ist vorbei. Du bist erlöst, S. ist schon hier und wartet nebenan auf dich, A. braucht noch eine dreiviertel Stunde, ungefähr.“ Die Stimme gehörte Christiane Mudra, und es war mein Schlusssatz in ihrem Überwachungsexperiment YoUturn.
Sie und ihr Team haben mich in den gut zwei Stunden davor quer durch Mitte und Wedding gelotst – eine von mehreren möglichen Routen, in meinem Fall auf den Spuren der deutsch-deutschen Teilung und ihrer Konsequenzen.
Anfangs glich es einer Schnitzeljagd: In Mauerspalten oder unter Weinranken galt es, verborgene Botschaften zu finden. Neben dem Hinweis auf das nächste Versteck befand sich auch immer eine Stasi-Akte, ein NSA-Dossier oder ein Vernehmungsprotokoll in den Unterlagen. Während man sich von Station zu Station vorarbeitete, dabei das Papier in der Hand, die Informationen überfliegend, kam immer mehr ein Gefühl von Gehetztsein auf. Dazu dann noch die Anrufe, die einen durch die Stadt dirigierten und Anweisungen gaben: „Spielen Sie jetzt Track 3 ab!“ Oder der erschütternde Brief einer Mutter, deren Sohn von der Stasi umgebracht wurde, weil die Eltern ausreisen wollten. Handgeschrieben, mit einer Blume auf dem Gedenkstein an der Bernauer Strasse abgelegt. Spätestens, als ich zögerte, ihn von dort wegzunehmen – das musste ja meine Botschaft sein – begann es, ernst zu werden; begann ich, mich darauf einzulassen.
Nach ungefähr einer halben Stunde war der Kloss im Hals verschwunden, der Druck auf der Brust konnte mit großen Schlucken aus der Augustiner-Flasche bekämpft werden (richtig verschwunden war er aber erst am nächsten Morgen). Bis die letzten „Zuschauer“ angekommen waren und wir die gelungene, von uns allen für großartig befundene Vorstellung feiern konnten, war noch etwas Zeit für die Dokumentation des Stückes: Aufgebaut neben dem improvisierten Verhörraum, stilgerecht dort untergebracht, wo man nun mal die Leichen im Keller hat – im Kühlraum des Krematoriums, gegenüber der Wand mit den Reihen quadratischer Türen, die allerdings alle verschlossen waren.
Später, in irgendeiner Weddinger Kneipe, wurde noch viel über das Stück, dessen Entstehung, die hunderten geführten Interviews und die verschiedenen Erfahrungen damit in München, Potsdam oder eben jetzt in Berlin geredet. Natürlich gab es dabei auch immer unverhofft komische Situationen, etwa, als die Akteure in einen Polizeiaufmarsch gerieten und das Ganze für Kulisse hielten. Oft waren die Erlebnisse aber erschreckend: Wie einfach man Menschen von der Bildfläche verschwinden lassen kann, am helllichten Tag. Wie wenig Einsicht es gibt – damals ja … aber jetzt doch nicht, nicht bei uns… Viel zu selten regt sich Widerstand.
Hoffnung? Nun ja, eine ganze Weile nach dem Ende des Stückes kamen wir nochmal auf meine „Verhaftung“ zu sprechen. Bis dahin hatte ich fest angenommen, der einsame Rufer gehörte zur Crew. War aber gar nicht so. Immerhin…
* Auf die Überschrift bin ich natürlich nicht von alleine gekommen….
Seit langer, langer Zeit war ich mal wieder im Kino. Früher passierte das ständig, dort war schliesslich der Arbeitsplatz der Beinaheangetrauten und in irgendeinem der Yorck-Kinos lief immer was Besseres als im Fernsehen. Da ich nun aber nicht mehr über die magische Freie-Eintritt-Karte verfüge, das Internetstreaming ganz vernünftig läuft und ich Unterhaltungsfilmen alleine nicht viel abgewinnen kann – im Gegensatz zu Serien – verzichtete ich seit mindestens zwei Jahren auf jeglichen Kinobesuch.
Es war auch eher ein Zufall – ein glücklicher, wie sich herausstellte (wie immer erst im Nachhinein, vorher ist man ja nie schlauer): Eine Freundin meldete sich spontan, und da ich sie in den letzten Wochen sträflich vernachlässigt hatte, suchte ich in den einschlägigen Programmen nach einer kulturellen Abendveranstaltung. In die engere Auswahl kam ein Konzert im Schokoladen oder … Moment, das klingt gut, da würde ich sogar alleine hingehen: Ein Dokumentarfilm zur Gentrifizierung, Premiere an diesem Abend im Moviemento.
Verdrängung hat viele Gesichter lautete der Titel, den Inhalt habe ich nur kurz überflogen; wo das Thema gerade Konjunktur hat, nehme ich besser alles dazu mit, bevor es in den Mottenkisten der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten verschwindet. Als ich am Telefon die Karten reservierte, fiel mir auf, dass ich noch nie im Moviemento war: Wir schafften es früher immer nur ins Yorck, zum Rollberg, Passage oder Babylon – oder eben in das tolle alte Kino in Charlottenburg, wo Madame arbeitete und Buck manchmal verknautscht aus seinem Büro lugte.
Vor dem Kino angekommen, das dank seiner Ecklage und trotz des Schildes leicht zu übersehen ist, versammelte sich ein Publikum vor der Tür (Raucher, klar), wie man es in Kreuzberg nicht anders erwartete: Unterschiedlichste Altersgruppen, aber durchgehend bunt und mal mehr, mal weniger aus dem Rahmen gefallen. Und durch die Maschen des sozialen Netzes auch, hier war ich Gleicher unter Gleichen. Passend dazu näherte sich vom Kotti her eine Ein-Mann-Demonstration, zuerst nur akustisch wahrzunehmen: Ein älterer Mann, ein Türke vielleicht, fuhr gemächlich auf seinem über und über mit Plakaten geschmückten Fahrrad den Kottbusser Damm entlang und hielt dabei ein Megafon Richtung Bürgersteig, aus dem von Band abgespielte Wortfetzen zu hören waren – der Verkehr auf der vierspurigen Strasse und die verstärkten Doppelauspuffrohre des örtlichen Macho-Nachwuchses liessen mich nur etwas von „Bleiberecht für alle Flüchtlinge“ verstehen.
Verglichen mit den anderen Gentrifizierungs-Dokumentationen ist diese schon speziell: Relativ schnell wird klar, dass es sich hier nicht um den üblichen, professionellen Reportage-Journalismus handelt. Die eigene Betroffenheit scheint sowohl Auslöser als auch Themenschwerpunkt zu sein, Verdrängung hat viele Gesichter wurde von einem Kollektiv geschaffen, von Menschen, die zwischen Ost und West, zwischen Kreuzberg und Friedrichshain wohnen – irgendwo in dem Zipfelchen Treptow, das längst aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist und jetzt von Baugruppen erobert wird.
Das ist eine zweite, angenehme Überraschung: Nicht der große Blick, der möglichst alle Aspekte darstellen will, sondern ein kleines Phänomen, welches auf den ersten Blick auch gar nicht problematisch scheint, wird hier thematisiert. Menschen, die früher vielleicht selbst mal Häuser besetzt haben, sich überwiegend als linksalternativ verstehen und verwundert zur Kenntnis nehmen müssen, jetzt auf einmal die Bösen sein zu sollen, wo sie doch selbst nur den steigenden Mieten, die sie sich in zehn Jahren in der Gegend nicht mehr leisten können werden, entgehen wollen. Deshalb suchen sie den Ausweg im Modell der Baugruppe – keine Hedgefonds, sondern kleinteilige Zusammenschlüsse privater Investoren, die sich ihre eigenen vier Wände bauen. Was kann denn daran schlimm sein, fragen sie und wahrscheinlich auch viele aus dem Publikum, die sich mit diesem Thema noch nicht näher beschäftigt haben.
Obwohl der Film klar Stellung bezieht, wird niemand über die Maßen vorgeführt oder blossgestellt und es werden eben auch solche Fragen zugelassen, jedoch nicht, ohne eine Antwort darauf zu geben: Zuerst einmal das auch von einigen Protagonisten der „Gegenseite“ schliesslich erkannte Eingeständnis, dass sie vom puren Egoismus getrieben sind, selbst nicht unter die Räder zu kommen und es in diesem Falle eben ein Kollateralschaden ist, wenn dies anderen passiert; Hauptsache Sicherheit, auch in zehn Jahren noch. Dabei gibt es auch andere, sozialere Möglichkeiten, wenn man schon neu bauen möchte: Genossenschaftliche Modelle oder das Mietshäusersyndikat bieten hier Alternativen abseits von Wohneigentum, genauso sicher und planbar, nur kann man in Zukunft halt keinen Reibach damit machen. Um nur ein Beispiel zu nennen.
Die Stärke des Films sind die Geschichten der Porträtierten, egal, welchem Lager sie angehören: Das Dilemma der Baugruppenmitglieder wird ebenso deutlich wie die Absurdität der Politik und die Ausweglosigkeit der betroffenen Anwohner – ob das nun der stille, trotz seiner Situation erstaunlich unverzweifelte Buchhändler ist oder die Berliner Pflanze Moni, Jahrgang ’56 und seitdem mit großer Klappe und großem Herz im Kiez unterwegs. Die in einem Nebensatz ganz dezent darauf hinweist, dass das, was jetzt gerade um sie herum passiert, beileibe nicht die erste Verdrängung ist: Man erinnere sich nur mal an die Umstellung der Ostmieten auf das Westniveau, kombiniert mit dem Verlust des Einkommens durch Arbeitslosigkeit wurden dadurch schon damals nicht wenige an den Rand der Stadt und der Gesellschaft gedrängt.
Es ist müßig, auf alle großartig gelungenen Szenen (die Schuhe des Baustadtrats!) einzugehen, und selbstverständlich hat auch dieser Film seine Schwächen (Ich glaube, das, was ich persönlich am Meisten zu kritisieren habe firmiert unter dem Begriff Sounddesign). Da sich das Filmkollektiv auf die eigene kleine Lebenswelt konzentrierte, fehlt auch die große Anklage: Die Systemfrage wird nicht gestellt. Wenn ich mich recht erinnere, taucht das Wort Kapitalismus nicht ein einziges Mal in dem Film auf – ein bisschen schade, denn solange mit Grund und Boden spekuliert werden darf und daraus teils astronomische Gewinne erwirtschaftet werden, führt kein Weg daran vorbei, dass wirklich jeder Schuld ist an der Gentrifizierung.
[nothing changed]
03.08.04
Du kannst dir jeden Tag
deine Meinung aus dem Leib brüllen,
Leserbriefe schreiben
und dich bei Call-Center-Sklaven
beschweren.
Du kannst Demonstrationen anmelden,
Kreuzchen machen
und Parteien gründen.
Doch was gut und böse
oder richtig und falsch
und vor allem zu tun ist,
entscheiden andere.
Zum Schluß
gewinnt immer noch der
mit der größten Knarre.
Nach etwas über einem Jahr und etwas über hundert Beiträgen ist es an der Zeit für ein paar Grundsätzlichkeiten, die über das About hinaus gehen, und die auch in die Leiste da oben wandern werden:
Ich schreibe, weil ich will. Was ich will. Es kam auch schon vor, dass ich für Geld geschrieben habe, aber das ist eine ganze Weile her & hat hier nichts zu suchen. Ich kann Geld nämlich eigentlich gar nicht leiden, ausser, um Bücher zu kaufen. Wir meiden uns, wo es nur geht. Was ich noch weniger leiden kann, sind Leute, die mit anderer Menschen Arbeit ihr Geld verdienen.
Sollte ich mir also Gedanken über eine Lizenz machen, obwohl ich allein die Idee an sich schon absurd finde? Mich wieder unwillig durch die etlichen Creative-Commons-Möglichkeiten klicken? Wieso nicht gleich eine WTFPL? Eben weil es Leute gibt, die sich nicht schämen, mit anderer Leute Arbeit ihr Geld zu verdienen. Deswegen ergänze ich die WTF-Lizenz: Rebloggt von mir aus, aber wer sich hier bedient, um damit Kohle zu machen, dem sollen die Haare büschelweise aus Nase und Ohren wachsen und in dessen Träumen soll fortan jede Nacht mit penetranter Stimme der aktuelle heftig&co-clickbait-Schund vorgelesen werden. Und nix anderes mehr, ein Leben lang. (Das ist als Vertragsgrundlage zu verstehen und zu erfüllen.)
Keine Ahnung, ehrlich, immer noch nicht. Ich schreibe hier ins Internet, nennt es, wie ihr wollt. Blog, Literatur, Tagebuch – da ist auch einiger Müll dabei, ganz sicher. Man lernt ja jeden Tag dazu.
Das mache ich einfach schon, so lange ich denken kann, das mit dem Schreiben. Als es dann irgendwann das Internet gab, eben auch da: Erst auf einer selbstgebastelten fortunecity-Seite, im letzten Jahrtausend noch, dann auf einem ganz passablen Literaturportal und einem nicht ganz so passablen Onlinemagazin, die es beide nicht mehr gibt, später irgendwann mit Erst- und Zweitblog und jetzt an dieser Stelle. Das Internet bietet großartige Möglichkeiten für Schreiber (Musiker, Zeichner, Filmer…), aber es ist nichts als ein Werkzeug: So wie die Druckerpresse und die Übertragung von Radiowellen (Nicht: Wie Verlage oder Rundfunksender).
Im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass hier gehäuft fiktive, halbwahre und halbgare Texte erscheinen; manche länger, manche kürzer, manche jünger, manche älter. Ganz selten reimen sie sich, dafür gibt es aber öfter mal Bilder. Eine Archivseite existiert noch nicht: Der Hobbykeller, die Werkstatt, ist traditionell unaufgeräumt. Wer aber unbedingt möchte, kann am Anfang anfangen – doch lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!
Namen sind Schall & Rauch, und überhaupt: Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk & irgendwas mit Ponyhof.
Wer ich bin, erfährt man ohnehin wahrscheinlich viel zu gut aus meinen Texten, ausserdem ist das jeden Moment ein anderer (wie der Fluss, in den man nicht zweimal steigen kann, jedenfalls nicht in denselben) – und im Zweifel kenne ich den gar nicht. Anders gesagt: Alles ist zusammengesetzt aus Fragmenten, auf die niemand den ganzen Blick haben kann, weil jeder Teil davon ist: Real life is fake life is real life. Es gab mal einen Namen für mein Alter Ego, den verkürzte ich dann, und jetzt isser gerade ganz weg. Vielleicht kommt er ja mal wieder, wer weiss das schon! Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich irgendwie hinter der Anonymität verstecken wollen würde, ich nehme mich einfach nur nicht ernst genug. Ansonsten:
Wer Troll ist, entscheide ich. Wie alles andere hier auch. Ein gepflegter und vor allem dem jeweiligen Thema angemessener Umgangston kann jedoch nicht schaden. Ich bin persönlich sowieso eher der höfliche (um nicht zu sagen: viel zu nette) Typ. Meistens.
Derzeit schalte ich Kommentare – wenn ich denn mag – samt und sonders per Hand frei, das kann also schon mal dauern. Genau wie eine Antwort von mir: Manchmal kann ich nicht antworten, manchmal will ich nicht, manchmal fällt mir einfach nur nichts Gescheites ein. Manchmal fällt mir allerdings leider auch was ganz und gar Ungescheites ein.
Mein Blog gibt es weder auf facebook, google+, twitter, ello oder wo auch immer – sondern nur hier. Das mag total kontraproduktiv erscheinen, aber mit der Produktivität habe ich es eh nicht so. Dafür habe ich eine gesunde, ausgeprägte Abscheu vor Werbung. Ich kann Marktschreier nicht leiden, wieso sollte ich also einer in eigener Sache werden?
So spiele ich lieber Würfel mit der Göttin des Zufalls und schaue erstaunt dabei zu, wie die Wellen des Netzes immer wieder ein paar Schiffbrüchige an meine Blog-Gestade spülen. Was nicht bedeutet, dass es mich nicht freut, wenn andere freundlich auf mich hinweisen, im Gegenteil. Auch ich bin oft so begeistert von fremden Texten, Bildern, Filmen, dass ich es gar nicht abwarten kann, sie zu verlinken.
to be continued…und immer noch gilt: Bei Fragen fragen!
Zuerst wird eine neue Kategorie eingeführt: Der Ruhestand, in dem die nicht mehr aktiven oder existenten Blogs aus der Rolle landen – den Anfang macht Die Schrottpresse von pantoufle. Schon allein, um zu sehen, welche Abteilung über die Jahre mehr wächst.
Als nächstes zwei Neuzugänge, die ich so interessant finde, dass ich dort bei gesponserten Posts und manch anderem Werbemüll schon mal das eine oder andere Auge zudrücke (gerade in der Blogroll kann ein bisschen bunte Abwechslung nicht schaden, und ich kacke ja auch niemandem vor die Tür^^) : Die Blogrebellen und Sebastian Hartmanns StreetArtMag. Zur Kompensation für das immer noch vorhandene, machmal leicht nervende linke Gewissen kommt dafür das Lower Class Magazine in die Blogroll. Auch oft politisch, dabei erstaunlich vielfältig und längst überfällig ist Tante Jays Grabbelkiste.
Für Berliner (natürlich wieder deutlich in der Überzahl) bzw. Hamburger und weltenbummlerisches Lokalkolorit sorgen ab jetzt Nante Berlin, Wirre Welt Berlin, ThorgeFaehrlich und der reisende Reporter Andreas Moser. Zu guter Letzt noch ein wenig ganz viel Indieliteratur und Pagophilas unbeschreiblich wunderbare Cool Pains, ein krönender Abschluss…
12.08.03
Aus politischer Überzeugung
störe ich seit zehn Jahren
meine Haare nicht mehr
beim Wachsen.
Doch jetzt erst fiel mir auf,
dass ich damit wirklich dem System schade.
Durch gesparte Friseur- und Kammkosten.
Für wie viele fehlenden Arbeitsplätze
ich wohl über die Jahre gesorgt habe?
Allerdings werde ich noch übertrumpft,
durch die guten alten Rude Boy Skins.
Kein Friseur, kein Kamm, kein Shampoo.
(Kein Gott, kein Staat, kein Vaterland)
Aber: Die der Wirtschaft vorenthaltenen Gelder,
werden am anderen Ende wieder ausgegeben,
für Haarlack und Farbe,
von den Punks,
den Deppen.
Ich war da, bei der Bloggerlesung in Hamburg. Und es war toll, keine Frage. Fragen habe ich allerdings noch so einige. Zum Beispiel, warum ich es nicht mehr geschafft habe, mit Glumm noch ein Bier zu trinken. Die Rhabbis waren wohl schuld, nachdem die Mexikaner für nicht so dolle befunden wurden. Also lieber Rharbarberschnaps. Die Jury bestand neben mir noch aus einem anderen fachkundigen Berliner Gaumen, der in Begleitung einer zukünftigen Erfolgsschriftstellerin angereist war. Irgendwann schleppte ich mich dann frühmorgens aus dem Jolly Rogers (keine Ahnung, wie wir dahin gekommen sind….) in meine Unterkunft.
Also: Danke an Candy, Sabine und Glumm, es hat viel Spass gemacht.Und nächstes Mal verlieren wir uns hoffentlich nicht so schnell aus den Augen – dass es ein nächstes Mal geben wird, geben muss, das ist eigentlich auch keine Frage. Doch jetzt geht es erst mal zurück nach Berlin, beladen mit schönen Erinnerungen und ein paar Büchern mehr – passenderweise war in der Flora nämlich auch noch die radical bookfair. Danke Hamburg und danke Candy, für die Idee und für die Umsetzung. Ein durch und durch gelungenes Wochenende.
Als Überbrückung – ich bin ja schon so gut wie in Hamburg, juhu – noch ein paar Links und Bilder für das lange Wochenende, teilweise sogar bewegte (und bewegende). Zuerst: Hamburg hat sein Lächeln verloren, auch darauf bin ich irgendwie gespannt, wie es jetzt dort ist, kurz nachdem OZ seinem Berufsrisiko erlegen ist. Für wirklich tiefe Einblicke lohnt sich dieser Nachruf.
Um solch einen Verlust zu verkraften, braucht es natürlich mehr als ein wenig Auflockerung, aber das ist alles, was ich bieten kann: Zwei krude Interviews, eines mit Quincy Jones, das andere mit Robert Anton Wilson. Keine Ahnung, wer von beiden schräger drauf ist, vielleicht ja gar keiner. Um noch kurz beim Thema Drogen zu bleiben: Diese Geschichte zu den McDonalds-Teelöffeln kannte ich bisher noch gar nicht, wahrscheinlich war ich der einzige. Und eine letzte Kuriosität, ebenfalls vollkommen neu für mich: Die BRD hat eine Exklave in der Schweiz.
Doch zurück zum Ernst, dem hochkulturellen erst einmal – wie er sich beispielsweise bei einem Redaktionsbesuch in der FAS abspielt. Oder bei Suhrkamp, natürlich bei Suhrkamp, wo, wenn nicht bei Suhrkamp. Dort wird gerade der 90. Geburtstag Siegfried Unselds gefeiert, inklusive einem schönen Film mit Männern in blütenweißen Hemden, die sich über die Entstehung eines Unseld-Bild(und Text)bandes unterhalten:
Dazu, und um die wilde Mischung hier möglichst weit aufzufächern, ein paar Zitate von Fauser, hatte ich ja lange nicht. Mir war noch in einer dunklen Ecke des Hinterkopfes in Erinnerung, dass Suhrkamp für ihn ein Thema war. Dank des wunderbaren Registers im Strand der Städte konnte ich das schnell verifizieren, es gab sogar eine gewisse zeitliche Ballung, auf den ersten Blick. Hier die schönsten Auszüge (alle aus dem verlinkten Band, aus den verschiedensten Texten):
Natürlich war mein Weltschmerz damals schon nicht mehr ganz à la mode, er bezog seine Empfindungen – jedenfalls auf literarischem Niveau – aus Attitüden und dazugehörigen Texten, die von Suhrkamp nicht editiert wurden. (1981 – S.535)
„Sich mit Dingen bekannt machen“ – daß wir aus (guten) Kriminalromanen mehr Wirklichkeit erfahren als aus einigen Metern der Suhrkamp-Produktion, war uns schon immer eine liebe These. (1981, S.605)
Am Beispiel der abenteuerlichen Story eines Glücksritters, der – mit finanzieller Beteiligung des Filmstars Clint Eastwood – den Beweis erbringen wollte, daß in Laos und Vietnam noch amerikanische Kriegsgefangene einsitzen, sammelte ich einige Argumente gegen die offenbar nicht nur mich anödende deutsche Suhrkamp- und Schulfunkkultur. (1983, S.766)
Und es sind Filme wie der von Boisset, die mir bestätigen, daß ein von unserer Hochkultur nicht ganz ernst genommenes Genre wie der Spionagethriller präzisere Aufklärungsarbeit über die realen Verhältnisse leistet als ein ganzer Schuber Suhrkamp-Literatur und ihre Verfilmungen. (1983, S.784)
Es schält sich da langsam ein Muster heraus, es wird klar, worum es Fauser geht (und er hat ja auch immer noch Recht damit), aber es droht, redundant zu werden. Jedoch: au contraire, lustiger wirds; es folgt die Vorstellung des Nachwuchsautors Rainald Goetz…
Rainald Goetz ist ein quirliger Mensch von Ende 20, ein Akademiker mit grün oder blond gefärbter Haartolle, Medizin und Geschichte, der sich unlängst darin gefiel, vor den Kameras irgendeiner Kultursendung mit Selbstverstümmelung zu kokettieren und im Herbst (bei Suhrkamp, na klar doch) seinen ersten Roman vorlegen wird, der Irre heißt, na ja doch. (1983, S.786)
Und weiter, auch weiter ausholend, im selben Jahr:
Klar, wir werden den Kulturkampf bekommen, und zwar als Teil jenes großen Kulturkrampfs, wie ihn uns das Kultur-Establishment seit den Tagen der Re-education und der Gruppe 47 so lange um die Ohren gehauen hat, bis wir alle eines Tages geglaubt haben, die Waschzettel der Suhrkamp-Kultur und die Aspekte-Statements der Gremien-Filmer seien Wegzehrung genug für die Teilnahme am geistigen Leben dieser Republik. (1983, S798f)
Doch zum Schluss, nach einer längeren Feuerpause Richtung Suhrkamp, jedenfalls in seinen journalistischen Arbeiten, fast eine Würdigung des Verlages, an dem er sich zwar rieb, aber dem er auch etwas abgewinnen konnte. Vor allem, was Unselds Rolle betraf:
Ein gleichaltriger Lektor von Suhrkamp sagte: Da ist ein Autor, der hat auch mit einem anderen Verlag einen Vertrag über das gleiche Buch wie schon mit dem Suhrkamp-Verlag abgeschlossen. Das hat der Unseld erfahren und ist hingegangen und hat gesagt: Sie sind weg hier. Tough. Hart. Raus. Ich finde das richtig. Es muß Richtlinien geben. (Aus einen Interview mit Fauser, 1985, S.1532)
Soviel dazu. Was bleibt ist mal wieder die harte, traurige Realität:
Die vor kurzem die ersten handfesteren Zahlen ins Haus spülte, nachdem mit anderen Zahlen immer mehr Leute aus dem Haus gespült werden: Derzeit liegen wir noch etwas unter der Vergleichsmiete, nach der Modernisierung (bei der ein Fahrstuhl natürlich nicht fehlen darf, fürs ausgebaute Dachgeschoss…) soll es knapp doppelt so teuer wie die Vergleichsmiete werden. Offiziell wissen wir jedoch noch von nichts und üben uns auf anwaltlichen Rat im Teetrinken. Daran anknüpfend lässt sich hier mit den Goldenen Zitronen wunderbar der Kreis schliessen, vom bösen G-Wort zu Hamburg. Ich bin gespannt…
Eigentlich war ein alter Bekannter, Nachbar und temporärer Mitbewohner schuld. Lange verschollen und jetzt das erste Mal seit fünf Jahren wieder im Lande, zu Besuch von den Inseln, die unser Wetter machen. Er hat ein etwas seltsames Verhältnis zu seinem etwas seltsamen Hund. Und schaut etwas zu laut seine seltsamen ARD-Vorabendserien, gestreamt, nebenan im Wohnzimmer, weil er drüben kein Netz hat.
Also schmiedete ich Fluchtpläne, und siehe da: In der Schankwirtschaft eines anderen alten Freundes, den ich ebenfalls viel zu lange nicht mehr gesehen hatte, gab es so eine Art Lesung. Ein günstiger Zufall.
Sowieso: Schon Monate nicht mehr im Prenzlauer Berg gewesen! Kein Regen in Sicht und die letzte Spätsommerabendluft in der Nase, mit dem Rad über die Fischerinsel mit Blick auf den in der viel zu frühen Dämmerung angeleuchteten Dom, über die Spree, die hier fast einen Hauch von Hamburg versprüht.
Ich kannte den Laden schon, als es ihn noch gar nicht gab, nur im Kopf des zukünftigen Wirtes. Inzwischen musste er unter großem Getöse umziehen, hat dafür aber jetzt seine eigenen vier Wände. Das Konzept ist immer noch das Gleiche, im Grunde stammt es von der alten, selbstverwalteten Kneipe drei Ecke weiter, wo wir uns damals um Kopf und Kragen kickerten und kifften: Im Angebot waren Kultur, Politik und Alkohol, in unterschiedlichen Dosierungen, aber immer möglichst preiswert. Natürlich ist auch hier die Kultur meist am billigsten, oft sogar umsonst. Beim Alkohol kommt das nur in Ausnahmefällen in Frage.
Seit je her wehte hier ein schwacher Hauch der alten Prenzlauer Berg-Bohème, oder dem, was noch davon übrig ist. So auch an diesem Abend. Eine Zeitschrift wurde vorgestellt, genauer die vierte Ausgabe derselben. Subkultur, natürlich. Gibt es auch noch, so etwas, zum Glück. Ich wies ja schon vor einer Weile auf ein anderes Blatt hin und mache das auch jetzt gerne wieder . Wie viele weitere gute Underground-Mags derweil unerkannt an mir vorbeirauschen, kann ich natürlich nicht wissen; eine Menge, wahrscheinlich, hoffentlich.
Der Saal war noch leer, so konnten wir in Ruhe am Tresen die Ereignisse der letzten Wochen und Monate abgleichen. Der Überfall letztens – auch die verschiedensten Meldungen darüber weckten meine Neugier und bewogen mich an diesem Abend hier her zu fahren – war weit weniger dramatisch als von den einschlägigen Quellen behauptet. Ein Plastikaschenbecher musste dran glauben, das war’s. Den größten Schaden richtete die Staatsmacht an, besser gesagt ihr Pfefferspray in Kombination mit dem Deckenventilator. Also alles halb so wild.
Pünktlich eine halbe Stunde nach dem angekündigten Beginn ging es dann los, ein wenig mehr Publikum war inzwischen auch eingetroffen, trotzdem nahmen die Autoren der vorzustellenden Zeitschrift auch jetzt noch den Großteil der Stühle in Beschlag.
Für Brasch, Have- und Biermann bin selbst ich viel zu jung, aber hier saßen Leute, die damals dabei waren, zumindest hätten dabei sein können. Und – von dem was ich über diese Zeit weiss, darüber gelesen habe – viel anders war es jetzt&hier auch nicht. Ohne Begrüßung las man erst einmal drauf los, ein kosovarisches Gedicht, wie sich herausstellte.
Erst danach wurde die Runde und der genaue Ablauf der nächsten Stunde vorgestellt. Und ab da war wirklich erst einmal kein Unterschied zu den späten 70ern erkennbar: Auf Heiner Müller-Lyrik folgten Victor-Jara-Nachdichtungen, deren Originale daraufhin zur Gitarre gesungen wurden, von jemanden, der ein wenig wie eine Mischung aus Müller und Wim Wenders aussah. Übrigens ziemlich gut gesungen, hatte ja aber auch genug Zeit, der gute Mann, zu üben und zu beobachten, wie was am besten ankam. In all den Jahren.
Schon bei den Müller-Gedichten fiel mir mal wieder auf, dass Gedichte zu schreiben ein Klacks ist, verglichen damit, Gedichte zu lesen(unter bestimmten Umständen jedenfalls – über den feedreader zum Beispiel), oder gar vorgelesen zu bekommen. Daher auch meine Verweigerung dem Vorlesen gegenüber – das sollte man können. Andersrum wird ja auch in den seltensten Fällen erwartet, dass Schauspieler gute Stücke schreiben. Nicht umsonst gab es früher Vortragskünstler. Kurzum: Bis auf wenige Ausnahmen lese ich mir Gedichte am liebsten selbst stumm in meinem Kopf vor, bevorzugt von Papier.
Ganz ähnlich erging es mir, als die zeitgenössische, selbstverfasste Literatur an der Reihe war. Nur selten drang bei der vorgelesenen Austellungskritik (Alltag in der DDR) durch, wie gut sich der Text vielleicht lesen lässt (Diese Ausstellung muss genauso gegen den Strich gelesen werden wie das ND zu DDR-Zeiten.).
Ein alter Profi und Ostpunkexperte brachte dann etwas Schwung in die Veranstaltung. Erst berichtete er von den unwissenden Studenten, mit denen er sich gerade in einer Gastvorlesung herumschlagen musste (sowas kommt immer gut an), dann beschwor er wort- und stimmgewaltig vergangene Beatpoetenabende mit Wolfgang Hilbig, Leipzig anno 79. Da war er wieder, der Fluch des Vergangenen, er schien über diesem Abend zu liegen, aber dieser Abend war dann auch schon vorbei und selbst vergangen.
Als Zugabe, nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung, gab der Wirt noch eine Improvisation im Notenständer-Zusammenklappen (eine Spende des Konzerthauses, ob freiwillig oder nicht habe ich nicht herausgehört). Womit er leicht einen der Höhepunkte des Abends ablieferte, was nichts zur Qualität der Texte oder der Zeitschrift sagen soll. Die werde ich mir nämlich noch mal in Ruhe selbst vorlesen; stumm, in meinem Kopf.
Eine Lesung. Wer weiss, vielleicht berichte ich ja demnächst von einer anderen.
23.03.04
Der Richter hob seinen Blick knapp über die halben Gläser der Brille und sah ihm direkt ins Gesicht. „Herr Sperber – das ist doch ihr bürgerlicher Name? – das ist eine vielleicht etwas intime Frage, aber bitte, schildern Sie uns doch mal ihr Verhältnis zur Sexualität, so allgemein.“
„Euer Ehren, mit allgemeinen Sachverhalten kann ich nicht dienen. Wenn es um Sexualität geht, bitte: Mit 13 Jahren habe ich das erste Mal onaniert, in der Badewanne, unter Zuhilfenahme von Kernseife. Als Vorlage diente mir dabei eine Szene des Buches `Gullivers Reisen´, in der Gulliver am Hofe der Riesen von den Hofdamen zu deren Belustigung zwischen ihre eingeschnürten Brüste gesteckt wird. Diese Vorstellung prägte, wie ich jetzt weiss, mein späteres Sexualverhalten enorm, da ich mich immer zu Frauen mit grossen Busen hingezogen fühlte.
Allerdings konnte ich nie eine langfristige Beziehung zu einer Frau aufbauen. Es fing damit an, dass ich im Alter von sechzehn Jahren, nach meinen ersten enttäuschenden Erfahrungen, in einer Zeitung eine Anzeige für Telefonsex fand. Da meine Eltern nicht im Haus waren und aufgrund meiner Erregtheit mein Denkvermögen einigermaßen eingeschränkt war, rief ich umgehend die angegebene Nummer an und sprach stundenlang mit den unterschiedlichsten Frauen in unflätigster Art und Weise.
Diese Art der Konversation fesselte mich ungemein, um es schonend auszudrücken. Ehrlich gesagt wurde ich in einem rauschartigen Anfall wie besessen davon, ich musste es immer wieder machen.
Doch umgehend wurden mir auch die Konsequenzen meines Handelns bewusst. Die erste Telefonrechnung konnte ich noch abfangen. Nach anderthalb Monaten allerdings bemerkte mein Vater Otto Unregelmäßigkeiten auf seinem Kontoauszug. Er erwähnte es nebenbei am Abendbrotstisch, ohne vorwurfsvollen Unterton. Daher war ich mir sicher, dass er noch keinen konkreten Verdacht geschöpft hatte. Aber wie ich ihn kannte, würde er so schnell wie möglich weitere Nachforschungen anstellen, da die abweichende Summe, er nannte keinen genauen Betrag, scheinbar nicht ganz unerheblich war.
Tags darauf packte ich meine Sachen und machte mich aus dem Staub. Die ganze Angelegenheit war mir unendlich peinlich. Ich wäre lieber, verzeihen Sie mir die Ausdrucksweise, doch ich weiß inzwischen wovon ich spreche, ich wäre lieber in den Höllenschlund gesprungen, als dass ich meinem Vater, einem einstmals vorbildlichen Angestellten, Rede und Antwort über die erhöhte Telefonrechnung hätte stehen müssen. Ich sah meine Eltern nie wieder.
Nach Jahren des Herumtreibens in den verschiedensten geografischen und sozialen Milieus ließ ich mich dann letztendlich mit Anfang zwanzig in einer Großstadt nieder. Bis dahin hatte ich es nicht gewagt, meiner Sexualität wieder freien Lauf zu lassen. Ich war immer noch geschockt von dem unbändigen Potential, das dabei freigesetzt wurde. Mir war durchaus bewusst, dass ich ein Problem hatte, doch ich wollte einen letzten Versuch unternehmen.
Sie müssen wissen, zu dieser Zeit fingen die Frauen an, sich enorm freizügig zu kleiden. Überhaupt schien die gesamte Gesellschaft in höchstem Maße sexualisiert zu sein. Ehemalige Erotikdarstellerinnen machten Wahlkampf für eine ehemalige Regierungspartei. Es gab kaum mehr einen Unterschied zwischen Musikvideos und Pornofilmen. Von jedem Plakat und aus jeder Gasse brüllte einen der Sex geradezu ins Gesicht. Ich war jung, ich wohnte mit anderen jungen Menschen unterschiedlichen Geschlechts zusammen und es wurde viel geteilt. Es gab philosophische Gespräche in der Gemeinschaftsküche, aber auch in ihnen drängte sich die Sexualität immer mehr in den Vordergrund. Spätestens seitdem die Franzosen wieder in Mode kamen, Foucault, Houellebecq. Ich fühlte mich einem gewissen Druck ausgesetzt.
Eines Abends ging ich in das Zimmer meines Mitbewohners, der gerade in einem Cafe dem Müßiggang nachhing, um an seinem Computer meine E-Mails nachzuschauen. Ich stieß zufällig auf einen Ordner mit pornografischen Fotos und Filmen, mich überkam ein unsägliches Verlangen nach Selbstbefriedigung, dem ich schließlich nachgab. Dann schaltete ich schnellstmöglich den Computer aus und begab mich in mein Zimmer.
Ich quälte mich die ganze Nacht mit Zweifeln über die Normalität meines Sexualverhaltens, wusste andererseits aber auch nicht, wie es zu bewerten war, dass mein Mitbewohner solches Material auf seinem Computer gespeichert hatte. Am nächsten Morgen schleppte ich mich dann müde und wie gerädert zur Universität, um dort im Computersaal noch mal mein Postfach abzufragen, das hatte ich am Abend zuvor nämlich vergessen. Wie ich in solchen Momenten immer alles um mich herum vergaß. Auf dem Weg dorthin, schon auf den Fluren der Alma Mater, fand ich eine dieser neuen Digitalkameras. Das stimmte mich etwas froh, ein wertvoller Fund, als Student hatte ich ständig Geldsorgen. Ich zog mich auf eine Toilette zurück, um mir das Gerät näher anzuschauen.
Es war ein sehr modernes Modell, das LCD-Display zeigte ein ganz passables Bild und das Menü bot unzählige Funktionen. Dann öffnete ich den Ordner, in dem die bisher aufgenommenen Bilder gespeichert waren, und ich erkannte drei meiner Kommilitonen, wie sie sich in unterschiedlichsten Positionen unbekleidet miteinander vergnügten.
In diesem Moment beschloss ich, mich von dieser Gesellschaft los zu sagen. Ich machte unverzüglich kehrt und trat noch am gleichen Tag dem Orden des heiligen Franz bei. Das war vor fünf Jahren. Daher kann ich ihnen über Sexualität, so im Allgemeinen, nicht viel sagen. Praktisch gesehen, im wortwörtlichen Sinne. Und ich bin, rückblickend betrachtet, auch sehr glücklich über diese Entscheidung, wenn ich ehrlich sein soll, und darum geht es hier ja, nicht wahr? Allerdings, Euer Ehren, wenn ich Ihnen auch eine Frage stellen dürfte: Es geht hier doch um einen Verkehrsunfall, wieso stellen Sie mir solche Fragen?“
11.08.03
Potsdamer Platz I
Von wegen „unter dem Pflaster
liegt der Strand“!
Nur Mamor&Granit hier,
kein Sand.
Die Parkattrappe ist kümmerlich
mit Rasen bedeckt.
An vielen Stellen aber bricht
das Stahlskelett durch.
Noch spärlicher getarnt
sind hier nur
die Menschendarsteller.
Potsdamer Platz II
nichts wie weg!
Als meine schwäbische Mitbewohnerin noch ganz frisch in der Stadt war, noch nicht im Bermudadreieck aus Goldenem Hahn, Franken und Trinkteufel verschollen, kam sie eines Tages aufgeregt von einer Erkundungstour zurück und erzählte, dass sie irgendwelche Schauspieler Darsteller irgendeiner Vorabendserie getroffen hätte. Wobei mir weder die Namen noch die Serie irgendetwas sagten. Doch ich konnte ihre Aufregung nachvollziehen, mit einem milden, wissenden Lächeln auf den Lippen natürlich.
Man gewöhnt sich ziemlich schnell daran, dass einem hier die Gesichter aus den Illustrierten vor der Nase herumlaufen. Was der Schwäbin spätestens klar wurde, als Pete Doherty vor ihrer Stammkneipe rumrandalierte wie jeder andere Säufer auch. Irgendwann gehört es jedenfalls zum Alltag, von dem die Berliner, deren Lebens- und Arbeitsmittelpunkt sich in Mahlsdorf-Süd befindet, freilich auch nichts mitbekommen. Obwohl: Die haben immerhin Frank Schöbel als Nachbarn.
Ich gehöre – das wollte ich damit sagen – nicht zu den Menschen, die sich für jeden dahergelaufenen Prominenten kreischend auf den roten Teppich am Potsdamer Platz stellen. Ich laufe ihnen eher zufällig über den Weg. Am letzten Wochenende machte ich allerdings eine Ausnahme.
Dank des Internets erfuhr ich, dass Shepard Fairey gerade dabei war, gleich bei mir um die Ecke, im Herzen meines Kernkiezes, eine Wand anzumalen. Ich mag Street Art sehr, doch auch hier versuche ich, möglichst jeglichen Personenkult zu vermeiden. Es geht schliesslich um die Kunst, nicht um den Künstler (Dass dies nicht wirklich zu trennen ist, ist eine andere Geschichte). So kannte ich zwar das 2008er Hope-Poster, aber der Name und das Gesicht des Künstlers dahinter blieben mir bis zum Banksy-Film verborgen. Banksy war eine lange Zeit der einzige (berühmte) Street Artist, den ich namentlich kannte.
Ich halte Faireys Kunst größtenteils für ganz gelungen. Trotz meiner innigen Feindschaft zur Werbeindustrie, die wohl für einen Großteil seines inzwischen vermutlich beträchtlichen Vermögens verantwortlich ist. Auch in Berlin war er nicht nur, um eine Wand zu bemalen, sondern auch wegen der Präsentation einer von ihm gestalteten Schnapsflasche. Da hätten wir es wieder, das Dilemma: Guernica gibt es nicht ohne Guernica, Warhol nicht ohne Campbells Tomatensuppe, den großartigen Clip zu Heart Shaped Box von Anton Corbijn (und dessen Karriere als Regiesseur) nicht ohne MTV.
Also: Ich mag Faireys Kunst, aber nicht die Verpackung drum herum, sozusagen. Ich teile vieles von der Kritik an ihm. Banksys Linie sagt mir mehr zu, kommt mir durchdachter vor. Allerdings verkenne ich auch nicht die Umstände, das Wie sie wurden, was sie sind. Banksy kommt aus dem England der Eisernen Lady. Fairey aus den USA, studierte in Kalifornien; ihm dürfte auch die Kalifornische Ideologie nicht ganz fremd sein. The Clash vs. Bad Religion. Wobei nicht vergessen werden sollte, dass die Skateboarder- und Hip-Hop-Szene der USA dort eben auch eine gewisse Zeit lang als Ausgeburt der Hölle, des Teufels und der Commies betrachtet wurde, bis eben die Verwertbarkeit in den kapitalistischen Konsumtempeln die Abscheu vor den fremdartigen Langhaarigen mit ihren Rollbrettern unter den Füßen überwog.
Am Mehringplatz angekommen, setzte ich mich in einiger Entfernung vom Schauplatz des Geschehens auf eine der Bänke im äußeren Kreis, um noch schnell einen neuen Film in die Kamera zu legen. Ganz in der Nähe befand sich der Treffpunkt der örtlichen Trunkenbolde, und so dauerte es auch nicht lange, bis einer von ihnen auf mich zukam und etwas Tabak schnorren wollte. Er hätte keine Zeit, welchen zu kaufen und ausserdem machte die Frau schon wieder Stress, da müsse er erstmal hin und die ruhigstellen. Sagte er und hielt seine Hand auf. Auch im Knast schien er es eilig gehabt zu haben, von der ACAB-Tätowierung auf den Fingern waren nur die ersten beiden Buchstaben fertig geworden.
Ich schüttete etwas Tabak in seine hohle Hand und fragte ihn scherzhaft, ob er zur Crew gehörte. Natürlich wusste er nicht, wovon ich redete. Er hatte sich bei dem letzten Besuch auf dem Slubicer Markt wohl nicht viele Gedanken darüber gemacht, was es mit dem OBEY-Hoodie auf sich hatte, das er dort wahrscheinlich für fünfzehn Euro gekauft hatte und jetzt trug. Als ich ihm in kurzen Zügen die Geschichte erzählte und meinte, dass ebendieser Typ jetzt um die Ecke eine Wand anmalt, konnte er es kaum abwarten, mit dieser brandheissen Neuigkeit vor seinen Saufkumpanen zu glänzen. Die nervende Frau war längst vergessen.
Ungefähr eine Stunde lang schaute ich Fairey und seinen Helfern bei der Arbeit zu. Ich hatte es mir auf der Brüstung des U-Bahn-Eingangs bequem gemacht, fotografierte ein wenig und wechselte hier und da ein paar Worte mit denen, die für ihn filmten und fotografierten. Ich fragte mich, ob der Publikumsverkehr in der Sixtinsichen Kapelle auch so achtlos an Michelangelo vorbeiströmte wie die gehetzten U-Bahn-Passagiere, die in regelmässigen Schüben von der Rolltreppe ans Tageslicht gespuckt wurden. Ein unzulässiger Vergleich natürlich, aber dieser Gedankengang wurde sowieso gleich darauf von der örtlichen Nachwuchsgang unterbrochen. Fünf viertelstarke Kreuzberger Jungs, maximal zwölf, würde ich schätzen, kamen um die Ecke gebogen und kickten eine halbvolle Wasserflasche vor sich her und schliesslich die Rolltreppe entgegen der Fahrtrichtung hinunter. Woraufhin sie allesamt hinterherstürzten.
Nicht der ziemlich berühmte und trotzdem von den meisten Passanten ignorierte Künstler, sondern die fünf Jungs waren in den nächsten zwanzig Minuten die Hauptattraktion: Sie stürmten die Rolltreppe rauf und runter, übten den Moonwalk und ein paar Pässe mit inzwischen zwei Wasserflaschen. Die in Mitleidenschaft gezogenen Rolltreppenfahrer machten einen ziemlich genervten Eindruck, vor allem, da die Rolltreppe aufgrund des Krawalls in schöner Regelmässigkeit stoppte. Die Künstler wirkten dagegen sogar ein wenig verängstigt, nicht nur wegen der Sorge um die wertvolle und eilends von der Brüstung eingesammelte Technik, sondern auch wegen der Lautstärke und der fremden Sprache; Deutsch an sich soll für fremde Ohren ja schon eine gewisse Agressivität in sich bergen – das der Kreuzberger Kids, kombiniert mit ihrem unbändigen Bewegungsdrang, war jedenfalls eine arge Nervenprobe für Fairey und seine Crew. Sie übernachteten im Friedrichshain, da gab es sowas nicht. Ich überlegte kurz, ob ich ihnen Die kommen aus Kreuzberg, ihr Muschis! samt Kontext übersetzen sollte, beliess es dann aber doch bei einer simplen Beruhigung.
Zum Glück war der Spuk kurz darauf ganz schnell vorbei – und das Bild sowieso fast fertig. Einer der Jungs hatte wohl etwas grösseren Mist unten auf dem Bahnsteig gebaut und jemandem war der Kragen endgültig geplatzt, jedenfalls kam der Übeltäter schnell wie nie die Rolltreppe hochgelaufen, schmiss seinen Kumpels ein „Scheisse, die haben die Bullen gerufen!“ vor die Füsse und verschwand in dem nächsten Hochhaustunnel. Die vier anderen Rabauken natürlich direkt hinterher und schon kehrte wieder die ignorante Ruhe der alltäglichen Betriebsamkeit ein. Ich schoss noch ein paar Bilder von dem fertigen Bild und packte wie die Künstler auch meine Sachen zusammen. Als sich unsere Wege am anderen Ende des Platzes trennten und ich mich mit einem „Nice to have you here“ verabschiedete, sah man in der Ferne zwei ratlose Polizisten um den U-Bahn-Eingang herumlaufen.
Weitere Bilder und Hintergründe zu dem Mural gibt es bei Sebastian Hartmann (noch einer, der längst in die Blogroll gehört) . Ich bin dann noch ein bisschen durch die Gegend geschlendert, der Film musste ja auch voll werden, und habe den Rest des großartigen Nachmittags in dem großartigen Kiez genossen.
…der Kiezneurotiker. Und Felix Schwenzel auch. Und ihnen wird Gehör geschenkt, und dann wird wieder auf die Leute gehört, die auf sie hörten. Und dann … ist irgendwann das Internet voll mit von Hand kuratierten Linklisten. Da kann ich natürlich nicht aussen vor bleiben, die letzte Linkammlung hier ist ja auch schon eine ganze Weile her.
Nun dauerte das Durchforsten der abgelegten Lesezeichen mal wieder besonders lange: Alles nochmal lesen, abwägen, ob es sich lohnt und/oder sich thematisch überhaupt einfügen lässt in das Gesamtkunstwerk Linkliste – und nicht zuletzt nachschauen, ob man diesen oder jenen Inhalt nicht schon einmal verwurstet hatte. Da sich also einiges angesammelt hat im Laufe der Zeit gibt es jetzt sogar – trommelwirbel – Kategorien:
Ein Musikvideo, gleich zum Anfang. Um die Stimmung aufzulockern, es für die kommende, vielleicht schwere Kost der Textlinks leichter erträglich zu machen? Eher nicht, obwohl dieses Video durchaus gute Laune machen kann. Also – ich hatte vor einiger Zeit in den Kommentaren schon mal auf den Song „Der Tag wird kommen“ von Marcus Wiebusch hingewiesen. (Standardfloskel: Früher war der viel besser). Jetzt ist das Video dazu da, mit 30.000 Crowdfunding-Euros gedreht, wenn ich das richtig verstanden habe. (Wobei es auch wieder komisch ist, kurz vorher eine Summer of the 90’s-Doku auf arte gesehen zu haben, in der es um die Millionenbudgets für die Clips damals ging) Das Ergebnis kann sich sehen lassen, ganz gut gemacht, schönes Konzept, wie ich finde:
Dazu noch ein paar kurze Anmerkungen: Das Video zeigt sehr schön, dass das Internet nicht gut oder böse, sondern mindestens beides ist (ich mag diese Kategorien ja sowieso nicht besonders). Einerseits: Das crowdfunding, das in diesem Falle geklappt hat. Andererseits: Die schamlosen homophoben Kommentare darunter. Es gibt also noch einiges zu tun und zeigt, wie nötig dieser Song (und dieses Video) sind. Ob es was bringt? Nun, meine Kristallkugel ist gerade nicht griffbereit und auch ansonsten bin ich ja eher ein Pessimist. Trotzdem sollte man es natürlich immer wieder versuchen. Sisyphos halt. Manchmal klappt es vielleicht sogar. Und wenn nicht, gibt es immer noch tolle Videos. Dieses hier, um ein weiteres Beispiel zu nennen, zu einem ganz anderen Zweck produziert.
Zum Abschluss und als Überleitung ein letztes Propagandavideo, dessen Anliegen ebenfalls nicht oft genug betont werden kann:
Hier scheint es also so, als ob der Protest etwas bewirkt hätte. Nur: Aaron Swartz hat sich aufgehängt. Das klingt nicht nach einem Sieg. Scheitern ist immer möglich. Womit wir schon beim nächsten Thema wären: Durch Robin Williams‘ Abschied wurde mal wieder anderthalb Tage lang über Depression und Suizid gesprochen. Für Andreas Biermann ist in den Tagesthemen niemand auf den Tisch geklettert, doch auch er hat seinen Kampf verloren. Denn genau so sehe ich das: Es ist ein Kampf, viele schaffen es, wenigstens ein Unentschieden rauszuholen, aber es kann durchaus auch schiefgehen, wenn die Dunkle Fee (die dir den einen Wunsch erfüllen kann) plötzlich aus dem Hinterhalt einen Überraschungsangriff startet. Ich würde jedenfalls in diesen anderthalb Tagen, die alle Jahre wiederkehren, gerne mehr komplexere Beiträge lesen anstatt – wie allzu oft – immer nur den Verweis auf den Werther-Effekt, damit kann ich nämlich eher wenig anfangen. Immerhin besser als die Abscheulichkeiten der Presse anlässlich des Suizids von Virginia Woolf. Letztlich muss das jeder mit sich selbst ausfechten: Der, der gehen will, und die, die übrig bleiben. Beides beschissene Situationen. Und bisher ging es ja nur und unzulässigerweise generalisierend um die Themen Depression und Suizid. Das lässt sich natürlich viel breiter auffächern: Intros und Extros, Autismus und so vieles mehr vom Krieg mit sich selbst müsste noch besprochen werden, allein – es fehlt die Zeit und die nächste Kategorie drängelt schon:
Auch in diese Gefilde soll eine kleine Brücke führen: Der Mythos von Genie und Wahnsinn hält sich ja hartnäckig, wohl nicht ganz ohne Grund. Wenn einem der Wahnsinn bestimmte Filter nimmt, schlägt sich das mitunter in genialen Resultaten nieder. Nachhelfen kann man da – auch aus medizinischen Gründen – mit diversen Drogen. Oder man kauft sich das falsche Steak. Doch sollen die erzählen, die sich damit auskennen: Bei Herbert Volkmann und Andreas Glumm scheint das ohne Zweifel der Fall zu sein.
Mit Letzterem sind wir dann auch schon mitten in den tollen Texten, die sich bei ihm zuhauf finden lassen (sagte ich das bereits?). Falls man sich je von diesen lösen kann, schlage ich vor, die Reise von Glumms Solingen in Richtung Thorges Hamburg fortzusetzen, sozusagen. Erst zu einem aus den Fugen geratenene Konzert der Beginner, dann dorthin, wo Berlin und Hamburg sich treffen.
Frau Haessys Reise führt dagegen mit dem Zug nach Bonn und Arno Frank verbrachte seine halbe Jugend auf einer Irrfahrt quer durch Europa. Auf Wirre Welt Berlin ist der Weg nicht ganz so weit, er führt lediglich das Treppenhaus runter in den Hof, spätnachts, weil es brennt. Stephanie Bart hat es da schon schwerer, eine Rikscha schiebend auf dem Oktoberfest.
Bei Nilzenburgers Geschichte zu Boris Becker spielt das Oktoberfest erstaunlicherweise keine Rolle, dafür führt er den Vorruf ein: Erlebnisse, die ich mit Persönlichkeiten hatte, die man vielleicht (mich eingeschlossen) ganz anders eingeschätzt hat. Fun Fact am Rande: Für diese Rubrik fiel mir zuerst ein Erlebnis mit Frank Zander ein. Könnt ich wirklich mal aufschreiben, dachte ich. Dann las ich den ersten Kommentar…
Der Literaturbetrieb, der etablierte, der sich etwa bei dem Berliner Literaturfestival gerade selbst feiert (oder betrauert) ist ja vor allem auch durch Preise, Stipendien und Wettbewerbe gekennzeichnet. Tante Jay hat einen preisverdächtigen Text darüber geschrieben, wie man einen Literaturpreis erringt.
Distinktion ist hierzulande in dieser Branche ja besonders wichtig, das U&E sozusagen. Da wäre es natürlich vermessen, Literatur mit Fussballspielberichterstattung oder Drehbuchschreiben in Verbindung zu bringen und gar zu empfehlen, voneinander zu lernen. Deshalb lieber schnell zurück ins sichere Unterholz der anerkannten, weil kanonisierten und ordentlich gealterten Literatur. Zu der gehört inzwischen ohne Zweifel die sogenannte Beatliteratur, auch wenn man ehedem ein extra Vokabelverzeichnis dafür benötigte (was mich irgendwie an die alljährlichen Jugendwort-Listen erinnert, ich meine, bitch please, sowas können sich doch auch nur Leute mit Immatrikulationshintergrund ausdenken, oder?).
KGB – so lautet die griffige Ab- und Verkürzung zum Thema Beat. Dass es natürlich mehr als Kerouac, Ginsberg und Burroughs in diesem Universum gibt, zeigt die Neuköllner Botschaft immer wieder (und demnächst mit einem eigenen Blog dazu). Katja Kullmann weist im Freitag auf die bedeutende, doch leider so gut wie vergessene Rolle von Diane di Prima innerhalb der Beatnik-Szene hin. Doch ganz ohne die namensgebenden Köpfe soll das Kapitel hier auch nicht enden: Holy Soul – eine Geschichte über den alten Allen Ginsberg.
…kann auch ein schönes Hobby sein. Jagdgebiete dafür gibt es einige, mein favorisiertes ist allerdings Georg Seeßlens Blog. Waidmanns Heil!
Bevor es hässlich wird, bevor wir mit den Armen bis zum Ellenbogen in der Scheisse rühren, die sich da um uns herum abspielt, noch schnell etwas Nostalgie als Reiseproviant. Einiges erscheint dabei so anders und weit weg, aber: some things never change, Mortimer. Also: Fangen wir an mit einem WDR-Bericht über „Raubkopierer“ aus dem Jahr 1986 – ich erinnere mich noch gut an einige der gezeigten Spiele, und an das ewige Spulen mit dem Kassettenlaufwerk.
Via Nante Berlin bin ich auf Starsky & Hutch aus dem Prenzlauer Berg, Berlin, Hauptstadt der DDR gestossen (aka Toto und Harry aus Ostberlin). Durchaus interessante Bilder aus dem Jahr 1985:
Nur ein paar Jahre später – genaugenommen knappe vier – und nur ein paar Strassen weiter eröffnet sich eine ganz andere Welt, festgehalten in einem Videodokument mit dem bezeichnenden Titel Kampftrinken Berlin ’89. Dessen Entstehung wird hier und hier näher beschrieben – ein schöner Kontrast zum realsozialistisch-piefigen Vopo-Ostberlin. Gewonnen hat übrigens Wolfgang Hogekamp, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zehn Jahre nach diesem historischen Ereignis lernte ich Hogekamp als Spoken-Word-Aktivisten beim Bastard-Slam kennen. Inzwischen hat er sich wohl die Bezeichnung Veteran redlich verdient, auch wenn er immer noch aktiv ist.
Die 90er kamen und gingen, ein neues Jahrtausend brach an und in Berlin grölten die Säufer wie eh und je, wahre Poesie. Berlin bleibt eben Berlin, im Guten wie im Schlechten. Wie weit ist denn etwa die Cuvrybrache von Barackia entfernt? Besser wird es jedenfalls nicht, weder in Berlin noch generell, mit der Technik, den Neuen Medien und dem Tonfilm.
Nun denn, wir kommen ja nicht drum herum: Die harte Realität also. In der das Kopfwaschen mittels Eiswasser als große Tat zelebriert wird. Zum Glück ist dazu schon alles gesagt bzw. geschrieben worden. So können wir uns den wichtigen Dingen zuwenden: Irgendwo in diesem Land hingen mal wieder eine Weile lang ununterscheidbare Plakate an Laternenmasten – es waren Wahlen. Die Aktion Doppelstimme hatte leider einen wohl etwas unerwarteten Ausgang und so sitzen demnächst jede Menge sauerkrautfurzender Kartoffelfressen in den Parlamenten. What’s new?! Deren Anhänger natürlich genauso wenig Nazis sind, wie diejenigen, die unpolitischen Rechtsrock hören. Kein Scheiss!
Ansonsten? Der Krieg feiert Geburtstag und allerorten fröhlich Urständ, Volker Strübing macht sich dazu Gedanken und ein paar sehr schöne Collagen. Viel zu selten wird der Empfehlung Klaus Baums Beachtung geschenkt, viel zu wenige versuchen sich in Detailarbeit – aber alle schimpfen auf die Presse, die Lügenpresse, die Propagandapresse, die Systempresse; aus allen Blick- und Schussrichtungen natürlich. Dabei aber immer sicher auf dem Sofa oder vor dem Schreibtisch sitzend, an der Front – dort, wo gestorben, wo elendig verreckt wird – sind andere, unter ihnen auch Journalisten und Fotografen. Mit ganz viel Glück entstehen dann aus dem Elend ganz großartige Bilder, ein altes Dilemma der Kunst. Oder stumpfe Propagandafilme.
Bei allem berechtigten Journalisten(darsteller)bashing, aber auch in der Blogwelt, in der Alternativen zum Holzmedienjournalismus längst angepackt sind, fehlt es meist an einem wichtigen Aspekt, wie sich auch gerade an den sehr bedauerlichen Vorgängen rund um Carta zeigt: Die Systemfrage. Bei der landet man über kurz oder lang immer wieder, sorry. Wenn das Ziel Gewinnmaximierung ist, dann ist das eben so, deal with it. Oder kritisiere es, kurz und knackig oder gern auch etwas ausführlicher.
Es ist zum Verzweifeln, keine Frage, da kann man auch schon mal etwas expliziter werden in der Sprache. Ob ich eine Lösung habe? Klar:

via.
PS./Update: Kurz nachdem ich auf Publish klickte, meldete sich Carta in meinem Feedreader zurück. Zum Neustart werden die Leser im zweiten Satz mit folgenden Worten begrüsst: Wir konnten lästige Bugs im Front- und Backend beseitigen und freuen uns, dass sich nun Arbeitsprozesse vereinfachen lassen und Inhalte schneller online gehen können.
Klar, es geht um die technischen Details in diesem Begrüssungstext. Und nur um die. Seltsam genug. Sonst würde man ja dem Postillon Konkurrenz machen.
Update/PS. noch ein letzter, aber verdammt relevanter Link (via wonko): If you’ve ever wondered what depression feels like, this is pretty damn spot on. It isn’t really being sad, but just being…empty. Den Nagel auf den Kopf getroffen.
Und der Kreis gehört natürlich mit einem Musikvideo geschlossen. Wer es bis hier geschafft hat, hat den jungen, engelsgleichen Eddie Vedder verdient. Mit einem Song, der generell und speziell ganz gut passt, ganz gut den Bogen schlägt. Und den Sack jetzt endgültig zumacht.
23.08.10
Hier fliesst die Rur,
ganz in der Nähe
der anderen,
nur ohne H.
Hier gibt es Tauben,
die nicht dreckig, grau und
räudig sind, sondern bunt und stolz.
Wie ihre Besitzer, die sie nämlich haben.
Nachts sieht man richtig viele Sterne,
und ab und zu auch fallende.
Statt Großstadtlichter brennen hier
höchstens mal Strohfeuer.
Selbst die Fliegen sind nicht grau,
sondern glitzern grün und schillernd,
und freitags gibt’s auf dem Markt
lekker Fisch vom Holländer.
Der wohnt wirklich gleich
um die Ecke,
und auch der nächste Ikea
ist von hier aus dort, und billiger.
Trotzdem, und auch wenn ich dort keine
Terrasse, Ruhe oder dunklen Nächte
habe:
Ich vermisse dich,
Berlin.
Wir gingen zusammen zur Schule, von der achten bis zur zwölften Klasse. Damals, an der Küste, nachdem der eine Staat verschwunden war und der aktuelle eben auch die Schule neu organisieren musste. Was bedeutete, dass ich nicht wie geplant bis zur zehnten Klasse auf der alten POS bleiben konnte. Jedenfalls nicht, wenn man vorhatte, etwas aus sich (bzw. dem Kind) zu machen: Denn hier würden demnächst nur noch Realschüler die Zeit totschlagen, wer mehr wollte, musste auf ein Gymnasium. So war das jetzt, dafür gab es aber immerhin keine langweiligen Pioniernachmittage und Freundschaftsratssitzungen mehr.
In meiner Stadt wurden drei Gymnasien eingerichtet. Zwei davon kamen für mich in Frage, das dritte lag zu weit weg von der Altstadt, in der ich wohnte, draussen in einem der Plattenbauviertel. Aber ich wollte ja sowieso auf die altehrwürdige Backstein-Eliteschule kurz vor der Stadtmauer und somit nur fünf Minuten Fussweg entfernt – wenn schon, denn schon. Die Sache hatte nur einen Haken: Die Schulen versuchten, sich ein Profil zu geben – und die von mir auserwählte wollte nun unbedingt ein musisches Gymnasium sein. Für die klassisch-deutsche humanistische Lehranstalt gab es wohl einfach noch nicht genügend Latein- und Griechischlehrer, schätze ich mal. Man muss ja mit dem Menschenmaterial arbeiten, was da ist, ein Jahr nach dem Systemwechsel. Deshalb hatten wir auch bis zur zwölften Klasse Russischunterricht.
Jedenfalls konnte ich meine musischen Fähigkeiten realistisch genug einschätzen (nicht vorhanden), um zu wissen, dass meine Karten nicht die besten waren. Zum Glück hatte aber meine Musiklehrerin einen Narren an mir gefressen – ich wurde in dieser Schule eingeschult, war aber zwischendurch lange Zeit woanders und erst vor einem Jahr wieder zurückgekehrt, worüber sie sich unerklärlicherweise sehr freute. In diesem kompletten Jahr konnte ich meine Musik-Legasthenie dank vorgegaukeltem Stimmbruch ganz passabel verschleiern, wenn es hart wurde half mir mein spielmannszuggestählter Banknachbar dabei, irgendwelche Takte vorzuklopfen oder ähnliches. So kam ich zu meiner Empfehlung, ebenso wie mein heimlicher Helfer. Insgesamt gingen aus unserer 27-Köpfe-Klasse vier aufs Gymnasium.
Was ich bei meinen ganzen praktischen Überlegungen zur Entferrnung zwischen Wohnort und Lernort, dem Ruf, der Architektur und so weiter nicht bedacht hatte, war der Lehrplan. Damit hatte ich mich null auseinandergesetzt, schliesslich war ich jung und es waren Sommerferien. Aufgrund des euphorischen Schreibens meiner ehemaligen (und- wie sich herausstellen sollte – zukünftigen) Musiklehrerin fand ich mich am ersten Schultag in der musisch ausgerichteten Klasse wieder – denn das war es auch schon mit dem Profil: pro Jahrgang eine Spezialklasse. Zusammen mit zwei anderen Jungs und 25 Mädchen. So weit, so gut (und beängstigend auch irgendwie). Als die Klassenlehrerin dann allerdings den Stundenplan erklärte und es dort dank der musischen Spezialisierung nur so von Kunst- und Musikstunden wimmelte, wurde ich etwas panisch. Eine glückliche Fügung liess kurz darauf den Kopf einer anderen Klassenlehrerin im Türspalt erscheinen, mit der Frage, ob vielleicht noch jemand in eine normale Klasse wechseln möchte, sie hätte noch drei freie Plätze. Ich meldete mich sofort, mein alter Banknachbar zog mit, obwohl seine Fähigkeiten hier gut aufgehoben gewesen wären. Der einzig übriggebliebene Junge in der 8 a(m) – wobei das m jetzt unter der Hand für Mädchen stand – wurde in den nächsten Jahren regelmäßig verprügelt, irgendwann war er nicht mehr da.
An diesem Tag war ich also für eine knappe Unterrichtststunde in der gleichen Klasse wie A. Kennenlernen sollten wir uns allerdings erst zwei Jahre später. Dazwischen lag eine komplizierte Zeit, diverse Jugendkulturen kämpften auch auf dem gymnasialen Pausenhof um die Lufthoheit, und zu dieser Zeit in dieser Region war es um das Überleben der Punks, zu denen A. von Anfang an zählte, nicht gut bestellt, manchmal wortwörtlich. Von ihr abgesehen stellte sich die Klasse, aus der ich mich retten konnte, als perfekte Vorstufe des späteren Germanistik-Seminars heraus: Höhere, meist blonde Töchter mit Pferdeschwanz, Bratschenkoffer und der Nase ganz weit oben. A. trug ihr Haar damals grün, wenn ich mich recht erinnere.
Unser nächstes Zusammentreffen, das erste wahrnehmende, wenn auch noch nicht zur Initiation taugend, ereignete sich dann bei einem meiner ersten Ausflüge in den lokalen Underground. Direkt neben dem historischen Altstadttor, unweit der Schule, traf sich die alternative Szene der Stadt. Es waren nicht viele, der Raum auch nicht größer als ein Wohnzimmer. Aber es reichte, um billiges Bier zu trinken, laute Musik zu hören, vom einzigen Interim-Abo weit und breit zu profitieren und das erste Dope zu rauchen. Nachdem ich diesen Laden entdeckt hatte, und A. natürlich mittendrin, zum Mobiliar gehörend, wurde er mein Aufenthaltsort in den Schulpausen der nächsten Jahre.
Einer meiner besten Freunde, eigentlich noch viel zu sehr mit der eigenen Pubertät beschäftigt, ließ sich kurz darauf mit A ein. Sie hätte es nicht nötig gehabt, und er war der Sache nicht gewachsen, aber sie verstanden sich danach noch über Jahre sehr gut. Trotz der Peinlichkeiten, die damals unweigerlich passiert sein müssen.
Bei einer klassenübergreifenden Bildungsreise in die Bundeshauptstadt am Rhein stellten wir fest, dass ich der einzige war, der halbwegs vernünftige Joints drehen konnte und sie die einzige, die etwas zu Rauchen dabei hatte. Doch nicht nur das schweißte uns zusammen.
Keine Frage, sie sah auch damals schon toll aus: Gross – grösser als ich, was keine grosse Kunst ist. Kastanienkulleraugen mit einem gewaltigen Schalk hinter dem Vorhang, eine markante Nase und perfekte Lippen. Aber die unbestritten vorhandene erotische Spannung überliessen wir unserem Unterbewusstsein; wir redeten lieber über Gott und die Welt und Nietzsche, womit sich ersterer dann erledigt hatte. Sie war schliesslich mit meinem besten Freund zusammen, später dann mit einem kleinen Punk aus Bremen. Und auch ich hatte irgendwann mein Highschool Sweetheart gefunden.
Wir bauten etwas auf, dem der Begriff Freundschaft schlecht aufzudrücken ist. Wir steckten beide in Teenager-Beziehungen. Wir wollten zusammen keine sexuellen Herausforderungen annehmen, sondern geistige. Es war eigentlich von unserem ersten langen Gespräch an immer so, dass wir uns Wochen und Monate nicht über den Weg liefen, oder wenn, dann aneinander vorbei, um dann zum richtigen Zeitpunkt aufeinander zu treffen, an dem alles ist, als wäre nichts gewesen.
So ging das wohl etwa ein Jahr: Hier und dort traf man sich, fuhr zusammen zu Konzerten, an den Strand oder in die Indiedisco im Nachbarort. Dann kam die Oberstufe und damit zwei entscheidende Änderungen, auch was A. und mich betraf: Dank des Kurssystems hatten wir jetzt wieder zusammen Unterricht. Und wir bekamen einen Austauschschüler aus Washington, DC. Der zufällig am gleichen Tag Geburtstag hatte wie ich. Die magischen Momente begannen.
Ich weiss nicht mehr genau, wie und wann sich unser Dreierbund gründete. Wahrscheinlich war es an dem Abend, als wir uns zusammen den Doors-Film anschauten. Im sogenannten Kino-Klub, weil es kein Kino mehr gab in unserer Stadt.
Wir waren die jüngsten Mitglieder dieses Klubs, fühlten uns aber sehr wohl dort: Die Atmosphäre, gerade bei dem flackernden Projektorenlicht, war in den Räumen des mittelalterlichen Kontorhauses einfach einzigartig, vor allem wenn dazu eine Buñuel-Reihe lief, oder eben der Doors-Film.
Wir waren alle drei restlos begeistert von dem Film, liefen auf die Straße und genossen den Regen des ausklingenden Sommers. Als er uns nicht mehr genügte, weil er sich langsam verabschiedete, legten wir uns auf die umgischtete Mole und erwarteten zusammen den Sonnenaufgang. Wir redeten und rauchten und tranken und schwiegen die ganze Nacht durch.
Wir zeigten C. die Stadt, vor allem die dunklen Ecken. Wir zeigten ihm das Land und den Strand, voller unglaublich schöner Ecken. Und natürlich Berlin. Von dort ging auch der Flieger, der ihn nach einem Jahr wieder zurück nach Hause brachte. Er hasste den Abschied, deswegen wollte er ihn vermeiden. Klammheimlich hatte er sich aus dem Staub gemacht. A. rief mich aufgeregt an, wir müssten unbedingt nach Berlin. Wir liessen mit voller Unterstützung unserer Eltern die Schule sausen und versuchten, in brennendem Eifer, mehr Details über C.s Verbleib in Erfahrung zu bringen und eine Transportmöglichkeit nach Berlin zu organisieren. Von einer Unterkunft ganz zu Schweigen. In Ostberlin war das Telefonnetz immer noch sehr löchrig.
Der Flug sollte in zwei Tagen gehen und C. wohnte solange angeblich in einer Jugendherberge. Was aussichtslos klingt und uns auch so vorkam, ist doch gar nichts im Vergleich zu heute, wo es hunderte Hostels in Berlin gibt: Das Deutsche Jugendherbergswerk betrieb damals maximal fünf Filialen in der ehemaligen und zukünftigen Hauptstadt. Zur Not würden wir die eben alle nacheinander abklappern. Das Schicksal schien uns schliesslich wohl gesonnen: Wir hatten noch zwei volle Tage Zeit, und der grosse Bruder besagten Freundes, der mit seinen Kunsthochschulfreunden gerade zur Sommerfrische hier war, wollte am nächsten Morgen mit der ganzen Truppe zurück nach Berlin fahren, in dem orangebunt angemalten Toyotaklapperbus, der uns schon bei diversen Roskildefahrten gute Dienste geleistet hatte. Da waren noch zwei Plätze frei, genauso wie in seiner Wohnung in Prenzlauer Berg. Das war doch schon mal ein guter Anfang!
Es war eine der vergnüglichsten Autofahrten, die ich je erlebte. A. und ich waren aufgeregt und aufgedreht, ihre sonst so abgeklärte Fassade hatte sie zu Hause gelassen. Die Kunststudenten kümmerten sich rührend um uns, so dass wir schon nach einer halben Stunde komplett zugekifft waren. Jemand kam auf die grandiose Idee, vor der Autobahn doch noch mal schnell in die Ostsee zu springen. Sie war kalt, wir waren nackt und die Villen in Heiligendamm waren noch grau und verfallen. Etwas ausgenüchtert ging es weiter, und je näher wir Berlin kamen, desto grösser wurde die Ernüchterung: Was, wenn die Jugendherbergsdrachen uns keine Auskunft geben würden? Wo sollten wir anfangen zu suchen?
Als wir die Stadtgrenze passierten, vorbei an dem Bär, war schon längst Ruhe eingekehrt im Bus, der Kunststudentenspass machte müde. A. saß neben mir und hatte ihren Kopf an meinen gelehnt, wir teilten uns einen Kopfhörer und schauten zusammen aus dem Fenster in die Stadt, in die wir von Westen her kommend einfuhren. Seit gut einer halben Stunde schwiegen auch wir, gemeinsam, und hörten das Mixtape, das C. uns dagelassen hatte. Die erste Seite der schwarzen 90er-BASF-Kassette war so gut wie zu Ende, Fleas Gitarre läutete den letzten Song ein. Es sollte für eine Weile unser Song werden. Beim ersten Refrain standen wir an einer grossen Ampelkreuzung gleich hinter der Autobahn, es war Rot und direkt neben uns sass C. verträumt auf einer kleinen Mauer. Wenn das kein verdammtes Zeichen war, in einer Dreieinhalb-Millionen-Stadt!
Nachdem er sich wortreich entschuldigt und erklärt hatte mussten wir ihm versprechen, ihn wenigstens nicht zum Flughafen zu bringen. Dann genossen wir die letzten verbliebenen Stunden in vollen Zügen, nahmen alles mit, was die Gegend zwischen Senefelder Platz und Hackeschem Markt uns damals bieten konnte, und das war mehr, als wir vertrugen. Wir waren noch nicht mal ganz volljährig, genau genommen, und C. musste back home dann ja sogar noch drei Jahre mit dem Trinken warten, offiziell. Am Ende dieser langen Nacht war uns dreien klar, dass diese Trennung unsere Verbindung nicht kappen können würde und dass wir, wenn irgendwie möglich, alle nach Berlin gehörten.
Wo ich dann ja auch zwei Jahre später landete. Zwischendurch hatte ich C. besucht, was für uns beide überraschend und plötzlich kam, aber eine andere Geschichte ist. Nach Berlin würde er es jedenfalls in absehbarer Zeit nicht schaffen. A. dagegen war sich dessen nicht so sicher.
Auch wenn wir schon alleine durch die räumliche Trennung eher in einer Off-Phase waren, sahen wir uns doch ab und zu hier und da. Inzwischen war sie mit einem kleinen, sehr sympathischen schwedischen Punk zusammen, den sie im Hafen auf seiner Jolle aufgesammelt und mit nach Hause genommen hatte. Kurz bevor das zweite Semester anfing, bekam ich einen Anruf von ihr: Rate mal! Schallte mir ihre Stimme entgegen, ganz aufgedreht.
Sie hätte sich dann doch dazu durchgerungen, hat sich an der TU eingeschrieben und – das Beste überhaupt – eine Wohnung gleich um die Ecke, in der Rykestrasse. Dort und bei mir in der Christburger hatten wir zwei schöne Sommer und einen kalten Winter, bevor sich unsere Wege auch in Berlin langsam auseinander bewegten. Ich hatte mir den Politkram aufgehalst – und dann war da ja auch noch eine neue Frau an meiner Seite aufgetaucht. Die A. und mich allerdings auch wieder auf eine absurde Art verband: Sie kannten sich nämlich vom Sehen, von vor fünf Jahren circa, als A. mit dem Bremer Punk den westdeutschen Norden unsicher machte. Als die beiden das herausfanden, hatte ich erst mal stundenlang nichts zu sagen, und auch sonst kamen wir eigentlich alle gut miteinander klar. Wir beschlossen sogar, auf unsere alten Tage (wir waren damals noch nicht einmal Mitte 20) noch mal auf ein Festival zu fahren, so wie früher – also bis vor zwei Jahren – mit Roskilde. Zu dritt machten wir uns im kleinen blauen Fiesta auf den Weg nach Bocklemünd.
Da wir auf der Fahrt circa. elf Stunden zusammen in der Hitze verbrachten, leider meist stehend und somit ohne jeglichen kühlenden Fahrtwind, gingen wir auf dem Festival dann erst mal getrennte Wege, bevor wir uns bei den wirklich guten Konzerten und am Abschlussabend dann sowieso wieder in den Armen lagen: Selbst bei Danzig, Rancid und Monster Magnet, bei Portishead und PJ Harvey sowieso.
Ganz undramatisch eigentlich, das mit den Wegen, auch als wir wieder zurück in Berlin waren. Ausserdem kreuzten sie sich ja auch wieder: A. landete irgendwie recht schnell im Schwarzenberg-Umfeld, Berlin Mitte. Dort gab es durchaus nette Leute, auch ein paar Berührungspunkte. Doch mein Mitte war woanders. An der Uni, in den selbstverwalteten Läden mit weniger Künstlern und mehr Spinnern. Wenn man das so sagen kann. Einer von diesen Leuten war so nett zu ihr, dass sie mich eines Tages anrief und meinte, sie hätte eine grosse Bitte.
Es hatte wieder mit einer Autofahrt zu tun. Der sympathische schwedische Punk war immer noch aktuell, was sich unbedingt ändern sollte. Sein Besuch stand buchstäblich vor der Tür, seine Band war gerade dabei, ihre Polentournee zu beenden, dann wollte er nach Berlin kommen. Doch dort, hinter dieser Tür, lebte A. inzwischen mit einem anderen aufstrebenden Musiker und Puppenspieler mehr oder weniger zusammen. Also mussten wir unbedingt – an diesem Abend noch – ins tiefste polnische Hinterland, ich glaube es war Łódź, um dem armen, sympathischen schwedischen Punk die Situation zu erklären. Dummerweise hatten wir beide am nächsten Tag relativ früh wieder in Berlin irgendwelchen Verpflichtungen nachzukommen.
Nach einer unspektakulären Hinfahrt und einer alternativen Stadtführung durch die örtlichen Punks (Schau, hier haben wir die Hakenkreuze übermalt. Und hier. Und da drüber haben wir letzte Woche ordentlich auf die Fresse bekommen. Und in dem Haus dort hinten ist letztens [Polnischer Punkername] verreckt.) ging es dann am Abend im Jugendklub hoch her. Das Publikum war unglaublich jung, unglaublich begeistert, unglaublich aggressiv und unglaublich trinkfest. Wenn sie etwas gar nicht duldeten, dann, dass man nicht mittrank. Dass wir kein Interesse an ihren Schnüffeltüten hatten war die eine Sache, aber Wodka durfte hier keiner ablehnen.
Nach einigen Stunden und zwei Tumulten – einer wegen des Gerüchts eines bevorstehenden Naziüberfalls, der zweite, als A. dem Schweden erklärte, wie die Lage ist, und er zornig darauf bestand, trotzdem wie vereinbart (nicht mit mir, im Übrigen) noch in dieser Nacht mit nach Berlin zu kommen – saßen wir dann schliesslich stumm, wütend, fertig, ausgelaugt, durchgeschwitzt und betrunken zu dritt im Auto. Irgendwo hinter uns musste demnächst die Sonne aufgehen und wir hielten an der nächsten Raststätte, um Kaffee zu besorgen.
Bei der Gelegenheit sammelten wir einen verloren herumstehenden Polen ein, der nicht nur wie bestellt und nicht abgeholt aussah, sondern auch vorgab, es zu sein: Am nächsten Rastplatz würde sein LKW stehen und ein Kollege hätte ihn versetzt. Mir war ein weiterer Passagier ganz recht, die Stimmung im Auto war sowieso nicht die beste. Doch noch bevor wir den Parkplatz erreichten, wurden wir aus dem Verkehr gezogen. Vorher blitzte es kurz und der Pole meinte nur: Nicht gut.
Die Situation war brenzlig, vor allem, da wir zusammen gerade noch 30 Mark hatten, der Rest war im Tank verschwunden. Und sie wurde noch brenzliger, nachdem ich in das Alkoholtestgerät der polnischen Polizei pusten durfte. Da sich unsere Vergehen inzwischen auf grob 200 DM beliefen und wir auch ansonsten einen suspekten Eindruck machten – Es war halb sechs morgens mitten im polnischen Nirgendwo, A. war noch nicht in Berlin gemeldet, ich schon, dazu noch ein polnischer Trucker und ein fertiger schwedischer Punkmusiker, der steif und fest behauptet, gerade von einem Konzert zu kommen, aber weder eine Band noch Instrumente dabei hat – wurde bewogen, uns auf irgendeine Wache zu bringen, genauer zu überprüfen und zumindest den Fiesta als Pfand zu beschlagnahmen.
Bis Berlin waren es noch 200 Kilometer und A. musste um 9 Uhr in dem Mittecafé sein. Wir waren verzweifelt. Zum Glück verzweifelten daran dann die polnischen Polizisten, und ausserdem half uns das inzwischen auch bei polnischen Polizisten verbreitete kapitalistische Weltbild aus der Bredouille: Das ganze Prozedere und Hin und Her hatte sich schon gut eine halbe Stunde hingezogen, als den beiden Beamten auffiel, dass sie in dieser Zeit durch die geschickt platzierte Radarfalle genau die von uns geforderten 200 DM eingenommen hatten, durch zahlungskräftigere Opfer als uns. Da augenscheinlich bei uns wirklich nichts zu holen war ausser einer Menge Umstände und Scherereien, besann sich der Chef der beiden und gab mir meine Papiere mit den Worten Polnische Polizei gute Polizei zurück. Der LKW-Fahrer konnte es auch nicht fassen, er meinte, für ihn hätte das locker ein halbes bis ein Jahr Fahrverbot gegeben. Um halb neun kamen wir völlig erschöpft in Berlin an.
Diese Fahrt sollte unser letztes grosses gemeinsames Abenteuer gewesen sein. Die verschiedenen Welten, in denen wir uns inzwischen bewegten, trafen einfach zu selten aufeinander, selbst wenn wir die Welten wechselten. Ich verabschiedete mich vom Politbetrieb, zog nach Kreuzberg und versuchte mich in so etwas wie Familiengründung. A. lud uns noch ab und zu zu Auftritten des Puppenspielers ein, erst im Wohnzimmer, dann auf immer grösseren Bühnen. Auch er war ein wirklich netter und ziemlich schüchterner Kerl. Sie hatte da ein gutes Händchen und auch ein gewisses Muster entwickelt, inzwischen.
Die magischen Momente waren noch nicht ganz vorbei. Als wir uns nach einer längeren Pause wieder trafen, stellte sich heraus, dass A. auch nach Kreuzberg gezogen war, drei Häuser neben meine damalige Stammkneipe. Und wir hatten beide bei der gleichen verdammten Naturkatastrophe jeweils neugewonnene Freunde verloren. Ein paar mal trafen wir uns noch, A. hatte die Mitte-Szene und den Puppenspieler inzwischen verlassen und sich in Kreuzberg mit kontroversen kanadischen Expat-Musikern (das Muster!) eingelassen. Ich fing an, nach Westen zu pendeln. Und dann kam irgendwie der Sand, in dem alles verlaufen ist.
***
Wie ich nun darauf komme, wo das doch schon so lange her ist, fragt man sich vielleicht, falls überhaupt jemand bis hier her durchgehalten hat und sich noch was fragen kann. Das ist ganz einfach: Das Internet ist schuld. Klar, wer sonst?!
Eigentlich wollte ich diesen Text auch Berlin Mitte hat mir meine Freundin geklaut nennen, ganz internetadäquat zwar, aber eben nicht ganz wahr. In dessen unendlichen Weiten stolperte ich nämlich über einen zehn Jahre alten Film, der mich in ebendiesen alten Erinnerungen schwelgen liess und mir bisher komplett durch die Lappen gegangen war. Unerklärlich eigentlich, umso mehr zog er mich jetzt in seinen Bann. Es geht ungefähr um die Berlin-Mitte-Szene, in die A. abtauchte, und zwar genau zu der Zeit, als ich sie langsam aus den Augen verlor. Als es diese Szene auch schon nicht mehr gab und sie nur noch nostalgisch betrachtet wird. Keine Ahnung, wie ich diesen Film bei der Berlinale übersehen konnte.
Und jetzt, gut zehn Jahre später, zeigt er mir dreierlei: Dieses Mitte war wirklich verdammt vielfältig damals in den 90ern, und ich war viel öfter dort als ich eigentlich dachte (und jetzt schon ganz lange nicht mehr, seit dem Baizumzug spätestens). Zum Zeitpunkt der Interviews gab es dann einen Abgesang (von einigen), den man im nächsten Sommer (vor drei Jahren/mindestens aber schon gestern) gut zu Kreuzkölln halten könnte. Wobei es interessanterweise 2003 teilweise komplett nach Untergang und Langeweile klang, da schien die weltweit angesagteste Stadt noch nicht nur selten am Horizont durch, da wurde von London, New York und Paris meist noch ehrfürchtig gesprochen. Wer weiss, welche Zukunft es ist, die wir beim derzeitigen Abgesang noch nicht erkennen können. Und Drittens: Schade.
PS. Viertens: Ken Jebsen vor zehn Jahren. Damals schon scheisse, wie mir wieder bewusst wurde. Aber noch nicht so erschreckend durchgeknallt wie heute – oder etwa Xavier Naidoo, schon vor fünfzehn Jahren.
So kam es also, ich schaute mir diesen Film an, die Erinnerungen kamen hoch und ich dachte so bei mir: Eigentlich wäre meine Freundschaft mit A. eine eigene Geschichte wert, vielleicht sogar ein Buch. Und dann dachte ich: Wo ich so darüber nachdenke, warum nicht gleich damit anfangen? Wenigstens in groben Zügen, ein paar Skizzen, bevor ich es vergesse (ich habe schon viel zu viel vergessen, wie mir dabei auffiel). Und genau dafür ist dieses Blogding doch da (so, damit hat sich der Ein Jahr und etwas über 100 Beiträge-Artikel auch erübrigt).
Let it Rock! Von Frank Künster, 1h16min, 2003.
[vimeo http://vimeo.com/104087404]
10.07.14
Gestern habe ich
meine Wohnung verloren.
Was Quatsch ist,
denn dann hätte ich ja
gehen können und sie suchen,
hätte ich sie verloren.
Also rausgeschmissen,
ganz banal & legal,
mit Geld,
wie das heute nun mal ist,
auf dem Markt, der sich Leben nennt.
Bin ja längst nicht der Einzige,
ganz im Gegenteil.
Deswegen gehe ich morgen,
zusammen mit den Anderen,
zur Steinbach,
und ob sie will oder nicht,
machen wir dort dann
unser eigenes
Heimatvertriebenenchapter auf.
Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste. Und: Nicht alles, was hier steht, muss auch wirklich so passiert sein. Noch nicht. Trotzdem ist es wahr.
Ich versuche, möglichst unbedarft auszusehen, als sie mich nach einem Geldschein fragt. Obwohl ich genau weiss, was kommt.
„Ich hab ’nen Fünfer oder ’nen Zwanziger“ sage ich.
„Nimm den Zwanziger, macht sich am Besten!“ empfiehlt der Chemiker und klopft an das Glasröhrchen. Ich gebe ihr den Schein, er gibt ihr das Röhrchen.
„Und du willst da echt nix für haben?“ fragt sie noch, bevor das weiße Pulver durch meinen Zwanziger in ihrer Nase verschwindet.
„Nicht doch, nie. Ist noch von letzter Woche übrig, diese Woche hab ich eh schon Neues gemacht, kein Thema.“ antwortet er.
„Ah ja“ mische ich mich wieder ein, „so Walter White-mäßig, was?“ Frage ich ihn, nicht ohne die Erklärung nachzuschieben, dass ich diese Serie noch nie gesehen hätte, aber dank des Internets die ganzen Memes dazu kenne.
„Genau!“ antwortet der Chemiker, „und das hast du echt noch nie gesehen? Musst du unbedingt machen, wirklich Klasse! Der Stoff ist natürlich die Hölle, da ist das hier Kindergarten gegen. Willst du auch?“ Die Frage ging an mich, ich lehne dankend ab.
„Hab ich mir gedacht“ sagt er lächelnd, und, and sie gerichtet: „Und?“
„Krass, man schmeckt wirklich kaum was.“
Ich stecke den Zwanziger wieder ein und den Joint wieder an. Sie gehen in die Panoramabar, ich werde nach Hause gehen. Oder doch zu N.? Ihre Einladung steht noch, daran erinnerte sie mich gerade vor einer halben Stunde wieder. In ihrem Tiefkühlfach liegt seit Jahren ein Stück getränktes Löschpapier, das ihr Robert Anton Wilson mal geschenkt hatte. Wäre auch eine Option.
03.09.10
Wenn die Solidarnosc-Feuerwerke vorbei
und Langfuhr besichtigt
und für grau und trüb befunden,
und selbst auf Oskars Bench
ein Betrunkener schläft,
sein Frühstück in Form einer Schnapsflasche
neben die Bank gestellt
und die Alufolie seines Trinkpausenbrotes
auf der Denkmaltrommel platziert:
Ist doch diese Stadt,
mit dieser Werft,
mit diesen Arbeitern,
und diese Stadt,
mit diesen Frauen,
mit diesen Absätzen,
und dieses Danzig,
mit dieser Geschichte,
mit diesen Mauern,
mir soviel näher
als jedes bayrische Kaff.
Da kann kein Grass oder Kaczinski
Mir die Laune nicht verderben.
Jetzt ist es klar, da ist kein Platz mehr für Missverständnisse. Sicher, es gab Indizien, ich berichtete ja auch darüber: Wie sich die Gentrifizierung um die Strassenecke schlängelt; nach und nach neue Läden und Geschäfte in der unmittelbaren Umgebung aufmachen; dass die Fassade des Nachbarhauses gerade schluderig, aber energetisch saniert wurde. Zur Fussball-WM gab es sogar direkt gegenüber vom Getränkemarkt ein temporäreres Hipster-Public-Viewing-Venue (sagt man das so?), inklusive Skaterbahn auf dem Dach. Und nicht zuletzt die durchs Haus geisternden Pläne der neuen Eigentümer, nicht ausgesprochen, höchstens unter vier Augen und dem Siegel der Verschwiegenheit, garniert mit einer minimalen Auszugsprämie – doch schriftlich war bisher nichts Greifbares vorhanden.
Aber jetzt ist es klar: Hier steppt demnächst der gentrifizierte Hipsterbär, aber sowas von! Woher ich das weiss? Ich hatte gestern, das erste Mal in den 15 Jahren, die ich (mit kurzer Unterbrechung) in diesem Haus wohne, einen Manufactum-Katalog im Briefkasten. So hat das damals im Prenzlauer Berg auch angefangen. Ho-Ho-Holzspielzeug!
PS. Eine wirklich feine Ironie fand ich ja schon immer, dass Manufactum – wenn man klischeehafte Typisierungen mag – als das IKEA der überdurchschnittlich gut verdienenden Grünen Mittelschicht galt: Die Oberstudienrätin, die mit dem seit Jahren auf eine Professur wartenden Dr.phil.habil. in wilder Ehe samt Linus und Marie im eigenen Eigentum zusammen wohnt und auf gute, möglichst fleischlose und nachhaltig produzierte Ernährung achtet. Da passt Manufactum-Kram gut rein, in so eine Wohnung. Wo jetzt die Ironie ist?
Die liegt darin, dass der Gründer von Manufactum (er hat den Laden inzwischen an Otto verkauft….) nicht nur nordrheinwestfälischer Grünen-Geschäftsführer war, sondern dass er einer der Propagandisten wider dem Grünen Gutmenschentum ist. (wie gesagt, wenn man Typisierungen mag; ich habe bis heute nicht verstanden, was daran schlecht sein soll, ein guter Mensch zu sein).
Und zwar nicht erst, seit das modern ist. Obwohl er da natürlich gern mitmischt und mitverdient, ist halt ein cleverer Geschäftsmann, der Herr Hoof: Der aktuelle Bestseller von Manuscriptum, seinem Spartenverlag, erschien in der Edition Sonderwege, die betreut wird von einem der Protagonisten des neurechten Ideologielimbos (Lichtschlag heisst der Kerl, und Typisierung klappt auch hier nur bedingt: Die grosse Klammer ist die Junge Freiheit, für die auch Lichtschlag gerne schreibt, aber eigentlich ist er so eine Art Nationallibertärer – eigentümlich frei heisst deshalb auch sein durchaus populäres Medienprodukt): Also, der Bestseller ist Akif Pirinçcis „Deutschland von Sinnen“.
Doch Herr Hoof schreibt auch gerne selber, zum Beispiel zur „Lage 2012“ in der konkret der Neuen Rechten, die dort Sezession heisst und die vermeintlichen Vordenker und klugen Köpfe dieser Strömung im Institut für Staatspolitik versammelt. Ihre Säulenheiligen sind die Vertreter der Konservativen Revolution, die sich ein anderer ihrer Säulenheiligen, der Jünger-Sekretär Armin Mohler, für seine Dissertation bei Jaspers ausgedacht hat.
Soviel dazu, wer will, der kann sich mit den paar Informationshäppchen hier jetzt bequem eine Recherche aufbauen, die Jahre in Anspruch nehmen wird und zu dem Schluss kommt, dass die Neue Rechte genauso albern, zersplittert, bedeutungslos und undefinierbar ist wie die Linke. Aber immerhin haben sie Manufactum und damit jahrelang ihre spiegelbildnerischen Counterparts von links gemolken.
[Erste Rechercheansätze finden sich beim Spiegel, der Zeit und beim VVN – doch ich wiederhole meine Warnung und spreche aus Erfahrung: Die Beschäftigung mit dem Thema kann zu starkem ungläubigen Kopfschütteln führen. Sich den Wahnvorstellungen anderer zu widmen kann einen verrückt machen.]
Aus aktuellem Anlass ein ziemlich alter Text aus den frühen Tagen Wowereits. Nach all den Jahren kann ich den Westentaschensonnenkönig natürlich nicht mehr leiden, aber es gab Zeiten, als Wowereit die wählbare Alternative zum Westberliner CDU-Filz um Diepgen und Landowsky war, mag man kaum glauben, heutzutage. Und bevor er in seiner Selbstherrlichkeit den Kultursenatorenposten mit sich selbst besetzte, hatte er mit Goehler und Flierl zwei Menschen in diesem Amt, mit denen man wenigstens vernünftig reden konnte, im Gegensatz zum Vorgänger Radunski. Wenn mich die Erinnerung aus dem Nähkästchen nicht täuscht. Hier also ein Bericht aus einer anderen, längst vergangenen Zeit[Kontext]:
(25.03.2002)
Ich war gerade im Urlaub in Dänemark. Fast klischeegerecht, mit Volvo, Hund und Frau. Die dänischen Ferienhäuser haben als Vorzug nicht nur die obligatorische Sauna, sondern meist auch Fernsehempfang via Satellitenschüssel. Und da das Wetter scheiße und der Hund müde war, dachte ich mir, ich tue mal was für mein Politikwissenschaftsstudium. Also schaute ich mir die vollen fünf Stunden Phoenix-Live-Übertragung der Abstimmung im Bundesrat über das Zuwanderungsgesetz an.
Schon im Vorhinein war klar: das wird spannend. Es gab ein paar geplänkelte Reden vorne weg, sowohl der Kandidat* als auch Schröders Beerber, der dicke Sigmar Gabriel, menschelten und taten so, als ob mal endlich Klartext geredet wird. Und dann kam die Abstimmung, die „Geschichte schreiben wird“. Der knuddelige Wowi, der immer aussieht wie ein zufriedener Plüschteddy, dem gerade der Bauch gekrault wird, hat die Verfassung gebrochen. Na so was! Während alle anderen nur die Interessen ihrer Länder vertraten und von allen Parteizwängen frei ihr Abstimmungsverhalten gestalteten, setzt sich der Kommunistenfreund Wowereit über die CDU-Rechtsauffassung hinweg. Und schon bellt Standartenführer Koch: „Verfassungsbruch!“. Und anstatt: „Schnauze Koch, das ist brutalstmögliche Abstimmung!“ sagt Wowereit: „Mäßigen sie sich.“
Drollig! Da wollten sie alle die Debatte um ein Gesetz, welches von der Regierungspartei B90/Die Grünen noch vor fünf Jahren als rassistisch abgestempelt worden wäre, vom Wahlkampf fern halten, und schon war man mitten drin. Aber weg von den Inhalten – zurück zur Form, um es mit den Wahlkämpfern zu halten.
Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Mitleid mit General a.D. Schönbohm haben würde. Ich ging immer lächelnd und mit klammheimlicher Freude an Graffitis vorbei, die dem Ex-Innensenator von Berlin die Pest und schlimmeres an den Hals wünschten. Gäbe es eine Erhebung über die Häufigkeit personenbezogener Sprühereien in der Bundeshauptstadt, Schönbohm würde ganz oben stehen.
Und wie sah er da im Bundesrat aus! Nix mehr General, nur noch ein Häufchen Elend, Parteisoldat in Diensten des Befehlshabers aus Bayern. Seine sonst so mutig in die Höhe ragenden Augenbrauen schienen schlaff herunter zu hängen, und er schaute an diesem Tag wirklich niemandem in die Augen – außer seinem eigenen politischen Untergang vielleicht.
Keine motivierenden Reden a lá „Wo Ratten sind, da ist der Unrat nicht weit“ oder ähnliche Hetztiraden, sondern Gejammere. „Wollen sie auf den Trümmern der Brandenburger Koalition…“ Schnief! Und als der clevere Klaus dann alle schockte, ließ Stoiber seine Wadenbeisser los: Gegen das Grundgesetz, Verfassungskrise und so weiter. Wenn der Bundespräsident dieses Gesetz so unterschreiben würde, dann aber! Karlsruhe, mindestens!
Das fand ich recht lustig. Ich schlage übrigens vor, dass dieser Fall nicht in Karlsruhe, sondern in Köln-Hürth verhandelt wird. Bei Barbara Salesch oder Alexander Hold. Denn diese Richter spiegeln den Idealfall von Justitia ebenso wider, wie Koch, Stoiber & Co den aufrichtigen und nur auf das Wohl des Volkes bedachten Politiker verkörpern.
*Stoiber
Es ist ein Wettlauf: Werden die Früchte noch reif, bevor die Tomatenpflanzen verrecken? Sie sehen schon länger nicht mehr wirklich gut aus: Schwarzfleckige Blätter, immer mehr verwelkte Triebe. Ich schiebe es auf den Dreck vom Nachbarhaus: Die Fassadensanierung. Erst der feine Staub vom abgeklopften Putz, dann die Styroporkügelchen von der Dämmung. Die werden sich unweigerlich in der Blumenerde angesammelt und aufgelöst haben, jetzt verrecken erst die Pflanzen, und dann wahrscheinlich ich, wenn ich die kümmerliche Ernte verzehrt habe.
Eine Sache allerdings hat mich dann doch positiv überrascht: Auch wenn ich es mit dem Gras auf dem Balkon dieses Jahr gelassen habe (Gerüst vorm Nachbarhaus, zu viele neue Leute über und unter mir), auch die Tomaten, die eine Sorte jedenfalls, wucherte auf über zwei Meter. Irgendwann wusste ich dann auch, was ausgeizen ist und wie man das macht. Einer der Triebe, die weichen mussten, war schon ziemlich gross, sogar ein paar Blütenansätze waren zu erkennen. Ich steckte ihn in ein altes Gurkenglas voller Wasser. Einige Tage später trieben tatsächlich Wurzeln aus; ich wollte noch etwas warten und die Pflanze dann in einen Topf umsetzen. Daraus ist nur nichts geworden: Der Trieb steht jetzt seit Wochen in dem Gurkenglas, immerhin giesse ich ihn regelmässig, das weisse Wurzelgeflecht hat inzwischen seinen eigenen Dschungel gebildet. Und das Erstaunlichste: Aus den kleinen Blütenansätzen haben sich tatsächlich Früchte entwickelt – nur im Wasserglas stehend. Diese famose Natur, selbst hier auf dem Balkon mitten in der Stadt. Von Weizenfeldern, die gerade abgeerntet werden, bekommt man hier ja leider nichts mit. Was schon etwas schmerzt.

(Der letzte Sommer auf dem Balkon: Schön grün)
***
Aber eigentlich geht es im Haus gerade um wichtigere Sachen. Zahlen spuken durch die Köpfe und Flure. „Was ist dein Preis?“ heisst es überall, mal ausgesprochen, mal nur gedacht.
Nach circa einem halben Jahr Ruhe setzte die Hausverwaltung eine zweiwöchige Frist, um Keller, Hof und Dachboden leerzuräumen. Dreizehn Tage vor Ablauf der Frist begannen Johnny & Co damit, lautstark den Sperrmüll vom Dachbodenfenster in den Hof zu schmeissen: „Hi, ich bin Johnny, your new Hausmeister. Do you smoke weed man?“ So stellte er sich vor, der Johnny aus Nigeria, der jetzt unser neuer Hausmeister ist. Was die Hausverwaltung uns bis heute nicht mitgeteilt hat, aber die wissen ja eh nichts von dem, was die neuen Eigentümer so alles machen.
Also mal wieder eine Hausgemeinschaftsversammlung: Über kurz oder lang, das ist klar, werden sie was tun. Das einzige, was wir tun können, ist auf ein paar Regeln bestehen: Fristen einhalten, Formalitäten beachten. Einer der neuen Eigentümer geht durchs Haus und verteilt Angebote, spricht aber auch von locker 300 Euro mehr Miete, wenn alles fertig ist. Gepriesen sei die energetische Sanierung, wenn die kommt, sind wir sowieso alle gefickt.
Zu Modernisieren gibt es natürlich auch eine Menge – da hat sich einiges angesammelt in den letzten 120 Jahren, klar. Doch so wie sie bisher mit den inzwischen zwei, ab nächstem Monat drei freien Wohnungen umgegangen sind, geht es ihnen nicht um die Hege und Pflege der Bausubstanz. Hauptsache schnell fertig werden und Teppichboden über die Dielen tackern, damit das nächste Dutzend Tellerwäschersklaven aus dem Gastro-Imperium einziehen kann.
Wir üben uns jetzt also in Politik – etwas, was wir alle eigentlich seit Ende der Neunziger hinter uns geglaubt hatten, nur die eine WG ist ja noch wirklich aktiv, was meist belächelt wird und manchmal unangenehm aufstösst. Nun aber müssen alle wieder ran: Standpunkt benennen (Gehen oder Bleiben), Strategie finden (Füsse stillhalten oder auf Konfrontation gehen), Informationen sammeln (Kompromat zu den Eigentümern, Anwalt vom Mieterverein zum Hausbesuch bitten zur Erläuterung der gesetzlichen Vorgaben), Vernetzungsarbeit („Die haben da und da und da noch andere Häuser, wo es grad genauso aussieht, lass doch mal mit denen zusammensetzen.“).
Erst mal wird ein E-Mail-Verteiler eingerichtet, eine Chronologie erstellt und Fotos gesammelt. „Zur Not“ meinte die Gastgeberin mit der Fabriketage vom dritten Hinterhof, „müssen wir dann halt an die Öffentlichkeit, ein Blog machen oder so. Kennt sich jemand damit aus?“ Glücklicherweise antwortete der Abgesandte der Antifa-WG schneller, als ich überhaupt überlegen konnte, ob ich mir das jetzt an den Hals kette oder nicht: „Erst mal der E-Mail-Verteiler, dann sehen wir weiter. Dieses ganze überstürzte ‚Wir machen jetzt gleich mal ein Wiki oder ein Blog oder was auch immer’ bringt zum Anfang gar nichts ausser verplemperte Zeit.“ Ein Lob den Aktivisten, die wissen Bescheid.
In der Nacht nach dem Treffen dann die erste Mail mit dem Hinweis auf die ARD-Doku. Am Morgen trudelten die ersten Antworten ein, deren Tenor überall der Gleiche war: Doku gesehen. Ach du Scheisse!
 (Inzwischen sieht es schon etwas schmucker aus, und bald wohl noch mehr)
(Inzwischen sieht es schon etwas schmucker aus, und bald wohl noch mehr)
12.04.14
In Hamburg gewesen,
endlich mal wieder.
Freitag abends auf der Dachterrasse
bei der Schilleroper gesessen,
auf der mal die Rote Fahne wehte,
als das noch was bedeutete.
Viel zu viele Flaschen Wein leergetrunken,
und auch den Port.
Gegessen und geredet und geraucht.
Am Ende wurde A.’s Fuß
vom Bärenfangeisen gefressen,
das sich als rostiger
Stammtischaschenbecher getarnt hatte.
Am nächsten Morgen los, zu Fuß:
Runter zu den Landungsbrücken,
Speicherstadt und Hafencity
links liegengelassen, wie es sich gehört,
sind eh nur hässlicher geworden.
Stattdessen durch den Tunnel
rüber nach Steinwerder
und stundenlang durch Containerlager gelaufen.
Ein Fischbrötchen und ein Astra
mussten dann aber doch sein,
Klischeezugeständnis.
Später alleine, noch ein Bier beim Pudel,
die entspannten Menschen vor der Kirche beobachtet,
und überlegt, warum die das in Berlin
nicht auch so gut hinbekommen,
(und wissen: die Antifas haben es verkackt;
und eingestehen: St.Pauli samt Kirche kann’s besser)
dann über die Davidstrasse zurück.
Beim Kreuzen der Reeperbahn
unweigerlich Lindenberg im Ohr.
Da die Zeit noch nicht gekommen war,
die wir vereinbart hatten,
blieb noch genügend von ihr,
um mit Horst beim Grünen Jäger
ein Feierabendbier zu trinken,
und zu diskutieren, ob Pauli
es in die Relegation schafft,
womöglich gegen den HSV.
Abends merkten wir Schreibtischmenschen
dann unsere wunden Füße
und schleppten uns nur
um der alten Zeiten willen
zur Flora.
Was Hamburg betrifft,
hat Berlin allen Grund,
eifersüchtig zu sein:
Da ist meine Liebe durchaus
wankelmütig.
Nachts um halb drei standen wir angetrunken vor der Moschee, neben dem fancy koreanischen Restaurant. Der Wirt wollte schon vor Stunden Schluss machen, irgendwann sahen auch wir ein, dass es besser wäre, zu gehen. Zu dritt diskutierten wir im leichten Nieselregen die aktuelle Weltlage, wobei einer von uns noch betrunkener war als die anderen beiden und eigentlich nicht mehr mitreden konnte, aber trotzdem wollte. Was gekonnt ignoriert wurde.
Natürlich ging es um Israel und Palästina. Um antisemitischen Müll auf facebook und auf der Strasse. Einer von uns konnte mit dem Hass seines tunesischen Migrationshintergrundsumfelds nichts anfangen. Der andere fand es komisch, dass er sich kaum um seine Mischpoche sorgte, auf Luftschutzkeller, Abwehrschirm und die Stochastik vertrauend. Der Dritte suchte eine Wohnung in Hamburg.
Ich war empört, dass der nicht ganz so Betrunkene eine so hohe Meinung von Mascolo hatte. Hörte mich Geheimdienstkontakte anklagen und brachte im Zuge dessen sogar Leyendecker in Verbindung mit der BND-Payroll. Musst du nur mal im Internet nachgucken, sagte ich. Ach komm, das ist doch jetzt schon ne arge Verschwörungstheorie, sagte er. Leyendecker, die machen sssuper Fenssster oder ssso, sagte der Betrunkene. Dann gingen wir zum Glück nach Hause.
(oder: Deine Mudda is‘ Kapitalismus, du Subjekt!**)
26.02.14
Weil du schneller rennen musst
als du überhaupt kannst,
nur um auf deiner Sprosse der Leiter
stehenzubleiben,
bist du so flexibel geworden,
dass du inzwischen
deinem unternehmerischen Selbst
selbst in den Arsch kriechen kannst.
Hauptsache, du bist bald nicht mehr
auf diese miesen Jobs angewiesen,
weil du endlich
eine Stelle ergattern konntest.
Aber egal, denn:
Je mehr Weltuntergangsszenarien versagen,
desto höher die Wahrscheinlichkeit,
dass das nächste stimmt.
Immer im Sommer kommen die Irren raus, Bonnys Ranch* entlässt sie zur Ferienfreizeit in die große Stadt. Das war schon damals im selbstverwalteten Ausschankbetrieb aka Unicafe nicht anders: So sicher wie zum Semesterende der Sommeranfang nahte, tauchten um dieselbe Zeit der Exhibitionist, der Tabakschnorrer und der Brüller auf der Bildfläche auf.**
Jetzt war es eben einer, der zwei Seiten des Gästebuchs vollschrieb, psychiatrieerfahren auch er, wie er freimütig einräumte, in einem Nebenstrang des handlungslosen Werkes. Er erzählte etwas davon, dass Mühsam hier ermordet worden wäre, was Quatsch ist. Konnte er natürlich nicht wissen, er hat sich ja nichts angesehen. Kam rein, setzte sich hin, schrieb seinen Stiefel runter und ging wieder. Zwischendurch wischte er sich kurz mit dem T-Shirt den Schweiß aus dem Gesicht, wobei sein überaus fleischiger Körper zum Vorschein kam. Die Hitze! Eigentlich ging es ihm aber darum, dass Wasser ja ein Gedächtnis hat und deswegen auch alle Kleidungsstücke oder Brillen, die wir tragen, letztlich Holocaustopfern gehörten, womit wir schwingungstechnisch mit ihnen verbunden wären, sie aber eben auch weiter schändeten und ausbeuten würden. Sieht man ja auch an der Beutekunst. So etwa in der Art.
Später auf dem S-Bahnsteig versuchte einer, die Aufmerksamkeit zweier auf dem Boden sitzender junger Frauen zu erlangen. Indem er sich auch auf den Boden setzte, den beiden mit der Zwei-Finger-Richtung-eigene-Augen-Geste aber vorher unmissverständlich bedeutete, ihn genau zu beobachten. Als er dann saß, klemmte er sich den rechten Fuß hinter den Kopf und begann, seine Asianudeln zu essen. Eher abgestossen als interessiert standen die Mädels auf und gingen. Enttäuscht tat er es ihnen gleich, erhob sich mit dem Bein hinterm Kopf und hüpfte ein paar unbeholfene Sätze, bis er neue Opfer fand.
Da es Sonntag war, lag der sonst sehr belebte S-Bahnhofsvorplatz ganz ruhig und friedlich in der Gegend rum, die Einkaufszentren hatten geschlossen, selbst von den vietnamesischen Zigarettenhändlern keine Spur. Bevor ich unverhofft und mit sehr mulmigem Gefühl durch ein imposantes Spalier aus Rockernazis vor ihrer Parteizentrale laufen durfte, las ich mir noch die signalrote Kundeninformation im Woolworth-Schaufenster durch. Wegen der hohen Qualitätsansprüche, mit denen giftige Farbstoffe nun mal nicht zu vereinbaren sind, werden WM-Schminkstifte zurückgerufen. Drei Wochen nach dem Finale. Nicht nur mit Dummheit geschlagen, sondern jetzt auch noch von Krebs bedroht, könnten einem fast leid tun.
Der letzte Verrückte des Tages begegnete mir auf der abendlichen Hunderunde. Gerade, als ich mir einen wirren Zettel durchlas, der behauptete, am oder im Kanal gäbe es einen MORD, und die Polizei würde natürlich nichts tun, sah ich ein paar Meter weiter einen Typen auf dem Gehweg knien und etwas auf den Boden kritzeln. Dann stand er auf, ging ein paar Meter weiter und wiederholte das Ganze. Hä? Stand auf den Kanaldeckeln, mehrfach. Als ich ihn ansprach, sah ich in seiner Tasche neben mehreren Eddings auch noch ein paar der MORD-Zettel in Klarsichthüllen. Wie, Häh? Fragte ich ihn, das interessierte mich schon. Ob ich mich noch nie gefragt hätte, was das hier sei? Antwortete er und deutete auf die Deckel. Na so Einstiege, Kanalisation und so weiter, meinte ich. Aber es waren ihm zu viele auf einen Haufen, und überhaupt. Er stelle ja nur Fragen, aber das sei doch schon alles sehr verdächtig. Sprach’s und kritzelte weiter auf die nächsten Deckel, in jede der vier Ecken ein grünes Häh?. Ich versuchte es noch mit dem Argument, dass schliesslich direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite ein Pumpwerk sei und deshalb so viele Kanäle und Deckel dazu gar nicht so ungewöhnlich in dessen Nachbarschaft, aber er liess sich nicht beirren. Ich überlegte noch kurz, ob ich ihn auf das Thema Chemtrails und was er so davon hält ansprechen sollte, ging dann aber lieber meiner Wege.
Der Wahnsinn, der mir aber viel mehr Angst macht (neben dem eigenen, natürlich), ist, dass es im nächstgelegenen Einkaufszentrum (nur wegen des Optikers, alle Jubeljahre mal), also in der Shopping Mall, jetzt eine Brow Bar gibt. Man fällt von der Rolltreppe fast drauf, könnte auch gut eine Saftbar sein, auf den ersten Blick. Aber da verdienen Menschen ihr Geld, das ihrer Chefs, der Sekretärin und die Miete für den Stand damit, vor aller Augen anderen Leuten die Brauen zu zupfen. Die einzige Kundin, die ich ausmachen konnte, trug eine dieser Porno-Jeans-Hotpants. Mit den deutlich sichtbaren Hosentaschen. Was ja eben Mode sein mag, aber auch eine Aussage in sich birgt. Vor allem, wenn dieses Hosentaschenfutter neongrün ist.
‚cause inside out is wiggida wiggida wiggida wack
* Aus einem ca. 10-15 Jahre alten Briefwechsel, als ich mit den Gepflogenheiten in Berlin noch nicht so vertraut war:
übrigens, mal kurz vom thema abschweifend: als ich noch ziemlich neu in Berlin war, fragte mich jemand in der U-Bahn, ob „Bonnys Ranch“ schon vorbei war. Ich kombinierte ziemlich schnell, dass dieser Mensch eine Station meinte, und schaute auf den Plan, der in der Bahn hing. Ich fand aber beim besten Willen kein Station mit dem Namen „Bonnys Ranch“ und zuckte mit den Schultern. Dann blickte mich der Typ an und sagte „Na du bist wohl nicht von hier, wa?!“. Als ich dann die Karte näher betrachtete, wusste ich, was er meinte: die Dietrich-Bonhoeffer-Nervenklinik. Bonnys Ranch!
** Aus einem ungefähr genauso altem Text, das Thema beschäftigt mich also schon länger:
Normalerweise wacht man dann in der Friedrichstrasse auf, zum Beispiel, weil da so viel Leute ein- und aussteigen. Und in der ganzen in den Waggon quellenden Masse sind auch immer ein paar Verrückte. Letztens war eine Frau dabei, die vor jeder Station laut und voller Überzeugung sachlich richtig die nächstfolgende Station ansagte. Man konnte das genau auf dem Display und anhand der Tonbandstimme, die Zehntelsekunden nach dem die verwirrte Frau ihr Statement beendet hatte, anfing zu scheppern, überprüfen. Komisch nur, dass die Tonbandstimme und das Display von Niemanden für verrückt gehalten wurden, schließlich hätte die verwirrte Frau ja auch das neue Kundenerfreungskonzept der BVG sein können.
Nachdem ich dann am Alex ausgestiegen bin, der wohl auch nicht mehr lange so bleibt wie er ist, nämlich ziemlich hässlich, sondern noch hässlicher werden soll, begegnen mir noch mehr Verrückte.
Ein Mann steht im Novemberwinterwetter mitten auf dem kahlen Platz, entsprechend gekleidet, also auch kahl, splitterfasernackt, und ruft abwechselnd zwei Sätze in die Rostbratwurstluft: „Ich bin Jesus“ womit er sich einig ist mit vielen anderen Berlinern, und „Kein schwuler Bürgermeister für Berlin“ – dort dürfte die Einigkeit nicht ganz so ausgeprägt sein wie bei seinem ersten Satz. Ich frage mich, ob das in anderen Großstädten Deutschlands auch so ist. Vielleicht liegt es aber auch an den Streckmaterialien Berliner zwischeninstanzlicher Drogenverschneider. Schließlich gibt es hier kaum kriminelle, also bedrohliche Verrückte, sie sind eher alle lustig, als ob sie Klone von Dieter Kunzelmann wären. Wenn man die wöchentlichen Spiegel-TV Berichte über den Drogenstandort Hamburg im Hinterkopf hat, dann ist Berlin doch ein harmloses Variete der Minderbemittelten – es wird einem ja nichts gestohlen hier, sondern eher etwas geboten.
(Die Pause geht übrigens weiter, das war nur eine kleine Unterbrechung.)
…oder bekomme ich das nur nicht mehr mit? Seeungeheuer, dackelfressende Welse und Killerschildkröten haben es schwer, wenn Kriege toben. Trotzdem, oder gerade deswegen, schliesse ich mich dem Mainstream an und mache eine (kleine?) Pause, falls sich wer fragte. Urlaub? Hahaha!
Wo Wahnsinn und Waffen so laut sprechen, sind schwer Worte und Gedanken zu finden und zu ordnen. Und überhaupt. Hier, ein Fahrrad an einer Wand: 
Gehabt euch wohl, bleibt am Leben, geniesst den Sommer.
Mal wieder einen Film abgeholt. Die Überraschung: Ich habe kein einziges Hundebild geschossen. Das ist neu.
 Rache, okay. Aber wofür? Interessante Technik, btw.
Rache, okay. Aber wofür? Interessante Technik, btw.
 Merkel, schon mal hinter Schattengittern.
Merkel, schon mal hinter Schattengittern.
 Fahrräder brennen nicht. Mopeds schon.
Fahrräder brennen nicht. Mopeds schon.
 Ganz schön schräg: Reiher auf Boje
Ganz schön schräg: Reiher auf Boje
 Ganz schön mürrisch: Reiher im Regen
Ganz schön mürrisch: Reiher im Regen
 Nazi-Schnitzerei auf Buche, ca. 1960er Jahre, Ausstellungsort Grunewald
Nazi-Schnitzerei auf Buche, ca. 1960er Jahre, Ausstellungsort Grunewald
An der Rückseite des Prinzenbads, zum Kanal hin, stehen zwei kleine Jungs und wollen ihren scheinbar frisch erworbenen Wortschatz praktisch anwenden. Jeden Tag was Neues, denk ich mir, gestern sind an der gleichen Stellen zwei über den Zaun geklettert. Die waren allerdings ein paar Jährchen älter. Deswegen wurden sie bei ihrer Ankunft auch gleich von Bahars und Lisas umschwärmt, die aber erstmal zum Mische holen geschickt wurden, weil Ali der Spast schon wieder alles weggeraucht hat.
Das einzige, was jeden Tag gleich bleibt, seit es so eine Hitze ist, sind die viertelstündlichen, genervten Durchsagen, dass das Reinschubsen und vom Rand Springen aus Unfallschutzgründen nicht gestattet ist.
Heute also das Ganze in jünger, ohne Mädchenschwarm drumherum, die sind wahrscheinlich noch eklig in dem Alter. Aber sie arbeiten schon mal an ihrem Vokabular, immerhin:
– Hat der einen Penis? Fragt der Mutigere von den Beiden.
Ich war übrigens mit dem Hund unterwegs. Deswegen – das konnte man ihnen an den verschwitzten Nasenspitzen ansehen – waren sie auch ganz froh, auf der anderen Seite des Zauns zu stehen.
– Nein, das ist ein Mädchen. Antworte ich belustigt im Vorbeigehen.
– Dann hat sie eine Muschi! Der Kleine strahlt stolz übers ganze Gesicht ob seiner Erkenntnis, der Grössere kichert sich Einen.
– Genau, gut kombiniert! Lobe ich ihn. Die Köpfe der beiden sind inzwischen so rot, wie es meine Balkontomaten wohl nie sein werden.
Prinzenbad. Der Bademeister meinte noch Die Olsenbande da hinten links kann mal bitte ganz schnell nach vorne kommen, der Hund stolperte fast über die Zunge und als wir um die Ecke rum waren musste ich immer noch grinsen.
Ick heul‘ ja immer rum, dass es viel zu viel zu lesen gibt. Deswegen wird es wohl mal wieder Zeit, diese Aussage auch theoretisch zu untermauern. Ich weiss noch nicht genau, wo dieser Text hier hinführen wird, ob ich noch zu den Grundsätzlichkeiten komme, die schon seit einer Weile danach verlangen, besprochen zu werden – jedenfalls an dieser Stelle ein kleiner Blick hinter die Kulissen des Blogs hier: Wie solche Linklisten entstehen.
Nachdem ich mit dem Lesen im Internet angefangen hatte, bemerkte ich recht schnell, dass das ewige „all die markierten tollen Blogs aufrufen, könnte ja was neues dort zu lesen sein“-Manöver sowohl die alte Kiste als auch meine Nerven arg strapazierte. Zum Glück entdeckte ich kurz darauf die rss-feed-option, macht mich schlau, was das denn sei und integrierte meine Bloglektüre erst einmal in das E-Mail-Programm: Wenn sowieso beides Teil meiner morgendlichen Routine ist, was wäre da besser, als zwei Fliegen mit einer Klappe, und so weiter?
Einiges, wie sich bald herausstellte. Denn auch das zum Feedreader hochgepushte Thunderbird trieb die alte Kiste weit über die Belastungsgrenze. Da ich mich zu dieser Zeit aus anderen Gründen zu einem Google-Account überreden liess, schaute ich mir den dort angebotenen Feedreader etwas näher an – und war dann eine ganze Weile damit sehr glücklich, bis die Oberen aus California sich dachten: Nö, woll’n wir nich mehr.
Also hiess es, sich nach einem neuen Programm umzuschauen. Ich bin generell eher ein genügsamer Mensch, deshalb war ich schon mit dem zweiten getesteten Reader zufrieden (falls es wen interessiert: rssowl). Er kommt gut klar mit den circa 350 abonnierten Feeds – ich allerdings immer weniger, schon allein deswegen, weil es kontinuierlich mehr werden. Auch wegen Linksammlungen wie dieser hier, bloss eben woanders: Beim Kiezneurotiker, bei der Ennomane, jeden Morgen bei too much information (nomen est omen) etc pp. Dabei lasse ich sogar ganze Kategorien, wie z.B. food- oder fashion-blogs, aussen vor. Dass ich inzwischen beispielsweise die tägliche Presseschau der enttäuschten Willy-Wähler von den Nachdenkseiten so gut wie immer ungelesen wegscrolle, ist da auch nur ein Tropfen auf den heissen Stein.
Mittlerweile hat sich eine Routine eingestellt, die nicht weit von der oben beschriebenen Anfangssituation entfernt ist: Kurze Texte sowie nicht allzu lange Beiträge meiner Lieblingsblogs überfliege ich im Reader. Längere oder graphisch aufwändigere Sachen schau ich mir im Original, sprich im Browser, an. Anschauen, nicht lesen, meistens. Denn die verfügbare Zeit ist schon verronnen, wenn ich mir nur den kurzen Überblick am Morgen verschaffe: Die zwei bis drei Stunden Lektüre, die früher, als die Menschen noch Briefe mit der Hand schrieben, für diverse Wochen- und Tageszeitungen draufgingen. Die langen Texte werden also erst mal wieder als Favoriten markiert, um sie später zu lesen. Wobei sich logischerweise einiges anhäuft, so dass sowohl die Kiste („Das Öffnen von so vielen Tabs könnte kritisch werden, mein Freund! Hast du auch wirklich alles gespeichert in den ganzen anderen offenen Programmen? Wäre doch eine Schande, wenn…“) als auch ich (Och nö, das sind ja schon wieder dreissig ellenlange Texte, schaff ich jetzt eh nicht zu lesen…) langsam wieder an unsere Grenzen kommen.
Falls ich es dann aber mal schaffe, die Unsortierte-Lesezeichen-Liste ansatzweise abzuarbeiten, füllt sich der Gelesene-Texte-Lesezeichen-Ordner. Der, in dem die Sachen lagern, die später mal in einer Linksammlung verwurstet werden könnten. Womit wir beim Hier und Jetzt angekommen sind.
Allerdings: Wer weiss das schon genau, das mit dem Hier und Jetzt? Zeit ist ja, selbst ohne psychoaktive Substanzen, ein durchaus dehnbarer Begriff. Schwer zu fassen. Gerne wird von den Zeichen der Zeit gesprochen, und damit meist nichts Gutes gemeint. Bei näherer Betrachtung fällt dann aber recht schnell auf, dass die Zeiten sich vielleicht ändern, die Menschen hingegegen – nun ja, eher weniger. Dafür konstruieren sie sich mit Vorliebe Geschichtsbilder, die gerade in de Kram passen. Natürlich: Geschichte wird gemacht (voran geht es dadurch noch lange nicht) – deshalb heissen Fakten (vulgo: Tat-Sachen) ja auch so, wie sie heissen.
Doch bevor das hier zu weit abdriftet, zurück zum Konkreten – wie Geschichte gemacht wird: Wie zwei Bösewichte über das too much des Bösen argumentierten (wenn man solche Kategorien mag). Wie es einem geht, wenn man erst das Kriegsrecht verhängt und auf einmal zu einer tragenden Rolle im friedlichen Wandel gedrängt wird. Ob so etwas Hoffnung geben kann, sagen wir mal angesichts heutiger Politiker? Die offen ihre Starrköpfigkeit bekennen, egal wieviele Menschenleben das kostete, kostet und kosten wird? Nur, weil es ab und an einen vermeintlichen, winzigen Lichtblick gibt?
Wirklich einfache Erklärungen greifen leider meist zu kurz. Das, was der che zum neuen Krieg in Nahost schreibt, dem Schlimmsten seit langem, würde ich trotzdem so unterschreiben. Dessen ungeachtet: Da ist Krieg, verdammt noch mal! Da sterben täglich Menschen, da fliehen täglich Menschen, weil ihre Existenz zerstört wird. Und etwas weiter nördlich ebenso. Wobei bei der mörderischen Durchsetzung des Islamischen Staates in der Levante mal wieder die Hinfälligkeit von künstlichen Grenzen klar aufgezeigt wird. Noch ein Stück weiter Richtung Nord-Nordwest wurde der Beweis ja längt erbracht: Oder besteht irgendwo begründete Hoffnung, dass die Krim an die Ukraine zurückgeht? Spricht da noch wer drüber? Stattdessen werden mitten in Europa Zivilflugzeuge vom Himmel geschossen (Der kleine Historiker in mir fragt sich, wann es so etwas das letzte Mal in Europa gab – und brauchte einen Moment, um auf Lockerbie zu kommen. Die Qualität ist aber doch eine andere, meint er.): Keiner will es gewesen sein, alle wissen aber, wer es wie mit wessen Hilfe tat. Passt ja ganz gut, so kann in der Presse von der Fussball-Kampf-Rhetorik ganz einfach auf Kriegsrhetorik umgestellt werden. Wenn man sich die Gesamtlage so anschaut, gab es in den letzten 30, 40 Jahre je mehr Instabilität um uns herum?
Nun ist – zugegeben und trotz verlogener EU-Jubiläumsbekundungen – der letzte Krieg in Europa noch gar nicht so lange her. Also sollte man wissen, wie Scheisse das ist. Oder mal einen Nachbarn fragen, einen von denen, die in Jugoslawien geboren sind, die dann aus Serbien, Kroatien oder Bosnien fliehen mussten und hier hofften, in Ruhe und Frieden leben zu können. Was ja oft klappte. Einfach mal nachlesen, wie die sich so kurz nach dem Krieg fühlten, in Sarajewo zum Beispiel. Oder man geht einfach raus, ein paar Schritte nur – und es könnte passieren, dass man beim Kaffee im Cafe Kotti in eine Sitzung des Iranischen Exilparlaments gerät. Wie ein geflüchteter jüdischer Iraner in einem linken israelischen Onlinemagazin schreibt. Verwirrende und doch grossartige Vielfalt, gleich vor der Haustür. Doch längst nicht alle haben das Glück, hier anzukommen. Zehn Prozent gehen wohl bei den Überfahrten auf den Seelenverkäufern im Mittelmeer drauf, ich hätte mit mehr gerechnet. Allerdings: Die Gefahr ist nicht nur die Passage, sondern natürlich auch der Weg dort hin, zum Hafen, zum Schiff. Nicht zu vergessen: Das ist reinste (gehobene) Mittelschicht – die Armen können sich eine Flucht schlicht nicht leisten, das war auch schon immer so.
Wer es dann trotz aller Widrigkeiten schaffte, sich hier sogar eine Existenz aufbaute und es zu einiger Berühmt- und Beliebtheit brachte, der ist noch lange nicht in Sicherheit. Selbst mit einer Heirat nicht, wenn da Bürokraten ihre Zweifel hegen.
Der Tod. Da wird es persönlich, da geht es ans Eingemachte. Gut, wenn man sich z.B. schon zur Halbzeit mal Gedanken drüber macht. Selbst, wenn die Umstände denkbar schlecht sind, kann das zum denkbar besten Ergebnis führen. Man könnte es auch Neuanfang nennen, und – schliesslich läuft gerade die Tour de France – mit Neuanfängen, Todeskampf und Grenzgängen kennen sich wenige so gut aus wie Lance Armstrong. Andererseits: Es ist ja auch nicht so, dass die Gedanken, die man sich so über das Leben macht, immer die erfreulichsten sind. Manchmal sind auch die erschreckend, und manchmal schreibt Frau Bukowsky da ganz wunderbar drüber. Womit eine wunderbare Überleitung aus eher düsteren Gefilden gebaut ist: Am Rande sei nämlich noch hemmungslos auf eine lohnenswerte Lesung im sowieso lohnenswerten Hamburg hingewiesen.
Davon kann auch Thorge erzählen, von den schönen Seiten Hamburgs. Und es kommt nur ein bisschen Fussball vor, im Gegensatz zu diesem famosen Glumm-Text. Berlin, nicht zu vergessen, mit all seiner Liebenswürdigkeit. Für die der Kiezneurotiker immer die passenden Worte findet. Schick isset hier. So wie in New York (Rio, Tokio) auch. Es geht um die Stadt, und um die Geschichten, ihre, unsere. Und bevor es zu pathetisch wird, geht das Schlusswort an Douglas Adams, mit einer wahren Geschichte.
PS. Sommerurlaubsvorschlag: Auf dem Anwesen des Chateau de Clermont nahe Nantes gibt es nicht nur schnieke Luxusappartements, sondern auch ein Louis de Funes-Museum. Nein! D…
(Die Grundsätzlichkeiten fehlen natürlich noch, und so vieles anderes hat sich inzwischen wieder aufgetürmt. Aber der Text liegt einfach schon zu lange hier rum, der muss raus. Nicht, dass der noch anfängt zu müffeln, bei dem Wetter…)
Nachtrag: Der kleine Historiker hat eine interessante Liste bei Wikipedia gefunden. Zitat: 4. Oktober 2001 – Sibir-Flug 1812: Während einer Übung der ukrainischen Marine wurde eine Zieldrohne irrtümlich mit zwei Boden-Luft-Raketen beschossen. Nachdem die Zieldrohne von der ersten Rakete zerstört wurde, suchte sich die zweite Rakete selbständig ein neues Ziel und traf eine russische Passagiermaschine.
I wish you could read this, Joe: about a
tough guy and
another guy
who just thought he was
tough.Charles Bukowski: Joe. Gargoyle #35
So verabschiedete sich der Erste von links vom Ersten von rechts. Gegen einen Truck hat niemand eine Chance, schrieb er auch noch.
Das war’s dann auch erst mal wieder zu diesem Thema. Ist halt blöd, wenn Geburts- und Todestage so eng beieinander liegen…
27.04.14
Mein Hund hat schon auf diese Wiese
geschissen,
als die Stadt die Steppe dahinter
noch nicht mal als Bauland
deklariert hatte.
Und jetzt stehst du da
in deinem millimetergrünen Vorgarten
mit nichts weiter drin
als den Grashalmsoldaten
und einem Trampolin,
für die Kinder – aber nicht zu laut!
Und willst mir irgendwas von
Kacktüten erzählen?!
Über so einen Wichser wie dich
hätte ich eigentlich jetzt in der S-Bahn
gut ein wütendes Gedicht schreiben können:
Da hast du also ganz schön Glück gehabt,
dass ich, um in Fahrt zu kommen
noch kurz den Fauser aufgeschlagen habe.
Blues für Blondinen:
Fünf Deutsche Mark, Ullstein Buch, populäre Kultur,
Mai 1984.
Aus den Kisten vor der Humboldt-Uni,
vor circa 15 Jahren gekauft
und locker drei Mal gelesen.
Alles bekannt, alles gut, so weit (ich mich erinnere).
Und dann dankt man auf der ersten Seite,
ab den ersten Zeilen von Blumen für die Mauer
seinem Kiffergedächtnis oder wem auch immer,
dafür, dass der Fauser einen immer wieder
so umhaut.
Da hast du also ganz schön Glück gehabt,
und ich eine Extrarunde auf dem Ring.
***
…aber ich bin kein netter Mensch, sondern Schriftsteller, einer der Dunkelmänner also, die beim ältesten Verfassungsschutz der Welt angestellt sind, beim Verfassungsschutz für Sprache und für Zweifel. Und natürlich: Ich bin kein Berliner. (ib.)
Ach ja, wir haben uns ja noch gar nicht gesehen. ‚Schlaand und so… Begrüsste mich der Dicke beim Getränkemarkt. Wir hatten es beide befürchtet, am Freitag.
Während er das Leergut wegsortierte, nach diesem historischen Wochenende, präzisierte er seinen Standpunkt: Ist ja alles schön und gut, jetzt haben sie ihren Titel, von mir aus auch verdient. Aber dieses ganze Geschminke und Gegröle und die Fahnen überall, damit können die ja nun langsam mal aufhören.
Ganz meine Meinung, also pflichtete ich ihm bei: Stimmt schon. Aber ich habe vorhin gesehen, dass die Franzosen immer noch Militärparaden abhalten zu ihrem Nationalfeiertag. Das ist ja auch schon krass. Stell dir das hier mal vor, Militärparade zum 3. Oktober….
Er war nicht ganz überzeugt: Ach, das nennen die nur anders. Schützenumzug oder so. Geh mal zur Fanmeile, das ist keine Militärparade, das ist schon Krieg!
(Link zum Thema: Maybe not the greatest song text in the world, but a stunning tribute)
03/06/14
Gerade kriecht die Gentrifizierung bei mir um die Strassenecke,
könnte man so sagen.
Oder man könnte sagen,
da werden ein paar neue Läden aufgemacht,
schick mit prächtigen Blumen in den Schaufenstern
und Flachbildschirmen an der Decke.
Dort wo früher ein paar alte Läden waren,
und dann gar nichts,
und dann Baugerüste.
„Hier bist du sicher.“ Meinte einer,
der schon lange im Wedding wohnt.
Hochbahn, keine Entwicklungsmöglichkeiten,
wenigstens im Umkreis von drei Querstrassen.
Und dann kommen eben diese Läden mit den
viel zu üppigen Blumensträußen im Fenster
um die Ecke gekrochen.
Und scheren sich einen Scheiss drum,
was Leute aus dem Wedding sagen.
19.07.02
Eigentlich bin ich gar nicht so schlecht im Kickern, ehrlich, das ist jetzt keine Prahlerei. Ich mache das schon eine ganze Weile. Klar, früher war ich viel besser. Da war ich noch jeden Dienstag im Bandito, bis spät in die Nacht. Oder früh in den Morgen.
Damals habe ich sogar an Kicker-Turnieren teilgenommen. Zwar nie gewonnen, aber immer im guten Mittelfeld gelandet, und das bei ziemlich harten Vorrundenspielen. Die, gegen die wir in den Gruppenspielen verloren hatten, kamen meist bis ins Finale.
Aber das ist schon eine ganze Zeit her. Jetzt kicker ich zwar auch noch ab und zu, und ich gehe dafür auch immer noch gerne ins Bandito, aber eben seltener. Man wird halt älter und gesetzter…
Vor kurzem entschieden zwei gute Freunde und Nachbarn von mir, dass sie spontan in den Urlaub fahren wollen. Und ob ich nicht einen Blick auf die Wohnung, den Briefkasten und die beiden Katzen haben könnte? Für die nächsten zwei Wochen?
Kein Problem, ist ja nur ein Stockwerk schräg über mir, und so schlimm sind die Katzen nicht. Und außerdem, das Beste an der Sache war, dass sich in ihrem Wohnzimmer ein ganz vernünftiger Turnier-Kicker-Tisch befand.
Mir wurde ausdrücklich erlaubt, diverse Bekannte einzuladen und den Kicker in Betrieb zu halten. Das hatte einige nette Kleinst-Partys zur Folge, also Veranstaltungen mit den sechs oder sieben Leuten, die es nach dem ganzen Grillzeug und Bier und Tüten noch vom Ufer des Landwehrkanals in die Wohnung geschafft haben. Dabei wurde immer auch ein wenig gekickert, aber hauptsächlich dumm in die Luft gestarrt, weitergekifft und gesagt: „Mann bin ich schon wieder dicht. Und warm ist das heute, oder?!“
Eines Tages ging ich, das Katzenklo musste sowieso sauber gemacht werden, alleine hoch. Ich dachte mir, dass ich ein wenig solo übe, demnächst sollte ein Open-Air-Kickerturnier auf dem Uni-Innenhof stattfinden. Und ich bekam langsam wieder Lust daran. Besonders, weil ich auch bei fortgeschrittener Sinnestrübung im Vergleich mit den anderen noch ganz gut spielte. Oder lag es daran, dass ich meinen Drogenkonsum mal bezüglich des Toleranz-Pegels ernsthaft überdenken müsste?
Egal, ich übte einige Schussvarianten, aus der Deckung, mit plötzlichen Abgaben und all diesen Kram. Als ich gerade dabei war, ausschließlich mit den hinteren beiden Reihen zu spielen, sprang eine der beiden Katzen auf den Tisch.
Ich bin kein grosser Katzenfreund, aber auch kein Katzenhasser. Also dachte ich: gut, die sind eh beide ziemlich allein, nimmst du mal die Herausforderung an. Die Regeln waren, dass ich wirklich nur die hinteren beiden Reihen bewegen durfte, es sei denn der Ball bleibt liegen und die Katze geht nach drei Sekunden nicht an den Ball. Aber keinesfalls einen direkten Torschuss mit der Sturmreihe! Gespielt wird bis sechs, Einwurf in der Mitte und wenn der Ball rausspringt gibt`s Ecke. Zwei Gewinnsätze sind nötig. Der Ball ist erst drin, wenn er nicht wieder rauskommt. Kurbeln ist verboten. Zwei Abstand. Wer zu null verliert, gibt entweder Einen aus oder kriecht unter dem Tisch durch.
Die Katze war soweit einverstanden mit den Regeln.
Nach dem Spiel überlegte ich lange, ob ich wirklich bei dem Open-Air-Kickerturnier mitmachen sollte. Und ich dachte auch darüber nach, ob ich, wenn ich teilnehme, die Katze als Partner mitnehme, sie war im Sturm wirklich gut. Das Ergebnis war 6:3 und 6:4.
Für die Katze.
03.07.14
Da stehe ich nun,
gegenüber das Haus, in dem ich mal wohnte:
Unten immer noch die Kneipe drin,
und die Arschlöcher stellen immer noch
Stühle direkt vor die eh schon viel zu schmale
Haustür.
Ich betrete den Laden, schau mich kurz um:
Der Verkäufer linst fragend über die halbe Brille.
Drecksack! Sage ich, laut und deutlich.
Und bekomme, wonach ich verlangt.
Unbedingt weiterempfehlen! bittet er mich noch.
Voilà!
Ich halte Werbung ja für eines der Grundübel unserer Zeit. Dabei war das mal ein schönes Wort (bzw. schöne Tätigkeit), auf das Zwischenmenschliche bezogen. Wie aber nennt man nun das hier, wo ich unzweifelhaft für etwas werbe, jedoch ohne Wissen & Auftrag der Beworbenen?
In der Alte-Texte-Schublade bin ich fast ganz unten angekommen, rein chronologisch gesehen. Über andere Bedeutungen von „ganz unten“ müssen sich andere Leute Gedanken machen. Jedenfalls: Lange ist es her, es gab noch keine Hipster, aber schon Club Mate. Und man erinnerte sich noch an den Neuen Markt (TM).
29.09.02
Wir waren Kilometer 20. Ich hätte es vorher wissen können. Doch erst als es dann frühmorgens um 7.45 Uhr soweit war, drang es wieder schmerzlich in mein Bewusstsein.
Am Abend zuvor waren wir zum wiederholten Male auf einer Lesebühnen-Poetry-Slam-Veranstaltung. Ich weiß, dass man da eine genaue Trennung vornehmen kann und muss. Aber dieses Mal eben nicht. Die Big Player der Berliner, ach was sag ich, der deutschen wenn nicht gar der europäischen Szene hatten sich versammelt. An einer wirklich hippen Örtlichkeit. Hip deswegen, weil die Location, wie man so sagt, unverbraucht ist. Jeder Veranstaltungsort, ist er noch so gut, wird irgendwann zur Gewohnheit.
Diesmal versammelte man sich in der Backfabrik.de. So stand es tatsächlich in der Zitty. Auf dem Grund und Boden befand sich früher ein DDR-Backkombinat. Der Charme der Geschichte, in Berlin bei der Auswahl des Auftrittsortes immer wichtig.
Die Ossi-Bäckerei wurde geschlossen, schließlich wollten ja auf einmal alle nur noch Fladenbrot essen. Und das muss laut Innungsvorschrift in Kreuzberg gebacken werden.
Kurz nachdem ein verrückter Künstler dann eine Kuh vom Kran in den Hof des ehemaligen Backkombinats geschmissen hat kam der Bagger. Kurz danach, nicht weil. Vorher residierte noch kurz das Casino auf irgendeinem der vielen Hinterhöfe. Und dann wie gesagt die Bagger. Davon sieht man in Berlin inzwischen ja auch viel mehr als Trabbis, zum Beispiel.
Als alle in den neuen Markt, der sich ja jetzt verabschiedet hat, investierten, dachte sich ein geschäftstüchtiger Mann, dass dieser Platz, denkt man sich die explodierten Rinderinnereien mal weg, prädestiniert zum Geld drucken ist. Aber auch das Geld wird ja schon in Kreuzberg gedruckt, in der Bundesdruckerei, also baut man eben die Backfabrik.de.
Nur mit diesem Namen brauchte man damals, als Leute ihr Geld in Firmen wie XYZmedia nur wegen des Wortes ´media´ steckten, zur Bank gehen, und man wurde unter einer Mille nicht rausgelassen. Also Keller erhalten, Gebäude entkernen, Rigipswände einziehen, wireless lan mit einer 800-Meter-Reichweite einrichten und einen hippen Namen mit Ostbezug.
Nun gibt es den Neuen Markt nicht mehr, und somit auch keine Neuer-Markt-Start-Ups, die ihr Head Office hier wirklich passabel hätten eröffnen können.
Doch der Keller war noch da, und gestern in dem selbigen diese famose Veranstaltung. Berlin ist nicht nur mit supertollen Schliemann-sei-Dank-Museen die heimliche Kulturhauptstadt Europas, sondern auch die Subkultur-Hauptstadt. Man kann jeden Tag zu mindestens zwei Lesebühnen gehen, die sich alle, zumindest gefühlt, im Prenzlauer Berg befinden. Und nun war also das Gipfeltreffen, sozusagen.
Nicht nur, dass sich all diese Bühnen einigten und ihre Star-Interpreten losschickten, es gab auch Unterstützung von ganz oben. Zitty, wie schon erwähnt, sponserte den Abend, aber auch Radio Fritz und lcb. Ich dachte mir, dass dies eine subversive Vereinigung dilettantischer Literaten wäre. Immerhin heißt der Szene-Einkaufsladen hier ja auch KGB, was für „Kohlen Gips Bier“ steht. Wovon es aber höchstens Bier dort gibt. Ökologisch gebraut. Und Fahrradanhänger zum Ausleihen. Und Club-Mate.
Aber lcb, was mich irgendwie gleich an ocb denken ließ, steht für literarisches colloquium berlin. alles kleingeschrieben. Aber etabliert. Und die fördern mit ihrem Geld solche Sachen. Wo Leute Ficken sagen. Mehrmals pro Satz. Oder nur als Satz allein. Wo Leute stockbesoffen auf der Bühne stehen, zittern, fast runterfallen, sich nicht mehr artikulieren können. Und das Publikum nimmt dies hin, will es hinnehmen, als Performance, nicht etwa als Realität der Auswirkungen des Giftes Alkohol. Lieber noch schnell einen lustigen Text über spanischen Absinth anhören.
Um zwei Uhr nachts, relativ früh eigentlich, waren wir dann zu Hause. Beim Einparken achteten wir penibel darauf, dass wir das Auto auf unserer Seite der Straße abstellten, die andere Seite war schon komplett gesperrt. Bis auf einen Opel-Astra-Bullenwagen mit innen Licht an total leergeräumt.
Ich musste dann noch mal mit dem Hund runter. Ging über die Straße und fragte die Freunde und Helfer, ob das okay ist, auf unserer Seite zu parken. Ohne ob meiner Alkohol-Fahne oder besser -Flagge stutzig zu werden, sagten sie mürrisch: „Ja, drüben schon.“ und nahmen die St.Pauli-Nachrichten wieder vor die nächtlich aufgesetzte Sonnenbrille. Deswegen also die Innenbeleuchtung. Ich fragte sie, ob sie jetzt hier die ganze Zeit stehen würden. „Na klar, Streckenüberwachung“.
Das war erste Mal, dass mir Vertreter dieses Berufszweigs fast leid taten. Wann es denn los gehe, fragte ich. „Naja, wir sind hier fast jenau Kilometer zwanzig, da wern die ersten wohl so jegen zehn kommen.“
Doch inzwischen, und das habe ich eben heute wieder schmerzlich erfahren müssen, laufen beim Berlin-Marathon nicht nur dank modernster Laufschuhtechnik leisetreterige Profisportler samten über den Asphalt. Vorneweg kommen circa 8.000 Rollerblader. Zu schwach auf der Brust um 42 Kilometer zu laufen. Aber laut genug, um mich mit einem Höllenlärm-Surren zu wecken. Um 7.45 Uhr.
28.10.08
Du denkst,
du hast zu wenig Gras,
um was zu schreiben.
Nämlich gar keins.
Du schaust dir
diese verdammte neue Serie
mit Mulder an.
Der jetzt Hank heisst.
Natürlich, wie sonst.
Du denkst,
die Sache mit dem Schreiben
ist vorbei.
War nur eine Phase.
Ist vorbei.
Hast es verpasst.
Hast zu viele gute Bücher,
Filme,
Musik,
verpasst.
Wenn es hochkommt,
liest du die Wochenzeitung
zur Hälfte durch.
Machst deinen Job,
liebst deine Frau,
(doch du fickst sie nicht mehr)
gehst am Wochenende saufen.
Wenn es hochkommt
verliebst du dich mal kurz.
Doch du streitest es ab:
Du küsst sie nicht,
du schreibst nicht,
du kündigst nicht.
Du lebst dein braves Leben,
träumst deinen wilden Traum,
und denkst
es ist eh
zu spät.
Du bist zu alt,
du bist zu schlecht,
du bist doch
ganz zufrieden.
Und sitzt dann trotzdem nächtelang
wach.
(Schaust dir diese verdammte Serie
mit Mulder an.)
Du schreibst, du säufst, und du weißt,
dass es nicht stimmt.
Jetzt ist halt kein passender Zeitpunkt,
erst in zehn Jahren
oder so,
wenn du noch viel selbstmitleidiger bist.
Bis es dir hochkommt,
irgendwann.
Irgendwie aus aktuellem Anlass.
„Und dann haben die mir erzählt, dass diese eine Reporterin da…“
„Katrin Müller-Hohenstein..“ Es gibt schliesslich gerade nur eine weibliche Reporterin da, soweit reicht mein Fussball-Sachverstand.
Mein Nachbar, der unamerikanischste Ami, den man sich vorstellen kann, war dankbar für das verbale Unter-die-Arme-greifen. Auf den Namen wäre er nie gekommen, meinte er, ausser wenn es um Loriot-Zitate gegangen wäre vielleicht.
„Genau, Müller-Hohenstein. Also, die haben mir erzählt, dass die mal…“
„Innerer Reichsparteitag“ sagte ich. Unterbreche ich meine Gesprächspartner eigentlich zu oft?
„GENAU!“ Mein Nachbar schien ehrlich empört. Zur Abwechslung probierte ich es mal mit Zurückhaltung und schwieg. „Wie kommt man denn auf sowas?! Und wieso arbeitet die noch da? Ich meine, die ist doch höchstens 45, wie kommt die auf SOWAS?“
Ich versuchte mich in Erklärungen. Erzählte irgendwas von männerbündnerischen Lokalblattsportredaktionen, in denen solche Floskeln bis in die 80er wohl zum Basisvokabular gehörten und wo Frauen es wahrscheinlich sowieso nicht leicht hatten, sich ihre ersten Sporen zu verdienen. Nebenbei streute ich die Schalke05-Anekdote ein und berichtete von Anne Wills Anfängen – aber: Eine Antwort konnte ich ihm nicht geben.
…denke ich, und dann lasse ich die noch offenen Tabs vor meinen Augen vorbeifliegen. Immer noch über 30. Ganz schlechte Idee. Nebenan, im Kohlenstoffleben, machen die Grünen endgültig klar, warum es ein Fehler war, sie zu wählen. Schon immer. Uli Zelle berichtet natürlich live aus dem Berliner Gefahrengebiet. Ärgerlich und absurd.
Fußball-Fifa-WM. Hm. Kommt man nicht drum rum, also ich nicht. Hab ich früher schon mal was drüber geschrieben, erspare ich der geneigten Leserschaft aber lieber. Erspart habe ich mir bisher auch das Rudelgucken, zum Glück kenne ich niemanden, der mich dazu überreden wollen würde. Vielleicht mal ins Yaam, obwohl…
Und wieder: Was bin ich doch für ein Hipster: Mein erstes Public Viewing war zur EM 1996. Circa 20-50.000 Leute. Roskilde-Festival, wo wir immer mindestens zwei Tage vor Festivalbeginn eintrudelten, schon allein wegen des obligatorischen Abstechers nach Christiania. Und deshalb in freundlicher Atmosphäre die Halbfinals auf der orangenen Bühne sehen konnten, wenn ich mich recht erinnere. Vorbei, lange, lange her.
Zu allem Überfluss wurde gerade das Nebenhaus eingerüstet und der Putz wird abgekloppt. Feine Staubschichten überall auf dem Balkon. Ich glaube, selbst in meinem Kopf. Besser aufhören.
18.10.03
Es war ein sonniger Herbstnachmittag, ein Sonntag, und die Luft schmeckte schon ein wenig nach dem Schnee, der bald fallen würde. Der junge Dichter mit dem blumigen Namen stand auf seinem Balkon und ließ sich die Nase ein letztes Mal von der Sonne kraulen. Er beobachtete das Geschehen unten auf der Strasse, das machte er ganz gerne, und sonntagnachmittags ist es auch nicht ganz so laut, es fahren nur wenige Autos. In solchen Momenten kommt der junge Dichter oft ein wenig ins Sinnieren.
Darüber, wie es wohl früher gewesen sein mag auf diesem Balkon. Als das Haus, in dem er wohnte, noch frisch gebaut war, und nicht am Zerbröckeln wie jetzt. Als die Straße unten noch eine Prachtmeile war. Als sie noch nicht zur bloßen Asphaltdecke degradiert, sondern stolze Pferde ebenso stolze Herrschaften auf ihr durch die Gegend kutschierten. Als der heruntergekommene U-Bahnhofsvorplatz um die Ecke noch Belle-Alliance-Platz hieß und auch dementsprechend daherkam.
Nun ja, es war nicht mehr wirklich die allerbeste Gegend hier, gut. Aber so schlimm, wie oft angenommen und bevorurteilt, war es auch nicht unbedingt. Das dachte der junge Dichter jedenfalls bisher. Als er allerdings das Tagträumen für einen Augenblick unterbrach, um zwei hübschen jungen Damen hinterherzuschauen, die eine Spur zu offenherzig gekleidet waren, sah er, wie vor der Toreinfahrt seines Hauses ein Fahrzeug versuchte, einzuparken. Es gelang mehr schlecht als recht, die Hälfte des Autos verblieb auf der Fahrbahn. Zum Glück war Sonntag.
Der junge Dichter konnte zuschauen, wie sich die Heckklappe des etwas lädiert aussehenden Wagens öffnete und jemand von hinten aus dem Auto gekrabbelt kam. Bei näherer Betrachtung erschien das dem aufmerksamen Beobachter auch nicht weiter verwunderlich, da alle anderen Sitzmöglichkeiten in diesem Fahrzeug schon mehr als belegt waren.
Das erklärte wohl auch das etwas mitgenommen wirkende Äußere des Gefährts, denn auf Dauer ist eine derartige Überladung für den Wiederverkaufswert nicht gerade förderlich. Den inzwischen auf dem Bürgersteig angekommenen entstiegenen Passagier schien das freilich nicht allzusehr zu interessieren. Im Gegenteil, er bekam aus dem heruntergekurbelten Fenster der Beifahrertür einen Briefumschlag gereicht, der einen prallen Eindruck machte. Und tatsächlich breiteten sich unzählige Fünfziger aus, als der ehemalige Kofferrauminsasse den Inhalt nochmal kontrollierte. Geldsorgen schienen hier also nicht zu herrschen, was den jungen Dichter, der langsam anfing, zu frösteln, doch ein wenig misstrauisch machte.
Der Balkon, der eigentlich eine Loggia war, was der auf ihm stehende junge Dichter aber trotz seiner sonst umfassenden Allgemeinbildung nicht wusste, konnte von dem dubiosen Gefährt nicht so gut eingesehen werden wie umgekehrt, daher war der heimliche Beobachter bisher unentdeckt. Was ihm auch ganz recht war, da ihm die Vorgänge dort unten auf der Straße langsam aber sicher etwas unheimlich wurden.
Der inzwischen mit den Geldscheinen ausgestattete Handlanger verschwand in einem der nächsten Hauseingänge. Das übrige schätzungsweise halbe Dutzend Fahrzeuginsassen rührte sich nicht. Das Gefährt allerdings schon, der Motor lief ununterbrochen, das Auto dampfte. Die kalte Jahreszeit brach wirklich langsam an. Einige Minuten später erschien der Umschlagträger wieder auf der Bildfläche, diesmal allerdings mit einer braunen Schnellimbiss-Tüte. Der junge Dichter wusste nichts von einem Schnellimbiss hier in der Gegend, vor allem nicht von einem so teuren, denn der Briefumschlag war weg.
Nachdem er die Papptüte durch das immer noch heruntergekurbelte Beifahrerfenster gereicht hatte, nahm der Bote wieder seinen Platz im Kofferraum des Fahrzeugs ein. Der junge Dichter ging das Wagnis ein, seine Position ein wenig zu ändern und damit zwar sichtbarer zu werden, aber eben auch sehender. Ihn interessierte schon sehr, was das denn für vorzügliche Hamburger sein würden, die es wert waren, gegen so viel Geld eingetauscht zu werden.
Es überraschte ihn nicht wirklich, als er sah, dass der Inhalt der Tüte nicht zum Verzehr bestimmt war. Es handelte sich dabei um einen mit zwei roten Gummibändern zusammengehaltenen Stapel Pässe. Der Fahrer, dessen tätowierter Arm jetzt zu erkennen war, riß das Bündel achtlos auseinander und warf einen kurzen Blick auf die wichtigsten Seiten in jedem der Dokumente. Das Ergebnis schien zufriedenstellend, die Reisepässe wurde nach hinten gereicht zu ihren neuen Besitzern und dem Motor wurde endlich eine Beschäftigung gegeben, dass er vor Freude die Reifen quietschen liess. Der junge Dichter blieb etwas ratlos zurück auf dem Balkon, der eigentlich eine Loggia war, und dann verschwand zu allem Überdruss auch noch die Sonne hinter dem Haus schräg gegenüber.
Gut – wenn die Anonymität, die Verwahrlosung der Großstadt dazu führt, dass am helllichten Tag vor seiner Haustür Geschäfte mir gefälschten Papieren gemacht werden – nur zu, darauf wüsste er eine Antwort zu geben! Eigentlich saß er gerade an einem naturwissenschaftlichen Projekt. Seine Aufgabe, die er sich übrigens selbst gestellt hatte, bestand darin, herauszufinden, was das Äquivalent eines durchschnittlichen Menschen, er hatte mal sich selbst als Exempel genommen, in Rekord-Briketts ist.
Die Ausgangsüberlegung war, dass ein Mensch mit seinen 37 Grad Celsius Körpertemperatur ja auch ein enormer Wärmespender sein müsste, da er über die Körperoberfläche gezwungenermassen auch Wärme abgibt, nach den Recherchen des jungen Dichters circa ein Watt pro Kilogramm Körpermasse. Und in einer Wohnung mit Kohlenheizung, wie sie sich gerade hinter ihm auftat, hinter der für jede Art von effektiver Heizbemühung völlig unzureichenden Holzdoppelbalkontür, kommt man schnell mal auf den Gedanken, auszurechnen, wie viele Zentner Kohlen man über den Winter mit seiner bloßen Anwesenheit spart. Mit dem Ergebnis dieser Untersuchung wäre es dem jungen Dichter auch möglich gewesen, den fiskalischen Vorteil auszurechnen, den ihm die Anwesenheit seiner Freunde, die jeden Abend uneingeladen vorbeischauten, verschaffte.
Aber dann eben nicht. Wenn solche Möchtegerngangster vor seiner Tür Geschäfte abwickeln, dann musste er reagieren. Wenn die Metropole ihre Krakenarme auf diese Tour in seiner Strasse ausbreitet, dann musste er zurückschlagen. Die Frage war nur: wie?
Er würde mit der U-Bahn fahren. Er würde sich in jedes in öffentlichen Verkehrsmitteln geführte Mobiltelefongespräch einmischen. Er würde offensiv die Zeitung seines Sitznachbarn lesen. Er würde ihn anstarren, wenn der Zeitungsbesitzer seine Rolle versuchen würde klarzustellen. Wenn dieser dann verschwunden wäre, was so ein behornbrillter vierzigjähriger anzuggrauer Angestellter wohl ohne Zweifel tun würde, dann würde sich der junge Dichter quer über die Sitzbank fläzen. Jede alte Dame, die ihn sitzplatzheischend anschauen würde, wird nichts als einen kaltstechenden Blick ernten.
Der junge Dichter würde jedes turtelnde Pärchen, das sich auf den ewiglangen U-Bahn-Rolltreppen nebeneinander lediglich fortbewegen lässt, ohne Hemmungen anschreien, dass sie sich gefälligst hintereinander zu stellen haben, es ist ja schließlich nicht jeder Student und hat so viel Zeit!
Er würde jedem Kind, das zusammen mit seinen zwei Geschwistern, seiner jungen, glücklichen Mutter und deren ebenfalls dreifach bekinderten Freundin unterwegs ist, dringend davon abraten, mit den dreckigen Gummistiefeln an seine Hosen zu kommen. Jedem anderen Kind, vorzugsweise in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, natürlich auch. Denn falls auch nur ein Krume feuchten steuerfinanzierten Kinderspielplatzbuddelkastensands seine Beinkleider berühren sollten, würde er sich nicht scheuen, die versammelten Bälger in aller gebotener Deutlichkeit über die Erziehungsunfähigkeit ihrer Eltern zu informieren. Und ihnen eine Tracht Prügel anzudrohen.
Der junge Dichter mit dem blumigen Namen würde im nächsten Sommer mit einem Nikolauskostüm bekleidet versuchen, den Prenzlauer Berg mit einem Schlitten herunterzurodeln. Er würde auf den Bahnhof Zoo gehen, warten bis die BGS-Büttel in seine Nähe gekommen sind, um dann empört dem nächstbesten vorbeihastenden Yuppie anzubrüllen, dass er auf keinen Fall irgendein Scheisskoks haben will. Er würde besonders vor Schulklassen und Kindergartengruppen stets versuchen, bei rot über die Ampel zu gehen.
Da sollte dieser Scheissmoloch von Grossstadt mal überlegen, mit wem er sich da anlegt.
Eine miese Woche, eine von den üblichen miesen Wochen, kein großes Ding.
Das Wetter passte gut dazu. Praktischerweise.
Beschissen, verkackt: Kann man schon sagen, auch wegen des Gasthunds,
der auf Kurzurlaub hier war (und natürlich auch toll ist, obwohl jedes Sirenengeheul beantwortet wird);
eine Weile alleine – also zu zweit – gelassen und geplündert, was es so zu plündern gab.
Die Bescherung kam später,
dann im Zweistundenrhythmus.
Viel zu wenig Schlaf,
viel zu wenig Zeit,
viel zu viel zu lesen,
viel zu viel Blues.
An Schreiben gar nicht zu denken;
wenn überhaupt mal kurz alte Texte durchgehen,
sie erst fast gut genug,
beim zweiten Mal aber schrecklich finden.
Es nicht mit Fassung tragen können.
Auch, dass Kriegshetzer bloßzustellen
jetzt schon für Nazivergleiche taugt.
Immer noch und immer wieder entsetzt.
Und auf einmal kam dann doch
die Sonne wieder raus, mehr Zeit auch.
Perfekt für den Wald,wo ungelogen
inmitten der Bäume zwei Leute Saxophon spielten.
(auld lang syne)
Schonmal nicht schlecht.
Aber erst, als ich noch mal widerwillig los musste,
und erkannte, dass mir gegenüber an der Ampel wartend
die von mir am meisten bewunderte Kreuzberger Nachbarin
(Sängerin, Dichterin, Hippiegöttin)
fröhlich mit ihrem Kind im Lastenfahrrad ansteckend scherzte;
da wusste ich: doch keine so miese Woche, doch eigentlich ganz schön hier.
Okay, vorläufig die letzte Wortmeldung zum Thema, das nahm ja ein wenig überhand hier in letzter Zeit, aber das muss ich dann doch noch loswerden: Es gibt ja diesen Bilderwitz in diesem Internet, mit der Musikkasette und dem Bleistift – „wer weiss, wie das beides zusammen passt, ist alt“ – oder so ähnlich.
Passend dazu: Nun ist der Vorteil der wieder aufgenommen Analogfotografie, dass man am Ende des Films ein kleine, praktische Filmdose übrig hat. Eine wirklich sehr praktische, if you know what I mean. Nudge, nudge.
Voila, Film Nummer soundso:
Nein, im Grunewald gibt es keine Löwen. Nur Wurzeln, die sich als solche tarnen:
An der Krummen Lanke war wohl die Jugendantifa unterwegs, mit weißer Farbe:
…und sie haben die Känguru-Chroniken gelesen, löblich…
(usw. Beschriftetes rundes Holz ist gar nicht so einfach zu fotografieren…)
Flaschensammelkorb (ohne Flaschen):
Flaschensammelkorb (mit Flaschen):
Diese Flieger hab ich schonmal irgendwo gesehen. Am nächsten Tag waren sie weg.
Der Staat ist schuld, klar.
01.03.03
Ich traf Peter oberhalb des Wasserfalls bei Watervaldrif. Peter Kraus, wie dieser unsägliche Schlagersänger, so stellte er sich vor. Das Wasser stürzte unter uns sechzig Meter in die Tiefe. Unten sammelte es sich in einem Becken, in dem man wunderbar schwimmen konnte. Die Wassertemperatur war angenehm niedrig, da das Tal unten sehr eng war, also den ganzen Tag lang schattig. Das bewog uns auch gestern dazu, hier hoch zu klettern. Weil John, der Besitzer des Backpackerhostels sagte, dass wir, falls wir den Wasserfall besuchen würden, unbedingt dort hin klettern sollten, wo er anfängt. Also hoch auf den Berg.
Das taten wir dann auch, und als wir oben ankamen, wurden wir dafür reich belohnt. Der Fluss, der hier in die Schlucht hinunter stürzte, tat dies nämlich nicht am Stück. Er sammelte sich, vielleicht vor Schreck oder zur Erholung, nach vier Metern erst noch mal in einem kleinen Pool. Und dieser war im Gegensatz zu dem Bassin unten fast den ganzen Tag in der Sonne. Und sehr einsam. Gestern waren wir ganz allein dort oben. Wir tauften die Klippe, auf der wir kampierten, „Fanta Rock“, da eine Softdrinkdose gleichen Namens uns verriet, dass wir nicht die einzigen waren, die diesen wunderbaren Ort aufsuchten.
Heute allerdings wollte G nicht mitkommen, der Aufstieg schien ihm zu lang für den Genuss, in den man kommt, wenn man in dem kleinen Pool badet, mitten in der vermeintlich ungestörten Natur. Das war übrigens der zweite, unausgesprochene Grund, der ihn dazu bewog, heute in der Herberge zu bleiben: Die Natur. Wir hatten uns gestern leichtsinnigerweise mit den normalen Trekking-Sandalen auf den Weg gemacht, und zwar ganz untypisch für deutsche Touristen ohne weiße Tennissocken. Als wir dann abends am Grillfeuer darüber nachdachten, wohinein wir fast barfuss getreten wären, wurde uns schon etwas mulmig. Schließlich gibt es hier in der Gegend Kobras, die sich mal eben auf 1,80m aufrichten und einem ihr tödliches Gift über eine Entfernung von anderthalb Metern direkt ins Gesicht spucken. Da hilft zwar festes Schuhwerk auch nicht viel, aber trotzdem, schließlich bleiben ja noch ein paar gefährliche Spinnen und Skorpione übrig.
Also blieb G in der Stadt. Ich allerdings wollte noch mal zurück zum „Fanta Rock“, und so schnappte ich mir ein Fahrrad und fuhr zum Wasserfall. Und als ich dann den Aufstieg gemeistert hatte, lag Peter auf dem Felsen in der Sonne, das nasse gelbe Handtuch neben ihm verriet, dass er auch schon die Vorzüge des Pools genossen hatte.
Nach ein paar bruchstückhaften englischen Konversationsbrocken bemerkten wir, dass wir beide Deutsche waren. Als ich ihn fragte, was er so machte, antwortete er „Gras schmuggeln“. Ich weiß nicht genau, ob es mein Äußeres war, das ihn zu dieser unverblümten Antwort verleitete. Also fragte ich nach. „Das ist eine lange Geschichte mein Freund!“ antwortete er, und da er scheinbar davon ausging, dass ich Zeit hätte, bröselte er schon einmal ein bisschen Tabak in ein Blättchen. Weil der Tag noch frisch war, und mich die Geschichte interessierte, ging ich darauf ein.
„Es hat alles mit einer Home-Shopping-Sendung angefangen. Ich hatte gerade was geraucht, und danach schaute ich mir ganz gerne so einen Scheiss an, das war das richtige Niveau. Ich dealte ein wenig herum, so an Freunde, da kam nicht viel bei rum. Auf diesem Einkaufskanal jedenfalls vertickten sie gerade ein Vakuum-Einschweißgerät. Die Leistungsfähigkeit dieses Teils demonstrierten sie daran, dass sie circa 60-80 Coladosen in so eine Tüte steckten, und mit der Kraft der Vakuumpumpe wurden sie nicht nur luftleer versiegelt, sondern natürlich auch, mit einem Physik-Leistungskurs-Abitur sollte man das wissen, zerquetscht.“
Peter holte ziemlich weit aus, eigentlich wollte ich ihn fast unterbrechen, da ich ja hier her gekommen war, um zu baden, doch der erste Zug von seiner Tüte, die aus Manna-Gras zu bestehen schien, überzeugte mich, noch eine Weile (oder für immer, wieso eigentlich nicht….) auf der Klippe liegen zu bleiben, so dass ich ihm also noch gut weiter zuhören konnte.
„Das war jedenfalls das, was mir fehlte, es fiel mir wie Schuppen von den Augen.“ fuhr Peter fort. „Nach zwei Jahren Kleindealerei bekommst du schon irgendwie die typische Dealerparanoia. Es könnte ja doch mal passieren, dass die Bullen kommen und deine Wohnung durchsuchen, zumal du in einem stadtbekannten autonom verwalteten Hausprojekt wohnst. Ab einer gewissen Menge sollte man sich darüber mal einen Kopf machen. Und der tollste ZipLoc-Beutel kann eine Spürhundnase nicht täuschen. Aber so ein Vakuumpumpgerät, das 80 Coladosen zerquetscht und nur 230 DM kostet, das wär doch was. Weil ich bekifft war, dachte ich kurz darüber nach, ob dieses Angebot nur eine Falle der Bullen für paranoide Kiffer sein könnte, und die Staatsmacht dann bei jedem, der sich dieses Gerät kaufte, eine Hausdurchsuchung macht, die Adressen bekommen sie ja durch die Bestellung sozusagen frei Haus, aber diesen Gedanken verwarf ich ganz schnell. Schließlich hatte ich schon viel zu viel Geld rausgeschmissen, weil ich meine Elektropräzisionswaage aus verschwörungstechnischen Paranoia-Gründen im Fachhandel gekauft habe und nicht um die Hälfte billiger im Internet. Also bestellte ich das Vakuum-Verschweißgerät, und ein paar Tage später kam es dann auch per Post. Ich probierte es an allem möglichen aus, und natürlich auch gleich mit dem Gras. Und es funktionierte wunderbar. Ich hätte mir ein Kilo Gras umschnallen, zum Polizeirevier laufen und nach einer Besichtigung der Spürhundstaffel bitten können und mir wäre nichts passiert.“
Ich erinnerte mich daran, wie mein Dealer zu Hause immer mit endlos verpackten Plastiktütenbündeln ankam, die trotzdem zehn Meter gegen den Wind stanken, und konnte Peter nur beipflichten. Das wusste er zu honorieren indem er mir den letzten Rest der Tüte überließ und fortfuhr zu erzählen:
„Nachdem ich eine Weile ziemlich stolz auf meine neue Verpackungsmethode war, wurde ich ein wenig unzufrieden. Ja, ich machte dadurch auch ein bisschen mehr Kohle, weil ich jetzt risikofreudiger war. Deshalb konnte ich mir einen netten Urlaub leisten. Ein Freund von mir schwärmte mir von diesem Land hier vor, und da es sich ganz nett anhörte, spendierte ich ihm als eine Art Fremdenführergage den Flug, und wir hatten eine sehr gute Zeit. Vor allem, da das Gras hier so billig war. Ich meine, wenn es für uns als Touristen eine Mark kostete, damals vor der Euro-Umstellung, was würde es dann im Großeinkauf kosten? Eines Tages kamen wir hierher, und durch einen netten Einheimischen erfuhren wir, dass es schon ohne Touri-Aufschlag bei dreissig Pfennig für mittelkleine Mengen lag. Natürlich denkt jeder darüber nach, wenn er die Preise für die Drogen vor Ort erfährt, wie schön es doch wäre, wenn man das importieren könnte. Aber spätestens wenn man an die Grenzkontrollen denkt, verflüchtigt sich dieser Gedanke wieder. Spürhunde und Durchsuchungen.
Da ich dank meiner Vakuumpumpe vor den Spürhunden keine Angst mehr hatte, dachte ich weiter. Es ist ja allgemein bekannt, dass ein einfacher doppelter Boden nichts mehr hermacht. Ich habe Geschichten gehört, dass Leute von Holland Gras geschmuggelt haben, indem sie es in den Reifen ihres Autos versteckt hatten. Die Bullen, die hinter ihnen fuhren, fanden den Geruch nach einer Weile komisch und hielten sie an. Naja, und was passiert dann erst an Flughäfen oder per Schiff?
Ich überlegte eine Weile, wie man das Gras tarnen könnte, gut verpacken und so weiter. Ich dachte an Autos. Erst vor kurzem hatte ich zufällig einen Oldtimerhändler besucht, der die Karren unendlich billig und dazu durch das trockene Klima sehr gut erhalten verkaufte. Und da er hauptsächlich europäische Kunden hatte, kannte er sich ganz gut mit der Verschiffung aus. Also dachte ich, kauf ich mir einen Oldtimer und packe ein paar Kilo Gras rein. Aber da ich ja das Auto danach auch weiterverkaufen wollen würde, dürfte ich nicht viel dran schrauben. Von den unterschiedlichen Gewichten auf dem Papier und in real mal ganz zu schweigen. Wenn man näher drüber nachdenkt, ist Schmuggeln echt schwierig. Du musst ein gutes Versteck finden. Das ist so ein Auto nicht, trotz jeder noch so guten Vakuumpumpe.
Am nächsten Tag besuchte ich mit meinem Fremdenführer-Freund einen kleinen Markt. Dort gab es neben Obst und anderen Lebensmitteln auch den typischen Schnickschnack. Für Touristen angefertigte Kunstgewerbegegenstände, in den Townships hergestellt, meist aus Müll. Flugzeuge aus Coladosen zum Beispiel. Und diese Coladosen ließen mich wieder wehmütig an meine Schmuggel-Idee denken, die ich aufgrund der Unwägbarkeiten schon fast aufgegeben hatte. Fast. Denn beim Anblick der Propellerdinger aus Weißblech kam mir der entscheidende Einfall.
Ich konnte es kaum erwarten, wieder zurück nach Deutschland zu kommen und alles in die Wege zu leiten. Mein Begleiter war nicht ganz so euphorisch von der Idee, weil es ja doch ein gewisses Risikopotential barg, illegale Drogen zu schmuggeln, doch er war bereit, mitzumachen. Wir versicherten uns der Unterstützung unseres neuen Freundes, der meinte, er könne uns jede beliebige Menge besorgen, seine Familie sei seit Generationen sozusagen hauptberuflich in der Branche tätig. Wir recherchierten noch ein wenig, knüpften weitere Kontakte, notierten alles was wir brauchten, und nahmen den nächsten Flug zurück, in der Vorfreude auf unseren baldigen Besuch hier.“
Ohne ein weiteres Wort zu sagen stand Peter auf, nahm Anlauf und sprang in den Pool. Er verstand es, die Spannung zu halten, dachte ich. Als Antwort darauf und um die Spannung ein wenig rauszunehmen fing ich an, die nächste Tüte zu bauen. Als ich das Werk vollendete, ging ich zu dem Steinvorsprung, an dem sich Peter gerade hochzog, gab ihm sein Handtuch und den Joint samt Feuerzeug und sprang selbst ins kühle Nass. Ich tauchte eine Weile unter dem kleinen, in seinen Anfängen steckenden Wasserfall hindurch und paddelte dann langsam an den Rand des Beckens zurück. Als ich nah genug dran war, löste Peter sein geheimnisvolles Rätsel auf.
„Kunst! Wenn du keine geeignete perfekte Verpackung findest, musst du eben eine erfinden. Als ich in Deutschland ankam, gründete ich mit meinem Mitstreiter sogleich einen gemeinnützigen interkulturellen Kunstverein. Auf dem Markt kam mir nämlich die Idee, dass wenn die ganzen Touristen sich den Kram kaufen, dann würde es wohl auch nicht auffallen, wenn man einen Teil davon nach Europa ausführt. Das machen bestimmt auch ein paar andere Leute, sonst gäbe es ja die ganzen Dritte-Welt-Läden nicht.
Also nehme man ein klassisches Transportgefäß, einen Eimer, und packt vakuumverschweißtes Gras rein. Dann muss man die ganze Sache noch als Kunst tarnen. Deswegen bestellten wir bei der einheimischen Kunststofffabrik vor Ort Acryleimer. Durchsichtig also. Dort rein packten wir das Gras in ein extra am Boden befestigten Innengefäß. Und dann ließen wir einen Künstler, mit dem wir vorher Kontakt aufgenommen hatten, diesen Eimer mit buntem Sand füllen, so wie man es von den kleinen Glasgefäßen auf den Märkten jedes Urlaubslandes kennt. Diese Eimer arrangierten wir dann zusätzlich noch zu Kunstwerken, also etwa eine große Sonne.
Das war das erste Projekt. Eine Sonne, aus 10 kreisförmig zusammengesetzten Eimern, deren kunstvolles Innenmuster die Sonnenstrahlen symbolisierten. Über das Loch in der Mitte spannten wir noch eine Leinwand, die die Sonne selbst darstellte. Und fertig war das Kunstwerk. In jedem Eimer lagerten luftdicht versiegelt und unsichtbar fünf Kilo Dope. Insgesamt hatten wir zwei Sonnen à zehn Eimer, was zusammen hundert Kilo bestes Swazigras ergab. Im Einkauf haben wir dafür zusammengeborgte 15.000 Mark bezahlt, dazu noch mal hundert Mark pro Eimer, inklusive Herstellung und Befüllung, also zweitausend, und für Transport und Versicherung, es handelte sich ja schließlich um Kunst, noch mal so ein paar große Scheine. In Deutschland wurde uns das Gras zu einem unschlagbaren Preis von drei Mark fuffzig aus den Händen gerissen. Also blieb uns nach der ersten Tour abzüglich Tickets und Spesen locker eine Viertelmillion. Das war vor ungefähr vier Jahren. Also, wenn du mich fragst, was ich so mache, dann sage ich, ich bin Kunsthändler.“
Mit diesen Worten verabschiedete sich Peter und stieg den Berg hinab. Ich allerdings musste mich erst mal von dieser Geschichte erholen, legte mich in die warme Nachmittagssonne und schlief ein. Oder hatte ich die ganze Zeit geschlafen und das alles nur geträumt?
Zu „Der letzte Tango in Paris“ hat Fauser eine tagesaktuell passende Casting-Anekdote parat:
Brando hatte der jungen, unerfahrenen Schauspielerin [Maria Schneider, d.Verf.] auf seine eigene Art die Aufwartung gemacht. Er lud sie vor Beginn der Dreharbeiten zum Essen ein, setzte sich mit ihr an die Bar des Restaurants und bat sie, ihn eine halbe Stunde schweigend anzublicken. Wahrscheinlich wusste Old Bud nicht, daß die Schneider eine Marihuanakettenraucherin war und es zum Standardrepertoire eines durchschnittlichen Kiffers gehört, stundenlang seinen großen Zeh anzustarren; jedenfalls riß Maria diese halbe Stunde aus dem Stand ab und hatte sich damit Marlons uneingeschränkten Respekt erworben.
[Jörg Fauser: Marlon Brando. Der versilberte Rebell. Eine Biographie., S.190]
Was das jetzt mit dem längsten Tag des Jahres (der auch nur 24 Stunden hat…), der Fete de la musique oder dem ‚Schland-Spiel zu tun hat, fragen Sie? Gar nichts, richtig! Aber heute kommt der Messias darnieder und hält Hof im Görli (Zu dem PR Kantate letztes Jahr glatt ein neues, kaum geklicktes Musikvideo gemacht hat). Wenn ich das richtig verstanden habe.
Wer nun denkt: Lass diesen Clown da ruhig in der Wüste rufen – bittesehr, kein Thema. Ein ernstes Thema ist das allerdings doch, und genügend ernsthafte, gar respektierte und dekorierte Menschen erzählen seit Jahren, dass der sogenannte War on Drugs verloren ist. Kofi Annan zum Beispiel. Ein paar Experten und Wirtschaftsnobeltreisträger (naja….) der London School of Economics zum Beispiel. Die Weltkommission für Drogenpolitik, mit so namhaften Mitgliedern wie dem schon erwähnten Annan, aber auch George P. Shultz, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Javier Solana oder Marion Caspers-Merk, zum Beispiel. Einige Regierungschefs in Südamerika zum Beispiel. Ein paar Gesundheits-(Kosten)Forscher zum Beispiel. Oder selbst deutsche Strafrechtler, zum Beispiel.
Manchmal hoffe ich ja klammheimlich darauf, dass die Merkelin, die – das darf man nicht vergessen – die CDU ja komplett umgekrempelt hat, wo keiner mehr offen homophobe Witze machen darf, die Wehrpflicht und die Energiewende-Wende abgeschafft hat und wahrscheinlich auch sonst so gut wie alle früheren Ideale dieser Partei über Bord warf, dass die also mal auf den Trichter kommt, dass sich Drogen wunderbar besteuern liessen, Gerichte und Knäste wieder mehr Zeit für Schwarzfahrer hätten und überhaupt, alle viel glücklicher wären. Oder so. Und Hanfkönigin könnte sie so auch noch werden.
Aber gefährlich isses schon: (via)
(via)
Trevlig Midsommar!
Gestern das letzte Fauser-Buch ausgelesen: Die Brando-Biografie. War eine Premiere, die hatte ich mir bisher immer gespart. Eigentlich mag ich Biografien, und natürlich mag ich Fauser, aber die Kombination stand bisher halt jungfräulich im Regal, während die anderen Fauser-Bände längst kräftig abgegriffen sind. Wo doch schon Zweig riet, sich an Biografien zu versuchen, sie aber wenigstens zu lesen. Und Loest eine Karl-May-Biografie schrieb, die auch Fauser beeindruckte (und die ich laaaaangeee bevor ich Fauser kennenlernte mehrere Male las, teilweise noch mit Taschenlampe unter der Bettdecke). Ist also, wenn man so will, ein wichtiges und wahrscheinlich unterschätztes Genre.
So, und was soll der Schmus? (Wie er es sagte) Klar bin ich begeistert, weil es nämlich viel, viel mehr als eine stinknormale Lebensnachschreibung ist; eher eine Weltbeschreibung (und auch Selbstbeschreibung), 1978 in zwei Monaten runtergeschrieben. Wo es eben solche (und noch viel mehr) Kostbarkeiten zu finden gibt:
Das heißt, weder der christliche Humanist [ein gewisser Dr. Kraus, d.Verf.] noch der alte Neulinke [Jean Amery] sehen, daß der aufgeklärt christlich/bürgerliche Staat, dem sie bis in die atomaren Mülldeponien noch ihre Reverenz erweisen, jenem Europa, jenem ‚Abendland‘, jener reinen Utopie längst den Garaus gemacht, das Hirn zertrampelt, die Kinder erschlagen hat. Sie seichen immer noch, von den Managern der Bewußtseinsindustrie ins Fernsehen gehievt, ausgehalten von den Zuhältern jener Konzerne, die das Abendland und Morgenland und diese ganze Erde bis auf den letzten Quadratmeter ausplündern, um sich sodann dem Weltraum zuzuwenden, und das Ganze natürlich verbrämt mit Politik/Kultur/Humanismus/Aufklärung und bewußtseinsmäßig gut geölt von den gemieteten Schreiberlingen jeder Provenienz, sie seichen, schleimen und laichen, bezahlte Zuträger der Macht, Kulturkorrektoren der Multis und ihre Politkommissare, sie sagen Abendland, und was genau meinen sie damit? Wohl doch die Perpetuierung von dessen Untergang.
Der weise Mann wendet sich von solchen Bildern ab und der Gefährtin seiner Nächte, der Poesie und dem Trunk zu. Der Rebell zieht weiter, jenseits des Untergangs liegt vielleicht ein anderes Bewußtsein, eine andere Gemeinschaft, eine andere Welt. Der Politik kommt man mit Politik nicht bei, dem Staat nicht mit Staat, der sterbenden Kultur nicht mit sterbender Kultur, dem Westen nicht mit dem Osten.
[Jörg Fauser: Marlon Brando. Der versilberte Rebell. Eine Biographie. S. 148]
Mal ganz aus der Reihe getanzt – dank der Depublizierungsfrist der ÖR ein hingerotzter Hinweis: Gestern machte ich ausnahmsweise mal wieder die Glotze an, und konnte mich fast nicht entscheiden. Wirklich wahr! Da ich vom Elend der Welt aber eh schon die Schnauze voll hatte, entschied ich mich gegen arte und den Master of the Universe, der ist später dran, sondern meine Wahl fiel auf This ain’t California: Die Rollbrettszene in der DDR, inklusive the incredible Fahrradschlauchtrick. Passte irgendwie besser zu meiner melancholischen Stimmung. Skaten war damals übrigens nicht so meins, ich hatte es eher mit dem BMX-Rad, das machte sich auch besser in den Abraumhalden der Lausitz. Andere Geschichte.
Wo ich schon mal multimedial verlinke, gibt es gleich noch zwei Podcasts oben drauf, welche mir die letzten Waldrunden verkürzten und die hoffentlich nicht so schnell depubliziert werden: Zuerst zweineinhalb kurzweilige Stunden zu Erich Mühsam, mit Rowohlt, Ebermann, Rellöm und Spilker. Ist genauso großartig wie es klingt. Und dann, nicht ganz so kurzweilig, aber auch interessant: Ein Vortrag von Lukas Holfeld über Hölderlin und die Versteinerung der Revolutionäre. (Beides via Audioarchiv)
Mit einem Zitat von diesem schliesse ich dann auch wieder die Pforten. Was waren das für Zeiten, als Idealismus noch denkbar war…
Du räumst dem Staate denn doch zu viel Gewalt ein. Er darf nicht fordern, was er nicht erzwingen kann. Was aber die Liebe gibt und der Geist, das läßt sich nicht erzwingen. Das laß er unangetastet, oder man nehme sein Gesetz und schlag es an den Pranger! Beim Himmel! der weiß nicht, was er sündigt, der den Staat zur Sittenschule machen will. Immerhin hat das den Staat zur Hölle gemacht, daß ihn der Mensch zu seinem Himmel machen wollte. (quelle)
20.08.05
Noch nie
hatten wir so viel
Vergangenheit
wie jetzt.
Das fordert
schon allein
die Zeit.
Jeden Tag
neue Massaker
und Kriege.
Was soll das
für ein Gedächtnis sein
in
sagen wir mal
zweihundert Jahren?
Das wird
noch eine große Aufgabe
werden.
Für die Pharmakonzerne.
13.02.04
Wo sind all die pace-Fahnen?
Die Anständigen sind aufgestanden
und gegangen.
Die nahmen sie wohl mit.
In Zeiten knapper Kassen
werden selbst Lichterketten
zu teuer.
Der Einfaltsreichtum
kennt
keine Grenzen.
Es hat eine Weile gedauert: Viele Texte waren zu lesen, andauernd kamen neue dazu. „Ach komm, das wäre doch auch noch was für die nächste Linkliste…“ Dachte ich mir oft, setzte ein Bookmark, auf dass ich den Beitrag in einem ruhigen Moment lese und eben eventuell in die nächste Linkliste aufnehme. (Um die es sich hier übrigens handelt, falls sich wer fragt…) Dann kam auch noch das gute Wetter dazwischen, diverse Seen im Grunewald wollten besucht werden, in Kreuzberg vor der Haustür wurde sorgsam der nächste zerbrochene-Bier-Mate-MiniHugo(!)-Flaschen-Slalom aufgebaut, das heimliche Highlight jeder Großveranstaltung.
Und dann trotzdem der obligatorische Karnevalsbesuch: Erst, weil die Tomaten wirklich dringend umgetopft werden mussten – Dienstag wäre zu spät gewesen, da führte kein Weg dran vorbei, sondern also direkt zur Domäne, wo es die billige Blumenerde gibt. Spassige Sache, Karnevalssamstag um 16 Uhr einen 40l-Sack so schnell wie möglich durch das Gewusel auf die andere Straßenseite zu schleppen, wo es wenigstens etwas ruhiger ist. Abends dann aber wirklich, zwei Fliegen mit einer Klappe, mindestens: Das neue Yaam in der alten Maria wollte ich mir sowieso schon längst angeschaut haben, ausserdem hatte ein guter Freund, der noch vernünftig verabschiedet gehörte vor seinem langen Urlaub, eine +1 auf der Gästeliste frei. Die Band, mit der er verbandelt ist und wegen der wir da waren, ging gut ab, der Rest drumherum eher nicht so. Dafür schien es aber in der Zwischenzeit draussen auf der Strasse ordentlich gekracht zu haben, die Brücke war gesperrt und mit ziemlich vielen Polizeifahrzeugen zugestellt. Obwohl es weit nach Mitternacht war, halfen bei der Absperrung Jünglinge in Uniform, die eigentlich längst ins Bett gehörten. Schnupperpraktikum, kurz bevor es in die Oberstufe geht, dachte ich. Und: Ganz okay, das neue Yaam, dachte ich auch. Klar war das alte Gelände besser, aber immerhin haben sie jetzt mindestens zehn Jahre Planungssicherheit.
Wo wir gerade schon mal bei der Polizei sind: Die twitterte in Berlin 24 Stunden lang jeden Einsatz live. Diese eine, vielbeschriene Seite des Netzes geht mir ziemlich weit am Hinterteil vorbei. Mit sozialen Netzwerken kann ich nicht viel anfangen, der GooglePlus-Account, der mir mal mit einer Betaphaseneinladung aufgeschwatzt wurde, liegt seit Jahren brach und taugt nur noch zur Überraschung über die regelmäßig hereinflatternden Vorschläge, wen man vielleicht kennt (erschreckend genau manchmal). Facebook nutze ich seit Jahren, allerdings nur, um mit Freunden und Bekannten zu kommunizieren, die weiter weg wohnen: Australien, Südafrika, USA, Uruguay, jenseits der Bergmannstrasse, so in der Art. Ich habe dort vielleicht zwei Dutzend Freunde, und noch nie hat einer von denen Essensbilder oder Selfies gepostet. Irgendwas muss ich scheinbar richtig gemacht haben.
Twitter hat mich nie gereizt, ich konsumiere diesbezüglich einzig und allein die monatlichen Lieblingstweet-Listen diverser Blogs. Aber es ist nicht nur die Berliner Polizei – selbst die CIA hat sich jetzt mit einem heissdiskutierten ersten Tweet zu Wort gemeldet. Ich finde das alles andere als witzig: Die eklige, abstossende Seite der Staatsmacht versucht es jetzt also mit Ironie. Ihr mögt mich nicht, weil ich diese ganze Demokratiegeschichte mit meiner Totalüberwachung kaputtgemacht habe? Dann spiele ich jetzt halt den lustigen Klassenclown. So kommt mir das vor, im Jahr 2 nach Snowden. Absurdes Theater, aber nur zum Heulen, nicht komisch. Klar konnte man das alles schon längst wissen, wusste es sogar, verdrängte es aber, bis es eben irgendwann doch durch die Bewusstseins-Oberfläche durchbrach.
Verdammt, und schon hat sich die Politik hinterhältig eingeschlichen. Dabei will das doch kein Mensch lesen: Atomabfälle vor Afrikas Küsten verklappen und sich dann über Piraten beschweren. Sowas passt einfach nicht, ausserdem ist doch bald WM (und wehe, da krittelt jemand an der diesbezüglichen Gute-Laune-Berichterstattung mit menschelndem Wohlfühlfaktor rum). Dafür werden selbst die Kriege kurz auf Pause gestellt, nicht auf den Schlachtfeldern in der Ukraine oder in Syrien, aber immerhin in den Medien. Nicht mal um den Verbleib des goldenen Brötchens wird sich journalistisch gekümmert, eine Schande! Aber wieso sollte sich auch jemand für eine halbwegs differenzierte Darstellung der Gegenwart interessieren, wenn das nicht mal mit der Vergangenheit funktioniert? Wer es differenzierter will, soll halt ins Museum gehen. Letztens las ich irgendwo die Theorie, dass es in den Nachrichtensendungen so viele bad news gibt, weil es ein Gleichgewicht zu den good news der Werbepausen geben muss. Bei dieser eigentlich guten Nachricht vermute ich allerdings andere Beweggründe, warum sie es nicht in die Tagesschau schaffte.
Also bleibt nur der Rückzug in die innere Emigration, oder in die Wälder, zur Not auch in die inneren. Das passt gut, denn es wird sowieso mal wieder Zeit, hier durchzukehren. Diese Pappelpollen (was für ein schönes Wort für eine so nervige, aber eben auch schöne Angelegenheit – ab in die Überschrift damit) haben ihre Zeit ja nun wohl hinter sich. Die Berliner Polizei twitterte immerhin live über deren Ableben. Und auch sonst gibt es die eine oder andere Veränderung, hier auf der Spielwiese und im Kiez. Das mit der Spielwiese, das Experimentieren, wie ich es genannt habe: ich habe das Gefühl, das klappt ganz gut. Im Sinne des Herumprobierens, möglichst ohne Scheu und Rücksichten. Vielleicht ergibt sich daraus ja dann irgendwann eine Linie, vielleicht auch nicht.
Ich kann mich also eigentlich keineswegs beklagen: Das Wetter passt, ich komme ausgiebig zum Lesen und zum Schreiben gar, und auch mit dem Blog sollte ich zufrieden sein. So ganz falsch läuft es also gar nicht, wenn man liest, was es so für kluge Ratschläge gibt. Jeder der erwähnten Aspekte hat allerdings auch einen kleinen Haken. Das Gelesene wartet auf einem immer größer werdenden Stapel darauf, dass die angestrichenen Sachen aus ihm herausgeschrieben werden. Das Schreiben ist großartig, führt aber doch dazu, dass hier im Blog – Punkt 3 also – Schmalhans mal wieder als Küchenmeister eingestellt wird und es hauptsächlich Aufgewärmtes aus der Tiefkühltruhe gibt. Was ja nicht immer schlecht sein muss, schon klar. So komme ich also nur zu kleinen Justierungen: daMax neue Adresse wird – längt überfällig – in der Blogroll angepasst, und dort kommen endlich auch die Schrottpresse und berlin:street rein.
Überraschungen gibt es natürlich auch allerorten: Da musste erst jemand, die seit knapp zehn Jahren viel zu weit weg in Australien wohnt, für viel zu kurze zwei Wochen vorbeikommen, damit ich mal wieder – auch gefühlt seit zehn Jahren – in den Prater Biergarten gehe. Und mir dann dort erklären lassen, dass die Eisenbahnmarkthalle jetzt (wieder) Markthalle IX heisst und weltweit really famous ist für ihren food market. Ich habe sie immer mit Herrn Lehmann verbunden, für den es dort, im Weltrestaurant, in der Markthalle und im Privatklub die Premierenfeier gab, die mir aus mehreren Gründen immer in guter Erinnerung bleiben wird, auch, weil sie so gelungen war.
Eine weitere Überraschung – wir sind bei der obligatorischen Literatur-Abteilung angekommen – hat die Mit-Fauser-Jüngerin Katja Kullmann aufgetan. Da gibt es als Sahnehäubchen noch einen alten Text vom Captain Ploog dazu. Wer es lieber zeitgenössischer mag: Die Frau Bukowski haut ein Kleinod nach dem nächsten raus, da werden sämtlichen Jurys dieses Landes die Ohren schlackern, oder die Augen nervös beim Lesen zucken. Auch auf rocknroulette gab es kürzlich eine sehr feine Serie, falls wer mehr Zeit zum Lesen hat. Oder bei Glumm, natürlich. Es mag ja bereits angeklungen sein, dass ich den für ziemlich famos halte. Manchmal bin auch ich nicht vor Fanboytum gefeit, deshalb ging es mir ungefähr so wie der wolkenbeobachterin, als hier vor einiger Zeit ein Sternchen aus Solingen eintrudelte. Da ich aus Erfahrungen lernte, ist meine Bewunderung meist eine stille, die eben gerade nicht auf möglichst große Nähe aus ist – ich befürchte bzw. erlebte, dass Menschen, die große Kunst schufen, als Menschen trotzdem Arschlöcher sein können. (Wer weiss, wie ich so von anderen gesehen werde: ich jedenfalls nicht…).
Zum Abschluss gibt es noch einen kurzen, starken Text von tikerscherk und eine Serie vom Kiezneurotiker zu Rock im Park (der es natürlich nicht nötig hat, von hier verlinkt zu werden, sondern dem für das Verlinken zu danken ist. Nur, dass diese Ausschläge nach oben in der Blogstatistik den Rest immer so kümmerlich aussehen lassen … Wie auch immer, für das „Kann nicht wenigstens mal jemand auf den Boden spucken?“ musste ich einen Link setzen.)
Wem das alles zu viel Text ist, hier sind ein paar Bilder.
Dieses Fotolabor scheint jeden Brückentag mitzunehmen. Das hat mal wieder etwas länger als erwartet gedauert, aber dafür war – im Gegensatz zu den letzten beiden drei Versuchen – die freudige Überraschung ob des Ergebnisses umso größer. Und Freude gehört geteilt, selbst wenn es vielleicht ein bisschen viel ist:
Dieses Scannen kann einen übrigens kirre machen; scannen, zurechtschneiden, 36 Bilder lang mit der alten Möhre. Allerdings habe ich dabei, im Rahmen der Routine, wenigstens gute Musik gehört, und zwar mit dem antiken CD-Wechsler, um die Möhre zu schonen. Und bin auf folgenden Soundtrack gestossen: Die Antwoord hat was, durchaus; schon längere Zeit kann ich die beiden drei ab und zu ganz gut leiden. Letztendlich sind sie aber nur eine traurige 2010er Version von The Prodigy. Die ich eben in dem CD-Wechsler entdeckte. Sag ich mal als Laie. Den Vergleich ziehen lustigerweise auch andere, viel berufenere Federn. (Auf die Kusturica-Story hätte ich auch selber kommen können müssen) Es sollen immerhin 28 Grad werden, oder so. Und noch dazu Karneval der Kulturen. Prost Neujahr, sozusagen! (Fuck, waren die geil, damals in Roskilde…)
(Nicht auf den Bildern, aber zur gleichen Zeit passiert: Wie die alte Hundedame und ich an der Köpenicker Promenade Rocky trafen, mit seinem ganz und gar rockyuntypischen Collie. Eben: kein Pitti, kein Rottweiler und – scnr – auch kein Boxer. So drehten wir zu viert eine kleine Hunderunde miteinander. Kein unsympathischer Mensch, ganz im Gegenteil. Am Katzengrabensteg trennten sich unsere Wege, und natürlich hat die eingebildete, wunderliche alte Hundedame den in voller Hormonblüte [no pun intended] stehenden Collierüden nicht mit dem Arsch angeguckt.)
22.05.03
(Der Vollständigkeit halber; oder wie man Literatur beim Entstehen zuschauen kann: Als Otto Sperber noch keinen Namen hatte.)
Früher hingen hier in den Hinterhöfen Schilder wie „Betteln, Hausieren und Ballspielen verboten“. Früher gab es hier Großfamilien mit Berliner Schnauze und wenig Geld.
Heute würde kein Mensch daran denken, hier Ball zu spielen. Dafür gibt es Parks. Schließlich spielt ja auch kein Kind mehr im Rinnstein, jedenfalls wohl nicht mit Zustimmung der Eltern.
Aber es gibt trotzdem noch einiges zu sehen. Das vermitteln jedenfalls die beiden Frührentner im vierten Stock, die jeden Tag von 9 bis 13 Uhr und von 20 bis 21 Uhr ordnungsgemäß ihren Platz einnehmen. Der ist auf dem Fensterbrett, Vorderhaus, dort wo die Kissen liegen. Wäre der vierspurige Straßenlärm nicht so laut, dann würden Sie bestimmt ab und zu auch mal eine Zurechtweisung brüllen, so was wie „Mann, Steppke, wie alt bist du denn? Weeß deine Mutter eijentlich, dit du roochst, oder soll ick ehr mal Bescheid sahgn?“
Doch die beiden Alten haben Glück, dass der Verkehr so laut ist. Denn die Zeiten haben sich geändert, die Antwort auf diese Frage würde wohl der eilends herbeigeholte große Bruder des Steppkes geben, der innerhalb weniger Minuten dank eines 3er BMWs jedem seiner Familienmitglieder sehr schnell zur Seite stehen kann. Und die Antwort würde nicht sehr nett ausfallen und irgendwas mit „Willst du Ärger oder was?“ zu tun haben.
Also sitzen sie stumm am Fenster. Im Gegensatz zu anderen Bewohnern dieser Straße. Wenn man spät abends, wenn nur noch wenige Autos fahren, manchmal hier lang geht, dann hört man jemanden Kontrabass spielen, auf dem Balkon. Vielleicht übt er ja für seine Arbeit: Hier in der Gegend wohnen keine Sinfonieorchestermitglieder, eher einer der U-Bahnmusiker. Bald wird die BVG die kompletten Flohmarktbestände der Betteln-und-Hausieren-Schilder aufkaufen und an ihre Waggons pappen.
Ab und zu fallen ein paar Brocken Putz von der Fassade des Hauses. Fünf Stunden später wird dann der Bürgersteig gesperrt. Sicher ist sicher, vielleicht rutscht ja jemand auf den Putzstücken aus. Als Zeugen, so was wird polizeilich aufgenommen, stehen die beiden Frührentner gerne zur Verfügung. Andere Leute beschäftigen sich lieber mit ihren Balkonpflanzen, wenn auch mit interessiertem, auf der Autobahn geübten Schaulustigen-Seitenblick.
Wenn man schon immer im Biomarkt einkauft, bekommt man irgendwann das Bedürfnis, selbst was zu tun. Also kann man ja wenigstens ein bisschen Petersilie, Schnittlauch und – Achtung, darf auf keinen Balkon fehlen – Basilikum anbauen. Man tut was man kann, und irgendwie schmeckt der glückliche-Büffel-Büffelmilch-Mozzarella mit dem selbstgezogenen Basilikum auch viel besser als mit dem von Kaisers, der auch immer sofort nach dem ersten Blätterabzupfen eingeht. Vielleicht hat dieser besondere Geschmack ja aber auch was mit den schätzungsweise 30.000 Autos zu tun, die hier täglich langfahren.
Wer auf Basilikum mit Mozzarella abfährt, der ist gemeinhin auch Experte, was die Crema betrifft. Früher konnte ein stinknormaler deutscher Filterkaffeehersteller sein Produkt noch „Krönung“ nennen. Heute würde das als Scherz aufgefasst werden, im besten Falle. Heute gibt es ernsthafte Überlegungen, die Herstellung von Filtertüten ganz einzustellen, weil diese Art von Kaffeezubereitung hipnessmäßig nur noch in Bahnhofskneipen durchgeht.
Espresso, Lavazza, Macchiato, Latte, Capuccino. Wieso immer Italien? Weil Crema so geil klingt? Eine richtige Crema kann man übrigens nicht weg rühren. Da sind die wichtigsten Stoffe drin. Und ihre Konsistenz ist natürlich ganz von der Sorte der Bohne abhängig. Dieses Wissen wird vorzugsweise in Bordmagazinen verbreitet.
Die Frührentner finden Espresso zu bitter und Mozzarella labberig und nichtsschmeckend. Bei ihnen liegt eher ein Harzer Roller im Kühlschrank. Wenn sie mal über eine Crema diskutieren, dann geht es eher darum, dass er meint, es hätte heute morgen, als er pisste, ganz schön geschäumt.
Das hört sich hart an, ist aber die Wahrheit. Und wahr ist auch, dass es die Mozzarellafresser vor gar nicht allzu langer Zeit ziemlich trendy fanden, die Geheimnisse des Morgenurins auf eine ganz andere Art zu erkunden.
S-Bahn. Nächste Station: Tempelhof.
Rüstiger Rentner mit Rucksack: „Na, der bleibt uns ja jetzt noch eine Weile erhalten.“
Ich schau ihn an, neben dem Rucksack hat er noch einen grossen Koffer dabei. Ein Reisender. „Nein, das ist Tegel, was sie meinen. Hier fliegt schon eine ganze Weile nichts mehr.“
„Jaa, nee, schon klar. Ich meine das Feld, das bleibt uns erhalten.“
„Achso, ja. Zum Glück.“
„Tegel, klar, der bleibt.“
„Jo, den werden die nie zumachen. Von wegen: Schönefeld!“
„Genau, eher machen sie Tempelhof wieder auf.“
Allgemeines Gelächter im halben Waggon. Die Türen öffnen sich. Ich steige aus. Ick steh uff Balin.
(Stimmt, das Zitat ist von Annette Humpe, die ihr Berlin auch noch mal neu vertont hat. Aber gerade passt mir Pierre besser in den Kram. Der passt mir eigentlich immer in den Kram.)
22.08.03
Eines Tages, als es krachte,
ich mich auf die Socken machte.
Auf die Straße, Unfall gucken,
`n paar Teile warn noch am Zucken.
Mein Nachbar, wohl noch neu darin,
wurde etwas schmal ums Kinn.
Drauf gab ich ihm `nen weisen Rat,
wie man`s mit mir auch früher tat:
Schau lustiger,
Schaulustiger!
(* passt aber auch ganz gut zum Wahlausgang)
„Und was blieb denn übrig, was haben Sie gelernt in ihrem Geschichtsstudium? Dass die Menschen nun mal so sind?“ fragte die weinende Frau, die aus dem Naziknast kam, die ihren Rundgang abbrechen musste.
„Ja, ich fürchte schon.“ sagte ich nach einigem Zögern.
*
Eigentlich wäre das doch eine tolle Sache: Europa. Eine zwingende sogar. Muss man nicht mal Zweig für bemühen. Doch ich bin es müde geworden: Letztendlich braucht es immer eine Bedrohung. Etwas, womit man den Leuten Angst machen kann, etwas Fremdes von aussen.
Es wäre also ein Leichtes: Einfach eine Gefahr konstruieren, die von so weit aussen kommt, dass sie schon nicht mehr von dieser Welt ist. Klappte mit Gott doch auch ganz gut. Es müssen ja nicht gleich Aliens sein, nicht unbedingt. Wäre auch unwahrscheinlich, leider: Denn das Argument, dass man besser nicht zu denen gehört, die entdeckt werden, sondern lieber zu denen, die entdecken, ist einfach zu schön, zu bestechend. Doch setzt man Zeit – unsere Wimpernschlagexistenz von bisher grob 100.000 Jahren (und nocheinmal so viele werden es schwerlich werden) verglichen mit den wahrscheinlich 7-10 Mrd. Jahren, in denen solch eine Existenz prinzipiell möglich wäre im Universum, ebenfalls bisher – in ein Verhältnis mit den ebenso gedankensprengenden Ausmaßen des zu überwindenden Raums, dann ist eben der Kontakt mit außerirdischer Intelligenz leider sehr unwahrscheinlich.
Höchst wahrscheinlich ist dagegen, dass ein Stein-, Staub- oder Eisbrocken uns treffen wird. Uns wieder treffen wird, früher oder später. Das taugt also eigentlich, um klar zu machen, dass Grenzen, Wirtschaftskriege und diese ganze alberne Kapitalismus-Unterdrückungs- und Konkurrenzgeschichte jetzt mal langsam ausgespielt haben und es an der Zeit wäre, so nah es nur geht zusammenzurücken, alle Ressourcen gemeinsam zu nutzen, wirklich Wert auf Bildung zu legen. Weil es uns alle und jeden einzelnen treffen könnte, jederzeit und überall. Mutig, wagemutig zusammen in die Zukunft zu schauen, selbstbewusst, mit der Stirn im Wind, weil man eben zusammen auch so etwas meistern kann, das ginge schon. Mit all den Möglichkeiten, die wir haben. Also: Wäre eigentlich ein Klacks, das mit Europa. Da ist viel mehr drin, da müsste doch viel mehr drin sein, wie kann denn das sein, dass da nicht mal ein anständig vereintes Europa drin ist?
Es ist eben so. Sicher ist jeder Einzelne, dem nahegebracht werden kann, dass Menschen prinzipiell und überhaupt gleich sind, ein Gewinn. Wo stehen wir denn heute? Es ist nämlich auch so: Genau wir, jetzt und hier – wir hätten doch die Möglichkeiten. Bei uns stapeln sich nicht die Leichenberge am Straßenrand, gerade mal nicht. Es kommt näher, keine Frage, und es war wohl immer irgendwo da. Doch es geht darum: Dass wir wirklich was machen könnten, schon seit Jahren was hätten machen können, aber es eben nicht tun, meistens, seit Jahren. Von aussen betrachtet kann das doch nur eine haarsträubende Absurdität sein: Nicht diese Wahl jetzt, nicht diese Politik, nicht diese Wirtschaft und nicht diese Landschaftszubetoniererei – sondern wirklich unsere gesamte Existenz. So ist es, und da kann man dann gerne noch mal 300, 500 oder 3500 Jahre drüber philosophieren, aber letztendlich ist es so. So einfach. Von daher ist es ganz gut, dass diese bisherigen 100.000 Jahre – und von mir aus auch noch mal 100.000 drauf – aber eben mit großer Wahrscheinlichkeit viel weniger – wirklich nur ein Wimpernschlag sind. Höchstens eine Fussnote wert, wenn man mich fragt.
Subjektiv betrachtet mag das anders sein. Trotzdem. Wozu noch mehr Argumente, genügend Phantasie reicht vollkommen aus. Und überhaupt: Wo ist denn da eigentlich der Unterschied, bitteschön?
Du bist Beute, leg dir schon mal ein schickes Nervenkostüm zurecht.
Pollesch (aus unzureichender Erinnerung zitiert)
Andererseits war es großartig, vorgestern Abend im Biergarten zu sitzen und gestern Abend am Kanal. Zu erkennen, dass es drei Reiher sind, mindestens, und nicht nur einer, wie von mir naiverweise gedacht. Und unglaublich viele Schwäne inzwischen auch, von den Menschen ganz zu schweigen. Dass mindestens zwei von den Reihern sichtlich die Show genossen, die sie abzogen, während sie tief und gemächlich ihre Runden drehten. Dass es also schon so magische Abende gibt. Nebensächlichkeiten. Wenn ich liege, dann liege ich.
PS. Es spricht natürlich nichts dagegen, eine Rede zu halten. Eine gute zumal, eine wirklich gute, kluge und wohl auch wichtige Rede. Wenn aber der Gegenstand ebendieser tagtäglich in Abrede gestellt wird, an so vielen und immer mehr Stellen nicht mehr existiert: Dann ist das auch eine Totenrede. Kaddish.
13.09.03
Otto Sperber war Frührentner. Sein Rücken! Er hatte sich mal verhoben, und danach noch ein paar Stunden weitergearbeitet. Das ließ sich nicht mehr geradebiegen. Nach der Reha saß er noch einige Monate am Schreibtisch, aber das war nichts für ihn.
Jetzt sitzt er jeden Tag an der Fensterbank. Seine Frau hat ihm zu seinem letzten Geburtstag ein extra Fensterbank-Kissen geschenkt, inklusive selbstgenähtem Wendebezug. Damit war sein Fensterbank-Glück perfekt.
Doch ein Jahr später, inzwischen vollzog Otto Sperber schon drei Jahre seinen unentgeltlichen Spitzeldienst, täglich von 11-16 Uhr, wurde er unzufrieden mit seiner Ausstattung. Das Kissen war perfekt, aber mittlerweile konnte er vorhersagen, was als nächstes passieren würde. Es wurde ihm langweilig. Immer die gleichen schreienden Kinder, immer die gleichen schwangeren Frauen und immer die gleichen quietschenden Reifen. Er musste sein Aufgabenfeld erweitern. Sich eine neue Herausforderung suchen.
Da fiel ihm der letzte Urlaub ein, den er mit seinem Hildchen gemacht hat. Sie waren beide in Kenia, am besten gefiel ihnen die Safari. Davon hatte er noch diverse Mitbringsel auf Lager. Er ging in die Abstellkammer und schob den Vorhang vom Reiseutensilien-Regal zur Seite. Erst griff er noch nach der Flinte, die er auf der Safari ebenfalls dabei hatte, dachte dann aber, dass dies keine so gute Idee wäre, und nahm den Feldstecher in die Hand.
Da hätte er eigentlich schon viel früher drauf kommen können! Von nun an stand ihm endlich die Welt der nackt duschenden Studentinnen in der Wohngemeinschaft gegenüber offen, er konnte sehen, welchen Groschenroman Helga Schumpeter im 3. Stock schräg rechts las und wer in diesem Haus seine Kinder, Frauen oder Hunde schlug. Das dürfte Stoff genug für die Frühpensionärsbeschäftigung der nächsten drei Jahre geben, und dann könnte er sich ja immer noch eine Modelleisenbahn kaufen.
Zweieinhalb Wochen nachdem er damit angefangen hatte, sein Blickfeld mittels Fernglas zu erweitern, bekam Otto Sperber einen Schreck. Er konnte bisher einige nackte Brüste erspähen, auch ein paar fliegende Tassen, aber hauptsächlich doch geblümte Gardinen. An diesem Abend aber leuchtete ihn ein Fenster geradezu einladend an, völlig entblösst und ohne jeden Vorhang. Sein Hildchen hatte sich schon hingelegt, und so konnte er die Nachtschicht in Ruhe angehen. Er hatte inzwischen einen regelrechten Ablaufplan entwickelt, schließlich war er mal ein ordentlicher Angestellter, der jeden Plan einhielt, und eben, wenn kein Plan da war, schnell einen machte. Ordnung musste schließlich sein.
Also konnte er den Blick nicht gleich auf das einladende Fenster richten. Er musste das Haus gemäß seinem Plan von oben rechts nach links, dann die nächste Etage – und so weiter – absuchen. Und vorher natürlich noch schauen, ob Herr Schmidt heute den Hund Gassi führt oder seine Tochter. Die Fenster boten im Großen und Ganzen nur die üblichen Stoffmuster, und in der Studentinnenwohngemeinschaft duschte ein langhaariger Hippie. Ekelhaft, dachte er, als er erkannte, dass ihm keine wohlgeformten Brüste, sondern ein haariger Schrumpelpimmel beim Aussteigen aus der Duschkabine entgegenlachte. Doch langsam aber sicher näherten sich die verlängerten Sperber-Augen dem Ziel ihrer Begierde.
Das hell erleuchtete Fenster im vierten Stock links gegenüber gab den Blick frei auf einen nahezu leeren, weißgestrichenen Raum. Otto Sperbers erster Gedanke war, dass dort wohl gerade jemand einziehen würde. Diese Straße lag in einer zur Zeit sehr beliebten Gegend, es zogen andauernd neue Jungfamilien und Studenten hierher.
In dem Zimmer schien nur eine einzige große Palme zu stehen. Er erkannte, dass der Raum relativ groß war, vom Fenster zur gegenüberliegenden Wand ungefähr sechs Meter, schöner Altbau mit Stuck. Leute mit solchen Zimmern verhängen ihre Fenster meistens mit leinenen Bomull-Gardinen von IKEA. Das war jedenfalls Otto Sperbers Tip. Hildchen kaufte meistens bei Woolworth, aber die hatte ja auch sonst keine Ahnung.
Plötzlich bewegte sich etwas hinter der Palme. Ganz langsam, Stück für Stück, kam ein junger Mann auf einem Bürodrehstuhl hinter der Pflanze vorgerollt. Er hatte vor seinen Augen ein riesiges Armeefernglas, und in seiner linken Hand hielt er ein Schild mit der Aufschrift „Hallo Otto! Schön, dich zu sehen! Du hörst von mir!“. Otto Sperber war geschockt, er machte sofort das Fenster zu und löschte das Licht. Wer war dieser Kerl, und was wollte er von ihm? Woher wusste er seinen Namen?
Am nächsten Tag schlich Otto Sperber nachmittags ziemlich geduckt zum Supermarkt. Er hoffte, er würde diesem Typen nicht begegnen. Er hatte unruhig geschlafen, sich immer wieder gefragt, was er jetzt tun solle. Es ging ja hier nicht mehr nur um sein Hobby. Dieser Rowdy drang in seine Privatsphäre ein, er verhöhnte den anständigen Frührentner Otto Sperber einfach so mir nichts, dir nichts. Das geht ja nun nicht. Sein Steckenpferd würde er wegen so einem Vogel nicht aufgeben, mal sehen, wer hier von wem hört. Mit entschlossener Miene und gefülltem Einkaufsbeutel schloss er beschwingt seine Haustür auf. Irgendwas würde ihm schon einfallen, um diesem Bengel die Flausen auszutreiben.
Als er, oben angekommen, die Wohnungstür aufschloss, stürzte ihm auch schon seine Frau entgegen. Aufgeregt erzählte sie etwas von einem Paket, das abgegeben wurde, und sie wüsste ja gar nicht, wer ihnen denn ein Paket schicken sollte, es ist doch nicht Ostern oder Weihnachten, und sonst bekommen sie doch nie Pakete. Ob das vielleicht von den Kindern wäre? Es war aber an ihn adressiert, und deswegen hat sie es noch nicht aufgemacht.
Otto Sperber öffnete das Paket, aber er drehte sich ein wenig zur Seite, damit das Hildchen nicht gleich sehen könnte, was sich unter dem Packpapier verbirgt. Er wühlte den Papierwust zur Seite und es kam ein Spielzeugfernglas zum Vorschein. Plötzlich hatte er einen Verdacht, von wem dieses Päckchen stammen könnte. Seine Frau schaute erstaunt. Was soll denn das nun? Wir sind doch keine Kinder hier! meinte sie, vermutete doch eine Fehlsendung.
Ihr Mann wusste allerdings genau, dass das Paket hier goldrichtig war. Er nahm das Kinderfernglas vor die Augen und beruhigte seine Frau. Ist schon gut Hildchen, dat is bestimmt bloss wieder son Scherz. Er selbst war alles andere als beruhigt. Denn was er durch das Kinderfernglas sah, war nicht unbedingt für Kinderaugen gedacht.
Otto Sperber war ein wenig aufgebracht. Solche Spässe trieb man nicht mit ihm. Er kramte noch ein wenig in der Kiste rum, auf der Suche nach einer Erklärung. Und siehe da, seine Finger ertasteten eine Karte. Er setzte sich seine Brille auf und las den Text: Hallo Otto, wie geht`s, altes Haus? Damit Du Dich nicht immer so über die Vorhänge ärgerst, hier ein kleines Geschenk für Dich. Wir sehen uns!
Auf der Vorderseite der Karte war ein Bild von dem Frührentner Sperber zu sehen, wie er auf der Fensterbank gelehnt mit einem Feldstecher seine Nachbarschaft ausspionierte. Dazu war noch handschriftlich vermerkt: Was meinst du, an wen ich diese Karte noch geschickt habe? Das gefiel ihm gar nicht. Er müsste diesem Bürschchen wohl mal eine ordentliche Lektion erteilen. Die Jugend von heute hatte eindeutig zu viel Zeit, dessen war sich Otto Sperber schon lange sicher.
Nachdem er den Kaffee, den seine Frau wirklich über die Jahre immer besser hinbekam, genüßlich geleert hatte, schritt er zur Tat. Erst versicherte er sich, dass das Fenster gegenüber auch erhellt war, auf ihn also gewartet wird. Die Dämmerung war bereits angebrochen und sein Hildchen schaute sich voller Hingabe Dieter Thomas Heck an, war also für die nächsten zwei Stunden abgeschrieben. Er hatte jede Zeit der Welt.
Sein Weg führte ihn wieder einmal in die Abstellkammer, zum Regal, und diesmal holte er die Flinte hervor. Wie es sich gehörte, war diese mit einem Zielfernrohr ausgestattet, das in etwa die Vergrößerung des Fernglases hatte. Otto Sperber war schon sehr auf das Gesicht seines Widersachers gespannt, wenn der mit seinem angeberischen Militärfeldstecher direkt in die Mündung einer etwas antiken, doch erkennbar funktionsfähigen und nicht zugeschweißten Flinte schauen würde.
Diesmal hatte sich der Halunke gar nicht erst hinter der Palme versteckt. Sie war im Übrigen immer noch der einzige Einrichtungsgegenstand in dem Raum. Er saß ganz bequem in seinem Drehstuhl und hatte die Hälfte des Gesichts schon wieder hinter dem Riesenfernglas versteckt. Jetzt machte es sich auch Otto Sperber gemütlich, der rüstige Frühpensionär und Hobbyschütze stützte seinen rechten Arm auf das Kissen und setzte das Gewehr an. Dann kniff er das linke Auge zu und schaute mit dem anderen neugierig durch das Zielfernrohr.
Der Typ von gegenüber schien nicht sonderlich geschockt, aber Otto Sperber sah, dass er wieder ein Schild in der Hand hielt. Er richtete das Gewehr auf das Schild aus und las: War nur ein Scherz, das mit der Karte. Der Junge schien bemerkt oder gesehen zu haben, dass sein Schild gelesen wurde, denn er drehte es um. Auf der Rückseite ging der Text weiter: Allerdings sind die Typen eine Etage unter mir kein Scherz.
Das verstand Otto Sperber nun gar nicht. Er senkte den Lauf ein Stockwerk nach unten, um nachzuschauen, was ihm das Schild bedeuten wollte.
Die Mitarbeiter des BKA fanden es gar nicht witzig, dass ein Frührentner in seiner Freizeit mit einer unregistrierten Waffe auf eine frisch eingerichtete konspirative Wohnung zielte.
*
„Nicht schlecht für den Anfang“ dachte sich der Star der diesjährigen Burgfestspiele, Kaspar Rautenberg, als er das Skript auf dem Weg in eine dieser unsäglichen Freitagabendtalkshows durchlas. Er würde es sich überlegen, ein engagiertes Filmprojekt könnte das werden, so in der Tradition des großen Tetzlaff. Eigentlich fand Kaspar Rautenberg, dass er sich solche Auftritte nicht antun sollte, diese Niederungen fand er zu tief für sich. Doch leider stand es im Vertrag der Festspiele, und Verträge hatte er immer erfüllt, auch das begründete seinen Ruf. Klappern gehört nun mal zum Geschäft. Und schließlich wurde er wenigstens von einer anständigen Limousine abgeholt, die zusammen mit ihm gerade in die Hofeinfahrt des Fernsehstudios einbog.
Knapp eine Stunde später fand er sich wieder inmitten einer Runde sogenannter illustrer Gäste. Es waren zwei Moderatoren, ein Mann, der bärtig war und mit seiner Brille scheinbar den putzigen Intellektuellen gab, und eine Frau, die auch als Schlagersängerin berühmt zu sein schien und sich ansonsten durch ihr tadelloses Äußeres und ihre unbefangen-anzügliche Art qualifizierte. Die Getränke hier waren wie es sich gehörte frei und reichlich vorhanden, was Kaspar Rautenberg ganz gut zu pass kam. Sein übermäßiger Drogenkonsum verursachte in letzter Zeit immer eine gewisse Trockenheit in der Kehle.
Er bestellte sich ein grosses Wasserglas voller Wodka. Weder die Moderatoren noch die Aufnahmeleitung zuckten auch nur mit der Augenbraue bei der Bestellung. Diese Sendung fing an, ihm zu gefallen. Er könnte eigentlich auch gleich noch Werbung für das neue Projekt machen, dachte er sich.
Die Sendung begann und der Burgfestspielstar Kaspar Rautenberg nahm an, dass ihm und den Zuschauern jetzt die anderen Gäste vorgestellt werden würden. Denn ehrlich gesagt kannte er hier kaum jemanden, und ihm fiel die Navigation in der Welt gerade sowieso zunehmend schwerer. Die hatten verdammt guten Wodka hier. Doch die Show schien auf Spannung zu bauen: es wurde, bevor die Klappe fiel, nur noch schnell die Reihenfolge festgelegt. Geplant war, dass Kaspar Rautenberg den krönenden Abschluss der Runde bilden würde, er könne sich aber auch gerne jederzeit früher in ein Gespräch einmischen, falls ihm danach wäre.
Das ließ er sich nicht zweimal sagen. Als der erste Gast, ein blonder, junger und ziemlich eingebildeter Schönling vorgestellt wurde, traute Kaspar Rautenberg seinen Augen und Ohren nicht. Scheinbar hatte irgendjemand diesen Bengel aus einem Cafe gezerrt und in eine billige Sperrholz-Kulisse gesteckt, ehe der sich wehren konnte. Und jetzt sitzt er hier und gibt den Eröffnungsgast, inklusive frisch aufgenommener CD. Nachdem der neunzehnjährige Mimendarsteller seinen zweiten Satz mit den Worten „Als Schauspieler ist das natürlich schwer zu beurteilen…“ begann, nahm Kaspar Rautenberg den Klappstuhl des Tonmanns in die Hand.
Der wohl bedeutendste deutschsprachige Theaterschauspieler zog den Blechklappstuhl zielgenau über den Scheitel des Sprechenden, noch bevor auch nur die ersten Silben des Wortes „Lee-Strasberg-Schule“ dessen Lippen verlassen konnten. Dabei brüllte der diesjährige Star der Burgfestspiele „Dafür habe ich nicht sieben Jahre bei Matschullak gelernt und vierzig Jahre an den besten Theatern gespielt, dass so ein dahergelaufener Taugenichts sagt, er ist ein Schauspieler!“
Das war das vorläufige Ende der Karriere des Kaspar Rautenberg. Sören Schelling trug lediglich eine leichte Gehirnerschütterung und einige Schürfwunden davon und begann schon drei Wochen später mit den Dreharbeiten an einem Film, in dem er einen jugendlichen Voyeur spielte, der einen Rentner zur Weißglut treibt.
Damit hätte ich nicht gerechnet: Beim Festplattenaufräumen einen Text zu finden, der gar nicht allzu alt, schon ein paar Seiten stark und überraschend interessant ist. Und unzweifelhaft von einem selber, auch wenn man das erst auf den zweiten Blick erkannt hat.
Da hab ich also vielleicht was Lohnendes zu tun, mal sehen. Könnte man eigentlich gebührend feiern, mit einem guten Essen. Letztens kam ein sehr einfaches Rezept in meinen Feedreader geflattert, wenn man sich die Zutatenliste so anschaut…
Ja, wir hatten ja nichts, damals. Nur Zwiebeln, Zwiebeln im Überfluss, die haben uns die Russen Sowjetmenschen gnädigerweise gelassen…
Viel Freizeit wird es also nicht geben, vor allem, da ich auch noch zwei überraschende Untermieter habe, aber das ist wieder eine andere Geschichte.
(eigentlich wollte ich als nächstes einen anderen alten Text hier einstellen. Die letzten Kommentare erinnerten mich aber an die folgenden – ebenso alten – Worte und ich kramte sie aus dem Archiv:)
19/07/06
Nachts um drei
mit Rohstoff fertig.
Mal wieder.
An Drogen:
seit einer Woche nur noch Bier.
Selbst das:
ab Werk mit Zitronenlimonade gestreckt.
Versucht, die Fauser-Gedichte
aus dem Regal zu holen
und dabei kräftig
über Stühle gestürzt.
Kaputtes Knie, kaputtes Leben.
Der Alkohol wirkt also doch.
Und Fauser sowieso.
Blöde Sache an der Analogfotografie: Wenn man verkackt, dann richtig. Film zum Entwickeln gegeben, gewartet – und nur ein paar Groschen bezahlt, weil da nun mal nicht viel zu entwickeln war. Diese Fehlerquote von 1:4 muss deutlich gesenkt werden. (Noch besser: Eigentlich gingen zwei Filme drauf – Der volle, der ein zweites Mal in die Kamera gelegt wurde, und der leere, der stattdessen ins Labor ging.) Aber egal, rational ist das ja sowieso nicht: Für die Kosten von schätzungsweise 20-50 Filmen würde ich wahrscheinlich ein halbwegs passable Digitalkamera bekommen (Für eine Spiegelreflex mag man da eventuell eine Null ranhängen). Doch darum geht es ja auch gar nicht, wobei ich anfangs gedacht hatte, dass diese Rollfilme bestimmt sauteuer sind inzwischen, wegen ihres Raritätenstatusses. Von daher war ich also eher positiv überrascht.
Blöde Sache an der Ukraine-Krise: Man weiss so gut wie nichts, und man weiss nicht, ob das, was man glaubt zu wissen, wahr ist. Und man steht weiter morgens auf, isst und kackt ( und arbeitet und fickt, wenn man Pech bzw. Glück hat) und schläft. Vulgärsystemtheoretisch muss ich immer mit dem Kopf schütteln, wenn irgendjemand in den zwangsläufig dieses Thema berührenden Diskussionen mit Moral kommt. Die taugt als Argument weder bei der Kapitalismuskritik noch in der Politik. Was ist denn das objektive Ziel Interesse von Politik? Wenn ich derzeit die Rolle Putins betrachte, vielleicht sogar über einen Zeitraum von sagen wir mal zehn Jahren, dann steht er gerade ziemlich gut da: Russland ist wieder wer, mission accomplished. Aber eben: Politik. Die taugt höchstens, um dran zu verzweifeln.
Interessante Nebenbeobachtung: Bei einem der unzähligen Interviews in den Hauptnachrichtensendungen fiel mir etwas auf – die Sponsorenwand, vor der die Interviews gegeben werden. Leider ist es keine wirkliche Sponsorenwand, man sucht die Logos von Krauss-Maffei, Heckler&Koch und Co. vergeblich. Trotzdem: Dass es da eine extra gestaltete und angefertigte Pappwand gibt, die nur für die Kameras da ist, finde ich bemerkenswert. Ebenso wie die FAQs auf der zugehörigen Seite des dafür verantwortlichen Ukraine Crisis Media Centers.
Blöde Sache an den Wahlen zum EU-Parlament: Dass seit zwanzig Jahren jede Chance vertan wird, die Menschen für Europa zu begeistern. Ich hatte das gar nicht so zweifelhafte Vergnügen, in meiner Schulzeit kurz nach dem Mauerfall eine Art freiwillige Reeducation mit regelmäßigen Bildungsfahrten nach Bonn und Brüssel zu durchlaufen. Und ich fand die europäische Idee toll – die deutsche Einheit war vielleicht nicht so dolle gelaufen, aber egal, was zählte, war ja ohnehin die europäische Einigung. Dachte ich damals. Die für die privilegierierten Europäaer offenen Schengen-Grenzen fand ich (abgesehen von dem, was sie für die nichtprivilegierten Menschen bedeuten) prinzipiell ebenso gut wie die Euro-Einführung, die ich zusammen mit begeisterten Niederländern in Zandvoort erlebte: Drei Stunden nach Mitternacht am 01.01.2002 waren die Eurobestände der Geldautomaten durch den großen Ansturm restlos geplündert und die Maschine spuckte nur noch Gulden aus. Und jetzt? Bleibt einem nichts übrig, als den Kopf zu schütteln und Die Partei zu wählen. Die APPD gibt es ja leider zum Glück leider nicht mehr wirklich, die machte mal einen der ehrlichsten und besten Wahlspots aller Zeiten.
Blöde Sache am Internet: Es ist das, was man daraus macht oder machen lässt. Man kann ihm keine Schuld geben. Aber: Es lassen sich eben auch wahnsinnig tolle Sachen damit machen. Ich fand zum Beispiel diesen Beitrag über die Rolle sozialer Medien in den Protesten in der Türkei (ich glaub ich bin durch ix drauf gekommen) rumdum gelungen. Auch nicht schlecht: Eine Reportage über Ostermaiers Schaubühne in Paris beim Online-Zeit-Magazin. Hier muss ich leider am „rundum gelungen“ sparen, der Text entlockte mir nicht ganz die Begeisterung wie die Gestaltung an sich. Zu behäbig, irgendwie – aber das ist ja auch Geschmackssache. Genau wie dieser Text, mal wieder vom Magazin-Blog, den ich sehr unterhaltsam finde. Andere vielleicht ja nicht.
Hauptsache, man schreibt, auch wenn es nicht ganz egal ist, für wen. Ich sehe das ähnlich wie der Kiezschreiber: In selbstgewählter Mündigkeit selbstbestimmter Verelendung zwar, aber dafür angstfrei. Und wo wir schon mal beim Thema Schreiben & Lesen sind: Schade, dass Hildesheim nicht um die Ecke liegt. Aber immerhin, das Lesen bleibt ja noch, und die Liste wird immer länger. Ohne Internet war es jedenfalls viel langweiliger, und es gäbe keine Youtube-Videos von Schlingensief über Bayreuth. Wo Gysi weitestgehend die Klappe hält. Was man ja nicht glaubt, wenn man es nicht gesehen hat. Grandios.
Ansonsten: Vielleicht mal in den Wedding nach Gesundbrunnen fahren.
01.07.04
Bei dem Sommer
läuft es einem kalt
den Rücken runter.
Eisverkäufer fordern Subventionen.
Politiker fordern Mäßigung.
Blut fordert Zoll.
Zum Glück erkennt man
zwischen all den Konjunkturnachrichten
die Kriege kaum mehr.
Gestern las ich in der U-Bahn, dass das deutsch-russische Museum zum Tag der Befreiung ein Fest veranstaltet. Es gibt auch ein Gastland – die USA. Noch scheint also nicht alles verloren. Tag der Befreiung kann man übrigens nicht oft genug sagen, und zumindest bis zur Elbe waren es die Soldaten der Roten Armee, die die Deutschen vom Hitlerismus befreiten. Selber haben die das nämlich nicht auf die Reihe bekommen, im Gegenteil.
Zum Thema zwei Zitate aus dem soeben ausgelesenen „Erinnerungen eines Europäers“ von Stefan Zweig, aktuelle Parallelen mag sich jeder selbst denken:
Abends in Belgien bei Verhaeren kam die Nachricht, daß das Luftschiff in Echterdingen zerschellt sei. Verhaeren hatte Tränen in den Augen und war furchtbar erregt. Nicht war er etwa als Belgier gleichgültig gegen die deutsche Katastrophe, sondern als Europäer, als Mann unserer Zeit empfand er ebenso den gemeinsamen Sieg über die Elemente wie die gemeinsame Prüfung. […] aus Stolz auf die sich stündlich überagenden Triumphe unserer Technik, unserer Wissenschaft war zum erstenmal ein europäisches Gemeinschaftsgefühl, ein europäisches Nationalbewußtsein im Werden. Wie sinnlos, sagten wir uns, diese Grenzen, wenn sie jedes Flugzeug spielhaft leicht überschwingt, wie provinziell, wie künstlich diese Zollschranken und Grenzwächter, wie widersprechend dem Sinn unserer Zeit, der sichtlich Bindung und Weltbrüderschaft begehrt! (S. 147)
(Zur Einordnung: Obiges Zitat bezieht sich auf das Jahr 1908)
Vor dieser >Neuen Ordnung< hatte die Ermordung eines einzigen Menschen ohne Gerichtsspruch und äußere Ursache noch eine Welt erschüttert, Folterung galt für undenkbar im zwanzigsten Jahrhundert, Expropriierung nannte man noch klar Diebstahl und Raub. Jetzt aber, nach den immer erneut sich folgenden Bartholomäusnächten, nach den täglichen Zutodefolterungen in den Zellen der SA. und hinter den Stacheldrähten, was galt da noch ein einzelnes Unrecht, was irdisches Leiden? 1938, nach Österreich, war unsere Welt schon so sehr an Inhumanität, an Rechtlosigkeit und an Brutalität gewöhnt wie nie zuvor in Hunderten Jahren. Während vordem allein, was in dieser unglücklichen Stadt Wien geschehen, genügt hätte zur internationalen Ächtung, schwieg das Weltgewissen im Jahre 1938 oder murrte nur ein wenig, ehe es vergaß und verzieh. (S.291)
(zitierte Ausgabe: Stefan Zweig: Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers. Fischer Bücherei Frankfurt/M. und Hamburg, 1970.)
Filmtipp zum Wochenende: Die kommenden Tage. Einfach so.
Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, als nächstes wieder ein paar Fotos zu veröffentlichen. Allerdings nicht die, die hier zu sehen sind, sondern aktuellere: von dem Film, den ich in den letzten Wochen füllte. Da nun aber das Fotolabor scheinbar komplett das lange Wochenende geschlossen hatte, braucht die Entwicklung um einiges länger als gedacht. Die Vorfreude hat auch eine Medaillen-Rückseite, wenn die einkalkulierte Frist verstrichen ist.
Deswegen also noch etwas Geduld, versüsst mit alten Digitalbildern. Macht aber nichts, denke ich mir, ich bleibe bei meiner Planung. Hier im Internet ist doch sowieso gerade Betriebsausflug zum Gleisdreieck, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin da übrigens nicht, selbst wenn ich könnte – viel zu viele fremde Menschen, ganz zu schweigen von dem Fernseh-Rettungsschwimmer. Aber immerhin, was mich überraschte: Johnny erzählte bei Spreeblick, dass diese ganze Veranstaltung von 5000 Menschen besucht wird. Also ungefähr so viele, wie am 1. Mai in der Naunynstraße selbstzusammengepapptes Köfte-Fladenbrot von Önurs Mama gekauft haben. Oder so. Von daher: Schon enorm, wie stark diese re:publica in den Medien präsent ist.
Hier wird sich also erst mal weiter die Zeit vertrieben, bis der Film da ist und hoffentlich ein paar vernünftige Bilder dabei sind.
Früh am Morgen, eigentlich noch mitten in der Nacht, ist der junge Dichter mit dem blumigen Namen aufgestanden und hat sich einen Kaffee gekocht, der in Wirklichkeit ein Espresso war, aber für sich allein kocht man ja keinen Kaffee mit der Maschine. Und der Espressokocher machte praktischerweise nun mal nur eine Tasse. Dann ist er zum Bahnhof gegangen und mit dem Zug lange gen Süden gefahren.
Am Ziel setzte sich der junge Dichter auf den ihm zugewiesenen Stuhl und wartete. Er war als letztes an der Reihe an diesem Tag, aber der Anstand gebot es, auch allen anderen zuzuhören. Natürlich durchschaute er die Geschehnisse schnell: Es war das klassische guter Cop – böser Cop-Spiel. Wahrscheinlich würden sie nach der Mittagspause die Rollen tauschen. Zur Zeit oblag es jedoch noch der unansehnlichen Helvetierin, Äußerungen zu tätigen wie: „Das ist für mich keine Literatur, weil es zu sehr bemüht ist, Literatur zu sein.“
Seine Leidensgefährten wurden nach und nach abgefrühstückt, es wurde Bedeutungsschwangeres geredet und Bedeutenderes geschwiegen. Es fielen Sätze wie „Ich kapituliere vor dem Text, und damit bin ich noch schlechter dran als die anderen, die ihn nur nicht verstehen.“ Flugs erstellte man eine Hitliste der beliebtesten literarischen Stoffe der Gegenwart. An deren Spitze tummelten sich Fahrerflucht, Unterwäsche und mystische Tänze auf abgesperrten Kuhweiden.
Als der gute Cop mit den Worten „Wir müssen nun mal den Wahnsinn nehmen, der uns geboten wird, und können uns keinen zusammenspinnen“ beschützend seine Hände über einen Bewerber hielt, dämmerte der junge Dichter schon längst vor sich hin.
Er war sich seiner Sache keineswegs sicher – das war er nie gewesen, doch bisher brauchte er keine Sicherheit, weil ihm dieser ganze Kram nichts bedeutete. Doch langsam überkam ihn ein Gefühl der Unwürde. Dieser Text? Auf dieser Veranstaltung? Bei diesen Juroren?
Als Kind war der junge Dichter derjenige, der immer volle Kante in die Fresse bekam. Nicht von den Sportlern und denen, die schon mit 11 ½ anfingen, zu rauchen. Nein, die waren damit beschäftigt, die Streber zu verprügeln. Er aber wurde von den Mädchen verprügelt, oder von den Strebern, wenn ihnen mal Zeit gelassen wurde. Der junge Dichter war kein Streber, er war ein Sonderling.
Die Streber wandten sich von ihm ab, als er bei den regelmäßigen Nachwuchs-Klugscheissertreffen mit abwegigen Vorschlägen auf sich aufmerksam machte. Sie stellten seine Duldung ein, als er meinte, man könne doch mal eine Runde Scrabble spielen, aber nur mit Palindromen.
Das war das dunkle Geheimnis seiner Seele. Der junge Dichter war, seit er denken konnte, von Palindromen besessen. Nun hatte er seine Kindheit hinter sich gelassen, und er wurde auch nicht mehr so oft verprügelt, könnte also eigentlich zufrieden sein und weiterleben, bis er zur Bevölkerungsgruppe gehören würde, die selbst ein Palindrom ist. Doch diese Rückwärtslaufenden schlichen sich auch immer wieder heimlich in seine Texte ein.
In seinen Frühwerken wirkten sie noch offensichtlicher, da hießen die Hauptfiguren Anna Susanna und Der Freibierfred. Später schrieb er historische Biographien, in denen Fragen auftauchten wie „Du, erfror Freud?“. Ein Beamtenroman, den er verfasste, behandelte auf zehn langen Seiten den Dienstmannamtsneid, aufgrund dessen die Hauptfigur später strafversetzt wurde und nur noch das Lagertonnennotregal bewachen durfte.
Das Schaffen des jungen Dichters wurde durchaus geachtet, und kaum einer bemerkte die Obsession, von der er befallen war. Wenn jemand über die offensichtlichen Fallen, die er beispielsweise in seinem Indien-Reise-Roman mit dem Satz „Na, Fakir, Paprika-Fan?“ aufstellte, stolperte, dann ging das als liebenswerter Spleen durch.
Schließlich werden ja auch Werke wie das eben gerade von einem seiner Konkurrenten vorgelesene, das vom möglichst vielfältigen Gebrauch eines überdimensionierten Geschlechtsteils handelte, als liebenswerter Spleen gewertet.
Der junge Dichter hatte nie die Kontrolle über die Palindrome. Sie bemächtigten sich seiner und der Texte, ohne dass er etwas dagegen tun konnte.
Im Laufe der Zeit schlichen sie sich mehr und mehr als stilsichere Wendungen ein. Bei einem kolonialen Roman ist an der Frage „Risotto, Sir?“, gestellt von einem livrierten Diener, erst einmal nichts verdächtig. Bis auf dass sich der junge Dichter ein wenig zu sehr hingezogen fühlte zu der Welt mit den livrierten Dienern.
Sein Verhängnis war, dass ihm in der Korrektur alle Palindrome entgegensprangen und ihn auslachten, da sie ihn abermals ausgetrickst hatten. Er versuchte alles. Trotzdem spielten in seinem Roman, der mit den Worten „Der Paranoide hatte recht, er hatte sehr viele Feinde! Aber wer mochte auch schon mit einem wie ihn befreundet sein?“ begann, seinen Höhepunkt mit der Aussage „Du musst nicht paranoid sein, damit sie hinter dir her sind“ erreichte und mit dem Ausruf „Ich bin nicht paranoid, ich werde wirklich verfolgt!“ endete, auch diverse Neffen, nette Betten und eine erhabene Bahre eine tragende Rolle.
Doch diesmal, so war sich der junge Dichter sicher, hatte er es geschafft. Er war clean, der Text war clean. Sein Wettbewerbsbeitrag war palindromfrei, wenn auch nicht unbedingt leicht verständlich.
Der junge Dichter mit dem blumigen Namen wurde aus seinem Dämmerzustand herausgerufen und aufs Podium gebeten. Er nahm einen Schluck Wasser, faltete das Manuskript glatt, blickte ins Publikum und sprach: „Krawehl, Krawehl“.
Die meisten Journalisten verpassten diesen Moment, da sie gerade draußen beim Rauchen ein Kind interviewten, das ein Seil in der Hand hielt, an dessen anderem Ende ein mittelgroßer Schäferhund befestigt war.
„Meinst du nicht, dass der Hund zu stark für dich ist?“ fragte der Mann vom Kulturfernsehen, der auch in der Raucherpause nicht von seinem Job lassen konnte.
„Quatsch, ich bin doch schon fünf!“
(2003)
31.08.10
Wenn mal wieder
die schweigende Mehrheit
als Argument aus dem Sack geholt wird.
Und ihre hässliche Nachgeburt
„das wird man doch mal sagen dürfen“
gleich mit.
Nur um wirres Zeug
in eh schon wirre Köpfe
zu verpflanzen.
Dann wird es Zeit zu entgegnen
denen, die sich brüllend und keifend
auf die schweigende Mehrheit berufen,
was man dieser eigentlich nicht sagen muss:
Halt deine verdammte Fresse, hergottnocheinmal!
…bei den Links und in der Rolle da rechts (und überhaupt!). Schliesslich ist ja auch Frühling. Denke ich mir immer wieder. So quasitechnische Überlegungen machen sich besonders gut, wenn man eigentlich dabei sein sollte, sich den Kopf über die inhaltliche Ausrichtung zu zerbrechen. Aber das nur nebenbei.
Also: Zu Recht hatte tikerscherk vor einiger Zeit darauf hingewiesen, dass in Blogs zwar dieses und jenes steht, aber selten was zur Erotik. Natürlich gibt es da Ausnahmen (und vielleicht ja höchstwahrscheinlich auch eine komplette, unerschlossene Welt), deshalb gehört sunflower22a eigentlich schon längst in die Blogroll. Auch, weil sie immer wieder überrascht. Und wo wir schon dabei sind, gleich die volle Link-Breitseite zum Thema: Eine weitere mir ziemlich unbekannte Welt wurde dank eines Beitrags bei kleinedrei gerade etwas aufgehellt: BDSM. Wie es der Zufall wollte, las ich kurz vorher eine komplett andere Perspektive auf die Sache, was sie um so interessanter, weil anscheinend noch um einiges vielschichtiger, macht.
Eines meiner Vorhaben habe ich in der letzten Zeit ja fast eingehalten: Politik spielt hier oberflächlich kaum noch eine Rolle. Wenn, dann ist das Politische auf das Private, auf das Kleine, runtergebrochen. Natürlich juckt er mir ab und an in den Fingern, der große Rundumschlag, das Ewiggleiche. Und ab und an muss das natürlich auch sein. Aber es ist eben ein trauriges, ewiggleiches Sisyphos-Geschäft. Die Trottel werden immer da sein. Umso wichtiger ist differenzierter, guter Journalismus. Und schon wieder muss ich dazu auf einen Text aus dem Schweizer Das Magazin-Blog verweisen. Das macht glatt die schlimmen Tatorte wieder wett. Doch auch in den Onlineversionen deutscher Holzmedien – Berliner zumal – findet man den einen oder anderen guten Beitrag. Selten – das mag aber auch daran liegen, dass ich da selten reinschaue.
Ebenfalls zum wiederholten Male setzte ich mir bookmark-Sternchen bei Frau Haessy, die oft schöne Texte schreibt – deswegen landet die jetzt auch da rechts. Und wo wir schon mal dabei sind: Dort in der Leiste ist die Politik ja durchaus erlaubt. Also rein mit Kritik und Kunst. Rein mit che, der da eigentlich schon immer war, hatte ich nur kurz vergessen. Rein mit den Punkgebeten, auch oder gerade weil man sich dort gar nicht so wirklich klar über die Richtung ist. Und die Brücke von der Politik zur Poesie schlägt Klaus Baum, für dessen Platz in der Randleiste dasselbe gilt wie für che. Dank seines Hinweises kam mir Schlingensief wieder in den Kopf, und zusammen mit ihm ein geschätzter ehemaliger Kollege (bis zum Genossen hat es dann doch nicht gereicht), der einfach auch gut schreibt und fotografiert.
Der Vielfalt und der Realität angemessen ist es eigentlich auch längst, englischsprachige Berlin-Blogs in die Rolle aufzunehmen (Wer weiss, wieviel großartige spanische oder russische Blogs zu Berlin man so verpasst…?). Was hiermit geschieht: Durch einen Kommentar von pethan35 stiess ich auf Kreuzberg’d. Was ich bisher dort sah und las, hat mir sehr gut gefallen, deshalb rein in die Leiste. Eine weitere englischsprachige Seite zum Thema, die dort ebenfalls reinkommt, ist gleichzeitig Ersatz für ein anderes Blog in der Blogroll, das wohl leider erst mal brach liegt.
Weiter geht es (wiedermal) in der Sparte Literatur oder was Sie gerne dafür halten wollen. Mit Volker Strübing bin ich in meinen frühen Berliner Jahren im Grunde genommen groß geworden, und ausserdem habe ich ihn ja auch schon ein paar Mal verlinkt, vollkommen zu recht natürlich. Und wo Volker Strübing ist, da ist Ahne manchmal nicht weit, das war in oben angesprochener Zeit schon so. Wieso also nicht auch in der Blogroll, nicht zuletzt wegen kleiner Preziosen wie diesem Text hier. In der Kategorie lohnt es auch, auf Kaminer hinzuweisen, der zu seinen Texten oft sehr passende Bilder findet. Glumm sowieso, der sitzt in meinem Kopfkino längst zusammen mit Fauser und Fallada auf einer Leitersprosse und lässt dort die Beine baumeln. Apropos, diese Chance kann ich mir eigentlich nicht entgehen lassen: Candy Bukowski – die genauso in die Blogroll wandert wie rocknroulette – scheint den Termin für meinen nächsten Hamburg-Besuch gesetzt zu haben…
Dass ich viel zu wenig Glumm lese, stellte ich fest, als ich von seiner Bekanntschaft zu Airen erfuhr. (Den Text hab ich schon mal verlinkt; wir wollen es mal nicht übertreiben damit…). Ich muss gestehen, dass ich keine Ahnung habe, was er derzeit macht, habe aber vor einiger Zeit einen interessanten Artikel von ihm bei spon entdeckt (obwohl spon eigentlich schon weit jenseits der Vielfalt-Schmerzgrenze liegt). Da nehme ich gleich die Gelegenheit wahr und mache noch kurz einen Abstecher Richtung Geschichte, auch zur Wiedergutmachung: Michael Schmalenstroer hatte ich vorher auch schon in der Blogroll, wenn ich mich recht erinnere, und da gehört er auch hin. Ein letzter Hinweis aus diesem Genre noch, nicht zuletzt weil zwei Personen daran beteiligt sind, die ich mehr und weniger kenne.
Fauser darf nie zu kurz kommen, sagte ich ja bereits. Aber ich kann die Blogroll auch nicht nur mit Schriftstellern zupacken, leider: die Vielfalt fordert ihren Tribut. Zu einem Bekannten Fausers (den er in Rohstoff verewigte & in dessen Archiv ich mal ausführlich stöbern durfte – der HU-EE sei dank, ich sprach es schonmal kurz an) gab es gerade ein großartiges … sagen wir mal Requiem bei den Ruhrbaronen.
Last but not least werden das Begleitschreiben und der Kiezschreiber (dem der Underdog kiezneurotiker unlängst vollkommen zutreffend einen Lauf bescheinigte) in die Blogroll aufgenommen. Ansonsten: FernwehHeimweh.
Wie dem auch sei, so ganz genau hab auch ich den Kurs immer noch nicht raus, auf dem dieses Experiment hier weiter segeln soll. Aber Experiment sagt es eigentlich: Ich werde wohl etwas mehr rumprobieren; für die einen ist es der Salon, für mich gerade eher die Spielwiese. Oder der Hobbykeller mit Drechselbank. Dazu fällt mir glatt eine Geschichte aus der dunklen Vergangenheit ein…
Zum Schluss, weil der Sommer bestimmt kommt und der erste Mai vor der Tür steht: Die Ohrbooten. Ein guter Freund sagte unlängst: Naja, kann man schon mal hören. Aber die Texte sind eigentlich echt nicht so dolle. Wie es aussieht, fährt dieser gute Freund demnächst in Sachen Musik nach Brasilien, wo ein paar clevere deutsche Gute-Laune-Reggaebands die Fussballfans abgreifen wollen, oder so ähnlich. Sowieso: Ein Festival in Brasilien! FTW, wie man hier so sagt. Aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Ohrbooten also (haarscharf vorbei an der Gotteslästerung, und eben – es ist ja auch bald 1. Mai…) :
[Inzwischen ist dieser Beitrag 5 Tage im Entwurfsordner, es ist Sonntagabend und ich habe schon wieder genau abgezählte 54 offene Tabs, die allesamt toll sind. Was ist nur aus dem heiligen Tag der Ruhe geworden. Aber eben: auch ziemlich toll, dieses Internet. Eine weitere kontextlose Information: Wie ich bemerkte, hatte ich gar keine Suchfunktion. Wie unpraktisch!]
… mit den Pausenbildern. Bei dem letzten Umzug fiel mir aus einer dunklen Schublade meine uralte Spiegelreflexkamera in die Hände, die ich mal für ein paar Westmark in den 90ern auf einem Flohmarkt irgendwo im Prenzlauer Berg gekauft habe. Voll analog also, ich passe mich langsam den Hipstern in meiner Umgebung an. Nachdem ich herausgefunden hatte, dass Drogerien immer noch Filme entwickeln (lassen) und es dort auch noch welche zu kaufen gibt, machte ich mich ans Werk. Erst wurde – wie ich dann später feststellte – der seit sieben Jahren in der Kamera lagernde Filme nochmal belichtet, entwickelt und sich über das Ergebnis belustigt, dann nahm ich das Gerät mit auf meinen Hamburg-Besuch. Deshalb gibt es nun ein paar Hamburg-Symbolfotos (bis auf eine trotzdem sehr hanseatische Ausnahme), analog und unbearbeitet, bis auf die Größen- bzw. Formatanpassung.
Kleine Anekdote am Rande: Meine Mutter überraschte mich gestern doppelt: Ich schickte ihr eine SMS, dass sie eine bestimmte Mail, die vorgeblich von GMX kam, gleich löschen sollte. Ihre Antwort: „Schon längst erledigt, auf sowas fall ich schon lange nicht mehr rein.“ Ich staunte und war ein wenig stolz auf sie. Als ich dann die Kamera rausholte und allen die obige Geschichte erzählte und etwas rumfotografierte, fragte sie allerdings: „Die Bilder kann man jetzt aber noch nicht irgendwo sehen, oder?“
Nein, Mama, kann man nicht. Auch wenn auf der Rückseite des Apparates, in der Mitte der Klappe, wohinter sich der Film versteckt, etwas ist, das fast wie ein kleiner Vorschau-Monitor aussieht, auf den ersten Blick. Nur handelt es sich dabei schlicht und einfach um eine Vorrichtung, in die man ein Stück der Filmverpackungspappe reinschieben kann, um immer zu wissen, wieviele Bilder auf dem Film waren und welche ISO er hat. Good ol‘ times… Man muss also wirklich den Film abgeben und ein paar Tage warten. Und dann scannen, scannen, scannen… Es macht trotzdem Spass, damit rumzuspielen. Dass diese ganze Sache eher spielerischen Charakter hat, sieht man den Bildern dann wohl auch an. Voila:
Es regnete. Verdammt viel und schon verdammt lange. Dabei war das hier doch mal mein kleines, perfektes Paradies. Für eine Nacht. Und jetzt regnete es! Wir fuhren den sich durch die Berge schlängelnden Weg entlang. Mussten aufpassen, dass wir mit unserem Citi Golf hier draußen in der Wildnis nicht steckenblieben: der Begriff Straße ist bei dieser Witterung nicht mehr aufrecht zu erhalten. Es ging von einem Gebirgskamm runter in die Lagune, über das, was der Regen aus einer unbefestigten Sandpiste macht.
Zwischendurch hielten wir kurz an, einerseits weil uns ein Truck entgegenkam, und unmöglich zwei Fahrzeuge gleichzeitig die anderthalb schlammigen Spuren passieren konnten. Andererseits, weil man von dieser Ausweichbucht – das wusste ich noch von meinem letzten Besuch – einen unbeschreiblich schönen Blick auf die Lagune und den urwaldhaften Bewuchs des Tales hatte. Damals. Jetzt sah man nur graue Regenschleier, und direkt vor der Nase eine grüne Mauer aus Blättern und Ästen. Der Regen machte einen Riesenlärm auf dem Blattwerk, und von der Lagune sah man regennebelbedingt kein Stück.
Als wir unten ankamen, war nichts mehr da von dem puderzuckerartigem Sand, der indische Ozean war nicht wie gewohnt blauglänzend. Über dem Matsch, der mal Strand war, lag nicht wie sonst der leichte, salzige Dunst, der sich durch das lange Auslaufen der warmen Wellen bildete, sondern ein grauer Vorhang, genauso grau wie sich der Ozean heute gab. Die riesigen Schieferbrocken, die aus dem Wasser ragten, hoben sich jetzt nicht mehr mattschwarz hervor, sondern versanken im grauen Einheitsbrei.
Das fing ja schon mal scheisse an. Da konnte ich auch nicht mehr damit punkten, dass der Backpacker, in dem ich unsere Übernachtung geplant hatte, einen ziemlich netten Pool hatte. Dort angekommen, wieder über moddrige Wege, die dem Leihwagen alles abverlangten, merkte ich, dass Einsamkeit je nach Wetterlage bewertet werden kann: Strahlt die Sonne, ist eine abseits gelegene Unterkunft mit Pool und Affengebrüll aus dem benachbarten Wald zum Sonnenuntergang sehr schön. Wenn es allerdings wie jetzt regnet, dann ist nicht nur der Himmel grau, sondern auch die Gesichter der Backpacker-Angestellten. Es waren andere als im letzten Jahr. Wir bekamen für viel weniger Geld viel mehr Raum. Nicht ein Zimmer, sondern ein ganzes Häuschen, mit eigener Küche und Bad. Doch was bringt das, wenn das Wetter schlecht ist?
Wir waren fast die einzigen Gäste. Drei Bungalows weiter verbrachte eine einheimische Familie ihren Urlaub. Scheinbar schon länger, und scheinbar war das Wetter hier auch schon länger so. Denn ihre Laune liess sich sehr gut mit der eines Durchschnittsehepaares in der dritten Urlaubswoche an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste vergleichen – die Spiele sind alle durchgespielt, die Bücher zerfleddert und die Klamotten so durchnässt, das man beim besten Willen keine Fahrradtour mehr machen konnte. Und die Kinder brüllten.
Als uns dann auf Nachfrage mitgeteilt wurde, dass aus verständlichen, kapazitätstechnischen Gründen – mehr Kapazitäten da, als genutzt werden konnten – die Bar heute Abend nicht aufmachen würde, wurden wir ratlos. Es gelang uns, zwei Sixpacks aus dem Kühlschrank käuflich zu erwerben. Aber es war erst 3 Uhr nachmittags. Als um zehn nach vier von dem ersten Sixpack nur noch die Papphülle übrig war, die man in besseren Zeiten als Krone verwendet hätte, war uns klar, dass wir ein Problem bekommen würden. Schätzungsweise um zwanzig nach fünf.
Also setzten wir uns in den geschundenen Citi Golf und schlitterten die 20 Kilometer zurück zur Fernverkehrsstrasse. Jetzt machte sich die Abgelegenheit wieder schmerzlich bemerkbar. Wir dachten, dass wir an der Abzweigung einen Liquor-Store gesehen hätten. Als wir dort ankamen, sahen wir zwar auch ein Castle-Werbeschild, aber über dem verrammelten Laden hing eine Tafel mit der Aufschrift „Nursery“. Das konnten wir uns nun gar nicht zusammenreimen. Mit den uns eigenen Sprachkenntnissen kamen wir nur auf Krankenschwester. Eine Schwesternschule, finanziert durch Bierreklame? Die Laune stieg bei dieser Überlegung, auch weil wir auf der Suche nach einem Wörterbuch im Handschuhfach noch ein paar Batzen schon längst verloren geglaubtes Gras wiederfanden.
Beim Eintreffen auf dem Hof unserer Herberge hatte sich die Farbe des Autos von schmutzig weiss endgültig in gleichmäßig rotbraun verwandelt.Wir klopften die Angestellten aus ihren Schlechtwetter-Fernsehcouches und verlangten nach mehr Bier. Sie gaben uns noch zwei Sixpacks, meinten dann aber, dass dies das letzte für heute wäre, da sie nachher nicht mehr da wären. Kein Problem für uns!
Baumschule. Nursery heißt Baumschule. Das erklärte zwar immer noch nicht, warum drüber eine Bierreklame hing, war aber moralisch nicht mehr ganz so bedenklich. Wir wechselten uns mit dem Rollen ab. Es regnete immer noch, und es machte nicht den Anschein, als ob sich das mittelfristig ändern würde. Nach einiger Zeit, inzwischen verschwand das monotone Trommeln der Tropfen im Subtext der anderen kosmischen Geräusche, hatten wir alle Ecken unseres Bungalows gründlich untersucht. Es gab hier wirklich nichts, was dem kurzweiligen Zeitvertreib dienen könnte. Nicht mal ein Jenga-Spiel. Und das Bier wurde trotz bedächtig-sparsamen Verzehrs auch wieder knapp. Das Gras zum Glück nicht.
Wir saßen unter dem Vordach auf der Miniterasse und fingen an, uns zu langweilen. Dann fiel, wie in dieser geographischen Lage so üblich, die Sonne plötzlich vom Himmel. Wir diskutierten darüber, wie man korrekterweise das Wort Dämmerung in die lokalen Sprachen übersetzen würde, denn so etwas gibt’s hier ja nicht, und was es nicht gibt, dafür wird es ja auch logischerweise kein natives Wort geben.
Da wir im Dunkeln den Regen nicht sahen wurden wir mutiger und entschlossen uns, das Wagnis aufzunehmen und zum Kühlschrank in der offen zugänglichen Bar zu pilgern, um zu schauen ob dort nachts Selbstbedienung herrscht. Oder ob Mr. Leathermen uns den Weg zur Selbstbedienung öffnen könnte. Das letzte Sixpack hatte sich gerade verabschiedet, doch verhalf es uns immerhin noch zu guter Laune und Unternehmungslust. Schließlich waren wir jetzt so weit, dass wir mit Sixpack-Papp-Kronen durch den Regen liefen.
Die Bar, im Sonnenschein bestimmt schön anzuschauen und aus Wurzelholz selbstgeschnitzt – als ich das letzte mal hier weilte, war sie gerade halbfertig – war wie erwartet offen, der Kühlschrank wie erwartet verschlossen. Und vollkommen unerwartet hatten wir Mr. Leatherman an diesem Scheißstrand bei dem Scheißwetter scheinbar verloren. Mist! Ohne ihn konnten wir das Thema Bier für heute Abend vergessen. Zusammen mit unserer Laune knickten auch die Bierkronen dank des Regens ein.
Wieder zurück in dem Bungalow, vorbei an dem immer noch keifenden Ehepaar, die in ihrer Wohneinheit stritten während die Kinder draußen im Regen mit ihren Koffern vor dem Auto warteten, erkannten wir mit Schrecken, dass uns als einziges Getränk parmalat-Milch zu Verfügung stand.
Nach zwei intensiven Stunden des abwechselnden Genusses von Milch und Gras stieg unsere Stimmung wieder. Wir hatten die Langeweile beim Kragen gepackt und aus dem Haus geschmissen, indem wir mit der dürftigen Bungalow-Ausstattung ein Spiel entwickelten. Die Küche war ziemlich komplett ausgerüstet. Und es gab im Wohnbereich zwei sehr bequeme Ledersessel. Jeder nahm sich eine Gabel, einen Löffel und eine Pfanne. Dann kramten wir je sieben Münzen aus dem Portemonnaie. In den Sesseln versunken, die Utensilien auf den sehr breiten Armlehnen abgelegt, konnte das Spiel beginnen.
Wir stellten in drei Metern Entfernung nahe der Außenwand einen flachen Teller auf den Boden. Dort mussten möglichst alle sieben Geldstücke landen, und zwar pro Durchgang jeweils zweimal mit jedem Wurfgerät – Gabel, Löffel, Pfanne – befördert. Der letzte Versuch konnte mit dem Gerät der Wahl durchgeführt werden. Auf alle Fälle aber musste man im Sessel sitzen bleiben. Das allerdings war für den Zustand, in dem wir waren, keine wirkliche Herausforderung.
Nachdem wir innerhalb von 90 Minuten unser Zielvermögen optimiert hatten und auch genau wussten, wie das Geldstück des Gegners wieder aus dem Teller herausgeschossen werden konnte, verfeinerten wir die Regeln dahingehend, dass das Geldstück, bevor es im Teller landet, die angrenzende Wand berühren musste. Das brachte uns noch mal zwei Stunden äußerste Kurzweiligkeit. Und als wir dann schließlich auch jeden Trick bei jedem Wurfgerät beherrschten, war es spät genug, um ohne Bedenken und Rechtfertigungen ins Bett zu fallen.
Am nächsten Morgen, als wir schon kurz nach dem Frühstück in allerwärmster Umschmeichelung der Sonne am herrlichen menschenleeren Strand der Lagune lagen, schworen wir uns, nie jemandem von diesem peinlichen, wenn auch sehr amüsanten Spiel zu erzählen. Manchmal, wenn ich alleine zu Hause bin und der Regen an die Fenster schlägt, dann trainiere ich heimlich. Zur Motivation habe ich mir die Punkteliste über den Schreibtisch gepinnt.
(2002)
Als ich vor Jahren mit einiger Verspätung hier in der Blogwelt ankam, gab es recht schnell ein paar Blogs, die mich eine ganze Weile begleiteten. Einige wenige davon tun das noch immer. Mal ist es der Inhalt, die Perspektive oder der Stil, die einen verweilen und wiederkommen lassen, mal die Person dahinter. Blogs und die dazugehörige Sphäre sind jedenfalls mehr, als der „Printmarkt“ je bieten konnte. Im besten Falle – und im schlechtesten auch – können sich hier verschworene Gemeinschaften bilden: Kontakte, Diskussionen oder einfach ganz viel Spass und Freude an der gemeinsamen Sache. Ähnliches gab es bei den „klassischen“ Medien höchstens im Little-Mag bzw. Fanzine-Bereich.
Von Anfang an war B like Berlin eines dieser Blogs: Zuerst waren es die Street-Art-Bilder, die dort regelmäßig gepostet wurden, die mich immer wieder vorbeischauen ließen. Aber es gab auch kleine Geschichten und Begebenheiten, über die Großststadt und das Leben in ebenjener. Nicht zu vergessen die Berlin-Zitate, zu denen pro Woche ein bis zwei neue dazu kamen, von den Großen und den nicht ganz so grossen.
Eines Tages stand dann plötzlich nur noch ein einziges Posting auf der Seite. Ein sehr erschütterndes. In den daran anschliessenden Diskussionen wurde ich (erstmals in der Blogwelt) halbwegs persönlich angegangen, weil einigen meine Meinung dazu gegen den Strich ging. Irgendwann wurde es ruhiger, die Aufregung geriet in Vergessenheit, ebenso wie das Blog.
Und genau das ist der Punkt: Aus aktuellem Anlass machte ich mir in den letzten Tagen wieder vermehrt Gedanken zu dieser Blogwelt und was sie so besonders macht. Es gibt unzählige Theorien und Blickwinkel dazu, täglich werden neue veröffentlicht. Viel zu oft ist dabei von Unternehmens-, Marketing- oder Wertschöpfungsmodellen die Rede. Viel zu selten von Vernetzung, Gemeinschaft oder den sozialen Implikationen, die sich aus dieser neuen Welt ergeben. Ja: Blogs (und das Internet als solches) sind die Umsetzung der Brecht’schen Radiotheorie, sie sind dieser denkbar großartigste Kommunikationsapparat, nicht nur im öffentlichen Leben, sondern auch in der Grauzone, die sich bis in das Private hinein erstreckt.
Ich weiss nicht, wie es im Allgemeinen steht mit der Erinnerung, mit der Übertragung sozialen Verhaltens aus der Kohlenstoffwelt in die des Netzes. Ich kann hier nur für mich sprechen: Ich denke immer mal wieder an B like Berlin zurück. Wenn mir gelungene Kunst im öffentlichen Raum ins Auge springt, weil ich dort – bevor es all die flickr- tumblr- und Hipsterstreams gab – eine großartige Sammlung und Würdigung derselben entdeckte. Oder wenn ich in einem Buch oder Text ein treffendes Zitat zu unserer Stadt finde.
Genau das passierte, als ich in den letzten Wochen meine Bahnfahrten mit der turnusgemäßen Lektüre von Fausers Erzählungen verkürzte. (Wo wir schon beim Privaten sind: Er ist das Bild in meinem Avatar. Es dient also nicht primär der Identitätsverschleierung, sondern ist vielmehr eine Hommage.) Bei nicht wenigen Stellen dachte ich: „Das hätte gut auf B like Berlin gepasst“. Ich nahm mir vor, die entsprechenden Passagen rauszuschreiben, die passendsten davon vielleicht mal zu veröffentlichen, so wie es auf B like Berlin früher geschah. Und so soll es sein. Im Andenken an ein Blog, das meine ersten Gehversuche in dieser fremden Welt begleitete. Weil wir mehr sind als Marktmodelle. Weil – so platt oder pathetisch es klingen mag – uns auch der Umgang miteinander ausmacht. Und dazu gehört es auch, der Toten zu gedenken.
[alle Zitate aus der oben verlinkten Ausgabe]
Altmann setzte sich in seinen Audi und fuhr durch den ersten richtigen Schnee des Winters, in dem selbst Berlin wie eine Märchenstadt aussah. Ach, Berlin. Altmann liebte die Stadt. Er liebte nicht nur das Berlin bei Nacht oder das Museum Berlin, nein, er liebte Berlin als politische Metapher. Wo sonst als in Berlin war der dritte Weg zu finden, wo sonst waren auch nur seine Umrisse, seine Perspektiven zu erkennen.
Wem hier die Augen aufgingen, der musste zwangsläufig zur Politik kommen – und die einzig noch mögliche, noch denkbare, noch ausstehende Politik war der dritte Weg. Und selbst, dachte Altmann, als er über den schneebestäubten Kurfürstendamm Richtung Gedächtniskirche fuhr – vorbei an der Schaubühne, an den lichtdurchfluteten Restaurants, den Buletten-Palästen, Kinos und Cafés, vorbei an der Berliner Uhr, deren bonbonfarbene Würfel erst im Schneewirbel richtig zur Geltung kamen, vorbei an den Luxuspuffs und den Würstchenbuden, an den langbeinigen Huren im Nerz und den pockennarbigen Asylanten mit den Heroinbriefchen im Plastikstiefel – und selbst, dachte Altmann mit einem Anflug von Bescheidenheit, selbst wenn das alles nicht wäre, bliebe Berlin immer noch die einzige Stadt, die vierundzwanzig Stunden lang die Karten mischt – verlier oder gewinn, aber bleib im Spiel.
In Schöneberg schlug seine Stimmung um. Er fuhr langsam zwischen den Streifenwagen, den Zivilfahndern, den schrottreifen Büchsen der Freaks, den Taxis und Zuhälterlimousinen, den Motorrädern mit ihren Lederreitern und den Fahrrädern mit den verträumten blassen Studentinnen in ihren Regenpelerinen vom Türkenmarkt, und seine Stimmung nahm sofort die schalen Farben der Umgebung, ihre Brüche und Ruinen auf und setzte sie um wie in einem chemischen Prozeß. Altmann störte jetzt der widerliche Geschmack des Klaren, der mit dem Menthol eben doch nicht wegzukriegen war. Schöneberg deprimierte ihn. Verkommenheit hinter Stuckfassaden, dazwischen die Klötze der Mietburgen und Versicherungen. Da war Kreuzberg entschieden besser, Kreuzberg war schon der dritte Weg. Schöneberg war verlottert wie ein Fin-de-siècle-Bordell, wo das Rattengift sich allmählich gegen das Parfüm durchsetzt. In keiner westdeutschen Stadt hatte Altmann dieses Gefühl scharf abgegrenzter Bezirke, entgegengesetzter Perioden und Desasterzonen gehabt; freilich war er auch schon zu lange in Berlin, um sich in westdeutschen Städten noch wirklich auszukennen. (Der dritte Weg [1983] S.273f)
Sie sieht mich dann nur an mit ihrem sanften Lächeln und richtet mit ihren langen Fingern die Blumen in der Vase oder schenkt mir etwas Wein nach und sagt dann, dass sie noch irgendwohin will, mitten in der Nacht, meistens in eine dieser verlausten Kreuzberger Kaschemmen, wo alle zusammenhocken, die sich erfolgreich davor drücken, erwachsen zu werden. Ich geh nur selten mit. Für Profis fängt der Tag früh an. […]
Neben ihm stand eines von diesen Mädchen, die ihr Leben lang in Holzclogs rumlaufen, Halfzware drehen, den sie mit der taz in einem Jutesack herumtragen, und davon erzählen, daß die Stadt jetzt auch noch die Mittel für ihre Tanztherapie gestrichen hat. (Der Mann, der an Gedichte glaubte [1984] S.341f)
Ich bin auf dem Ku’damm auf und ab spaziert im Schub mit den Nichtstuern, Besoffenen, Fixern, Strichern, Touristen, Skateboardianern, Nutten, Nackten, Pakistanis, Dackeln, Doggen, Spandauern, Schönen und Schicken. Ich habe mehr Besoffene herumtorkeln und hinfallen und daliegen gesehen als je irgendwo, außer in Dublin am Zahltag. Es war noch heißer geworden und die meisten Bummler hatten etwas Flackerndes in den Augen, ein Irresein. Es wurde auch demonstriert und agitiert, es gab Hungerstreiks mitten auf dem Bolevard vor den Bulettenpalästen, für Frieden und gegen Abtreibung, oder vielleicht habe ich das missverstanden. Ich hatte gelesen, daß es jetzt 4,7 Milliarden Menschen gab. Man merkte es. ( Die schöne Helena [1984] S.359f)
München zwar, aber doch ein (wie ich finde) würdiger Abschluss:
Max rauchte und sah durchs Fenster auf die Straßen. Prächtige Stadt. Reich, korrupt und immer noch schön. Er wohnte seit zehn Jahren hier und liebte die Stadt trotz aller Verrohungen und Verwüstungen wie am ersten Tag. Vielleicht liebe ich sie sogar mehr als damals, dachte er. Mit Städten ist es anders als mit Frauen. Frauen bringen dich zuerst ganz hoch, ganz ins Paradies, und dann holen sie dich langsam und unter Schmerzen und Tränen und Flüchen und Qualen wieder runter in den Alltag, in den gewöhnlichen Schrecken der zu weich gekochten Eier, der Eifersucht, der gepanzerten Lippen, der Spinnweben um die Augen, nachts wenn die grauen Bäche fließen, vor dem Hahnenschrei. Aber Städte waren anders, sie waren aus Stein und Beton und Asphalt und Stahl, aus Erde und Maschinen und Himmel, aus großen Gefühlen, aus Dreck und Gewalt und Glück und Tod, aus den Millionen, die nachts ihre Angst betäubten und am Tag wieder die Fresse hinhielten und ihre Schulter ans Rad. Städte waren das Licht und die Künstlichkeit, das Beben der Straßen und die Musik, die aus den Mauern weinte. Städte konnte man lieben, wenn man die Menschen nicht mehr lieben konnte. (Das Glück des Profis [1982] S.196)
…oder so ähnlich.
Nur eine kurze Wortmeldung, so zwischen den Feiertagen: Heute gilt ja ganztägig das Tanzverbot. Dem stell ich einfach mal die Rezension zu einer Abhandlung über das Konzept „Tanzwut“ im Mittelalter entgegen. Weil ich es spannend & passend finde.
Nicht ganz so dolle sind die Sachen, die manchmal im Internet passieren. Ja, es gibt inzwischen auf alle Fragen dazu eine Antwort. Sicher, viele Probleme, Missverständnisse, Konflikte und Auseinandersetzungen haben ursächlich nichts mit dem Medium zu tun – Allzumenschliches, meist. Wer das ohne Netz haben will, kann ja mal in diversen linken Zusammenhängen (in rechten wahrscheinlich auch, da kenn ich mich nicht so gut aus) ähnlich viel Zeit und Diskussionen verbringen; Plena statt Kommentarspalten und Foren. Trotzdem: Nicht ohne Grund gibt es das unbestimmte Gefühl, hier unbedarfter, mithin geschützter agieren zu können. Es ist nun mal etwas anderes, ob der Geheimdienst jeden Tag vor der Tür steht und dein Tagebuch durchlesen möchte, oder ob er das über die Telefonleitung tut. Irgendwie so.
Was ich damit sagen will: Ich wollte jetzt eigentlich gar nichts schreiben. Höchstens wieder einen alten Text aus der Mottenkiste kramen. Weil ich immer noch nicht genau weiss, wo ich hinsteuere – die Titelerklärung zum Blog lieferte ich ja, und das war anfangs der Sinn dieser Veranstaltung hier. Keine Angst, es geht mir erstaunlicherweise überaus knorke. Ich schreibe viel, so viel wie lange nicht. Ich verbrachte wunderbare Tage bei wunderbaren Menschen im wunderbaren Hamburg. Ich lese viel. Nur hier wäre eben kurzzeitig Schmalhans Küchenmeister gewesen.
Wenn nicht die Sache bei tikerscherk drüben passiert wäre. Wobei ich natürlich nicht weiss, was passiert ist; nur das, was sie selbst dazu schrieb. Und dass mich das sehr getroffen hat, weil sie meine allerliebste Lieblingsbloggerin ist. So. Wenn es jemand nicht verdient hat, Opfer von so einem Mist zu werden, dann sie. Mich erinnerte das an die Fake–Geschichte, die mich auch sehr bewegt hat, aus der Ferne. Krasse, interessante, verstörende Geschichte, dachte ich damals. Schlimm, dass so etwas überhaupt passiert – und schlimmer, dass es jetzt jemanden traf, den ich auf eine bestimmte Art glaube, zu kennen. Wenn man was zu Ostern wünschen kann, dann wünsche ich der hochgeschätzten tikerscherk, dass sie über all das Nachdenken, Reflektieren und Zweifeln irgendwann dahin kommt, wieder solche Texte schreiben zu können. Sonst nichts.
Und deshalb musste ich meine Blogroll akut anpassen und hab dabei gleich einen Kalender rechts eingefügt. Die großen Würfe folgen später. Vielleicht. Alles weitere & besser verständlichere, wahrscheinlich, steht drüben beim kiezneurotiker.
Anfangs dachte der junge Dichter, er hätte Glück gehabt. Er wurde vom Arbeitsamt offiziell als beschäftigungsloser Schriftsteller anerkannt. Das verschaffte ihm zwar weder Geld noch Ruhm, aber immerhin: ihm stand eine Muse zu.
Und die tat nun auch schon seit gut drei Jahren ihre Dienste. Gut – es war eine vom Arbeitsamt gestellte Muse, die brachte jetzt nicht von heute auf morgen den Literatur-Verdienstorden, aber sie sorgte für einen kontinuierlichen Schaffensprozess, was ja für das schriftstellerische Selbstwertgefühl auch nicht unwesentlich ist.
Doch mit der Zeit begann der junge Dichter, sich in eine Richtung zu entwickeln, die der Muse nicht gefiel. Sie war, wenn man ehrlich ist, ein wenig herrisch und selbstgerecht. Am liebsten wäre sie eigentlich Literaturkritikerin geworden, doch das Arbeitsamt hatte nun mal bloß eine Stelle als Muse frei. Und diese lyrischen Verirrungen, die ihr Schützling da in letzter Zeit beging, die passten ihr gar nicht.
Das ließ sie den jungen Dichter auch deutlich spüren. Nachdem er ihr sein jüngstes Werk vorgetragen hatte, setzte er zur Erklärung an: „Weißt du, die Idee dazu entstand, als ich an diesem Laden vorbeiging, dessen Name so lustig war…“ – „Ach halt doch die Klappe“ blaffte sie, „das war eindeutig Schrott! Wenn du anfängst, ein Gedicht erklären zu müssen, ist es Schrott.“
Mit dieser Reaktion hatte er nicht gerechnet. Der eigentliche Plan des jungen Dichters war, in Kürze ein Lyrikband herauszugeben. Er hatte auch schon alles Nötige in die Wege geleitet, größtenteils. Ihm fehlte nur noch ein Verlag. Er hatte die Schnauze voll von dem ewigen Prosa-Geschreibe. Diese Gattung kam ihm inzwischen so banal vor. Jedenfalls, wenn man wie er ständig übers Ficken schrieb. Das wirkte bei Lyrik irgendwie angenehmer. Er konnte es jetzt gar nicht haben, dass ihm die Muse da in die Quere kam und sein Schaffen misskreditierte.
Sie musste weg.
Am nächsten Morgen ging der junge Dichter in eine Drogerie, die ihm aus dunklen Kanälen heraus empfohlen wurde. Dort bekam er unter dem Ladentisch die Pillen, die er brauchte. Er nahm ein paar von den bunten Dingern, und für 48 Stunden war er jeglicher Kreativität beraubt.
Der junge Dichter wusste, dass die Muse diese lange Versorgungsunterbrechung nicht überstehen würde. Und wirklich, als er danach das erste mal wieder einen kreativen Gedanken fasste, hörte er keine Stimme mehr, die ihm dazwischen redete. So konnte er in den nächsten Wochen unbesorgt seinen lyrischen Trieben freien Lauf lassen. Er schaffte es sogar, von dem Lektorat eines mächtigen Verlags vorgeladen zu werden.
Nachdem er ein paar Kostproben vor dem Gremium rezitiert hatte, baten ihn die Herren, noch einen Bewerbungsbogen auszufüllen. Gefragt waren Standards a lá „Geburtsort“ oder „Datum der ersten Inspiration“. Der junge Dichter machte alle verlangten Kreuzchen und Angaben und bedankte sich bei den Selektoren.
Zu seiner großen Überraschung kam bereits nach fünf Tagen ein Schreiben: „Sehr geehrter junger Dichter, wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir beabsichtigen, Sie in unser Programm aufzunehmen. Wir sind der Meinung, dass damit nicht nur Ihnen, sondern unserem gesamten Gemeinwesen gedient ist. Um den Vertragsabschluss komplett zu machen, müssen Sie lediglich an den angekreuzten Stellen unterschreiben und den letzten Quartalsbericht ihrer Muse anheften. Mit freundlichen Grüssen!“
Da war sie wieder. Der junge Dichter hatte sie längst erfolgreich verdrängt, er wusste schon gar nicht mehr, dass er mal eine Muse hatte. Jetzt aber holte sie ihn wieder ein. Gleich am nächsten Morgen ging er pflichtbewusst zum Arbeitsamt, um einerseits eine Muse als vermisst zu melden, und anderseits den nahezu perfekten Vertragsabschluss anzuzeigen. Dort würden sie ihm bestimmt auch einen Musen-Ausfallsschein ausstellen können.
„Junger Mann, so geht das aber nicht!“ begann die Dame hinter dem großen Schreibtisch ihre Predigt, „Sie hätten den Verlust ihrer Muse schon vor zwei Monaten anzeigen müssen! Wir stellen ihnen ja hier nicht die Mittel zur Verfügung, damit sie sie nach Belieben verschleudern. Dafür opfert sich das Gemeinwesen nicht auf, damit die Künstler dann so leichtsinnig mit ihrer Aufgabe umgehen! Den Vertragsabschluss können sie vergessen, dafür gebe ich ihnen keine Ausrede-Dokumente.“
Nach dieser Standpauke drückte die Verwaltungsbeamtin einen Knopf und der junge Dichter mit dem blumigen Namen wurde abgeführt und dem zuständigen Steinbruch übergeben.
(2003)
Aus Gründen fahre ich neuerdings regelmässig nach Köpenick. Davor war es Reinickendorf, da war die Strecke mit dem Rad schöner, fast immer durchs Grüne und am Wasser lang (auch wenn es der Hohenzollernkanal war…). Im Gegensatz dazu ist der Weg jetzt nur bis zur Rummelsburger Bucht wirklich angenehm, obwohl die Industriearchitektur in der Gegend von Nalepastrasse und Klingenberg zugegebenermassen auch etwas hat.
Wie auch immer, in der letzten Zeit bin ich sowieso meist mit der Bahn gefahren. Und da muss ich wohl oder übel die Warschauer Brücke überqueren. Als Verbindungsglied von Kreuzberg und Friedrichshain scheint sich hier alles zu konzentrieren, was an Klischees über den Doppelbezirk so im Umlauf ist. Hipster, Hippies, Anzugträger – Gentirifizierer und Gentrifizierte. Und Touristen natürlich. Was soll ich sagen: Ich finde das gut. Ich versuche in letzter Zeit verstärkt, gelassen zu sein. Nicht zu hassen. Natürlich weiterhin mit kritischem Blick, aber eben ohne die saure Galle. Ein wenig komme ich mir dabei manchmal wie Mr. Burns nach seiner freitäglichen medizinischen Behandlung vor – trotzdem: Ist es nicht auch toll, dass alle diese verschiedenen Menschen dort auf dieser Brücke entlanglaufen und sich kaum aneinander stören? Kann man es nicht auch mal einfach gut finden, für wen und was alles in dieser tollen Stadt Platz ist?
Nicht ganz so toll ist allerdings, dass dann später in Köpenick auch Platz für die NPD-Bundeszentrale ist. Normalerweise macht diese einen bewusst unauffällig-verrammelten Eindruck, es gibt nur ein kleines Metallschild im Hauseingang. Nun hat aber auch bei den Nazis der Wahlkampf für das EU-Parlament begonnen, und das nach dem Großspender C.-A. Bühring benannte Haus wurde in ein Banner gehüllt: „Festung Europa schaffen – Asylflut stoppen“ prangt dort in großen Lettern. Jetzt ist es allerdings so, dass diese Losung nicht die unoriginelle Antwort auf die der politischen Gegner ist, der lediglich ein „ab“ vor dem „schaffen“ gestrichen wurde. Denn Nazis für dumm zu halten heisst, sie zu unterschätzen. Es gibt durchaus kluge Nazis, das ist kein Oxymoron. (Morons sind sie, klar.) Und ich kann mir gut vorstellen, dass einige von ihnen wissen, woher das Gerede von der „Festung Europa“ kommt.
Mir ist es kürzlich bei der (schon erwähnten) Lektüre der Kellner-Tagebücher aufgefallen. Dort berichtet Friedrich Kellner immer wieder, wie in den Presseerzeugnissen der Nazis die „Festung Europa“ gefeiert wurde, uneinnehmbar für Amerikaner und Engländer. Seine Notiz dazu vom 25.04.1943:
Der „Atlantik-Wall“ ist z.Z. ein sehr beliebtes Agitationsthema in der Presse und im Rundfunk. Dem Spießbürger wird beigebracht, daß er sich in der „Festung Europa“ vollkommen geborgen fühlen kann. (Bd. I, S. 406)
Kurz darauf wollten die Nazis dann allerdings nicht mehr von der „Festung Europa“ sprechen. Als der Feind näher rückte, klang das zu sehr nach der Belagerung, die sich ja auch in der Realität abzeichnete. Auch vom Krim-Schild las ich bei Kellner und dachte mir, dass es sowas bestimmt bald wieder geben wird. Es muss nur noch ausgefochten werden, welche Seite ihn stiften darf. (Wo ich schon mal beim Thema bin: Rosa Luxemburg fand übrigens weder das Selbstbestimmungsrecht der Völker noch die Ukraine als Nationalsstaat besonder toll.)
Was mir beim Lesen der Tagebücher noch auffiel: Wie gerne Hitler und die Seinen das Wort „zwangsläufig“ verwandten. Klingt ein wenig nach „alternativlos“… man sollte mal wieder LTI lesen. Gerade jetzt.
All in all is all we are.
Ich war fast siebzehn, es war Freitag und ein Mädchen aus der Parallelklasse hatte sturmfrei und lud alle dazu ein. Einem weiteren legendären Wochenende in der ewig scheinenden Jugend schien also nichts im Wege zu stehen – auch, weil an diesem Abend die Anderen von der Skifahrt zurückkommen sollten.
Die sturmfreie Bude war eigentlich eine alte Kapitänsvilla mit Blick auf den Sund, das Mädchen dazu eine hübsche, leicht ausgeflippte Arzttochter mit wirklich kastanienfarbenem Haar und wir waren das, was solch eine Stadt an Punks, Hippies und sonstigen Alternativen – oder wie man hier mehrheitlich zu uns sagte: Zecken – zu bieten hatte.
Am späten Nachmittag begannen wir mit ein paar Haschkrümeln und Bieren den Abend einzuläuten und machten uns langsam auf den Weg zur Party. Viel war noch nicht los, nur die Mädelsclique der Gastgeberin war schon da, um alles schön vorzubereiten und zu dekorieren, was später – wie auf Teenagerpartys üblich – vollgekotzt, umgeworfen oder mit klebrigen alkoholischen Getränken überschüttet werden sollte.
Wir machten es uns im Raucherzimmer des Vaters bequem, dort gab es eine gut sortierte Hausbar, interessante Bücher und einen kleinen 37er Fernseher. Die Stimmung brauchte gar nicht lange, um in Gang zu kommen, auch weil der Oberkiffer mit seiner doppelt gekühlten Bong kurz darauf eintraf. Wir wussten, dass er die nur mitnahm, wenn er auch genügend Gras dabei hatte. Das sollte übrigens seine letzte Party für eine lange Zeit werden: während wir unser Abi schrieben, verbrachte er als erstes Drogenopfer unserer Stufe die Tage in der Geschlossenen, mit Meerblick immerhin. Das Scheisssynthetikzeug war schuld.
Es versprach also, ein großartiger Abend zu werden. „Hamburg lässt grüßen!“ sagte der Oberkiffer, wedelte dabei freudestrahlend mit dem prall gefüllten Grasbeutel und begann, den ersten Kopf zu stopfen. In den nächsten Stunden bewegten wir uns nicht aus dem Raum, es sei denn, um Getränke zu holen oder wegzuschaffen. Wir quatschten Blödsinn, der natürlich unglaublich tiefsinnig, philosophisch und weltverändernd war. Manchmal lasen wir dazu ein paar passende Sätze aus den klugen, in Leder gebundenen Klassikern, aber eigentlich lachten wir die meiste Zeit: über die Comics im Fernsehen oder über uns. Wie solche Partys halt in diesem Alter so sind.
Die Gastgeberin und viele, viele andere Besucher schauten ab und zu mal bei uns vorbei, einige für länger und ein, zwei Köpfe, andere nur zum Kopfschütteln. Schließlich meinte die Hausherrin: das ist hier eine Party, also bitte auch Musik!
Nun war das Raucherzimmer zwar umfangreich ausgestattet, aber eine HiFi-Anlage gab es darin komischerweise nicht, nur ein Kofferradio für die Bundesligakonferenz. Doch das war kein Problem, wir schalteten einfach einen der Musiksender im Fernsehen an, wo damals wirklich noch Musik lief, und zwar gar keine schlechte, für unsere Zwecke jedenfalls. Mal lief es nebenbei zur Untermalung, mal drehten wir voll auf, wozu dann dem Rausch- und Lärmpegel entsprechend getanzt wurde. Wir amüsierten uns allesamt prächtig, es waren noch ungefähr zwei Stunden hin, bis der Bus aus Harrachov ankommen sollte.
Doch mit dem Amüsement war es ganz schnell vorbei, als die Musik jäh unterbrochen wurde: Sie hätten Kurt neben einer Schrotflinte gefunden, sagte der englische Musiknachrichtensprecher. Eine Ewigkeit von fünf Minuten schalteten wir alle Musik- und Nachrichtensender, die das Kabelnetz hergab, durch – bis wir es irgendwann schliesslich glauben mussten. Zwei oder drei Leute begannen zu schluchzen, andere stierten vor sich hin. Ich rannte brüllend aus dem Haus, in den Garten, wollte im Rasen versinken. Es war doch grad mal zwei, drei Jahre her, dass ich entdeckte, wie grossartig und exakt dieser Mensch meine Befindlichkeiten ausdrücken konnte, das konnte doch jetzt nicht einfach so vorbei sein!
Es dauerte eine Weile, bis die Nachricht alle Partygäste in den verschiedenen Räumen, Etagen und dunklen Ecken erreicht hatte – auch, weil wir Hiobs etwas brauchten, um ansprechbar und artikulationsfähig zu sein. Auf einmal wich die aufgelöste Stimmung einer bedrückenden Ruhe, selbst bei denen, die nie viel mit dieser Art Musik anzufangen wussten.
Einige wenige begannen dann, leise und vorsichtig weiter zu feiern, wir zogen uns erstmal wieder ins Raucherzimmer zurück, um die Live-Berichterstattung weiter zu verfolgen. Wir waren jetzt ausserordentlich dankbar für das gute Hamburger Gras, drehten jedes verdammte Musikvideo bis zum Anschlag auf und schrien verzweifelt die Texte mit. Ein würdiger Abschied, wie wir fanden, aber irgendwann fiel uns die Decke auf den Kopf und wir mussten raus, brauchten frische Luft.
Da passte es gut, dass die geplante Ankunftszeit des Skifahrt-Busses fast erreicht war. Wir gingen langsam unten an der Promenade entlang zur Schule, still, bis auf ein gelegentliches „“Verdammte Scheisse, das kann doch nicht wahr sein!“ verließ kein Wort unsere Lippen, nur ein paar Rauchschwaden der vorgedrehten Dreiblattjoints. In sicherer Entfernung zum Schultor hielten wir an und schlugen unser temporäres Lager auf, der Bus musste jeden Augenblick kommen. Ein paar Eltern standen an der Strasse, aber bei weitem nicht alle, wir waren schliesslich schon in der Oberstufe. Sich von ihnen in ein Gespräch verwickeln zu lassen war trotzdem das letzte, was wir jetzt brauchten, die üblichen Interesse heuchelnden Allerweltsfragen konnten uns gestohlen bleiben.
Uns genügten die Wellen, die leise plätschernd an die Kaimauern schlugen.
Der Bus kam mit einer kleinen Verspätung um die Ecke bei der Feuerwehr gebogen und wir konnten die uns wichtigen Leute abpassen. Sie hatten natürlich noch keine Ahnung, auf der Fahrt liefen die ganze Zeit Mike Krüger- oder Fips Asmussen-Kassetten. Nach ein paar ungläubig-entsetzten Nachfragen glaubten sie es schliesslich – und doch konnten wir es alle zusammen noch längst nicht fassen. Still und wütend saßen wir auf der Mole, liessen die Füße baumeln und schmissen Kiesel und Kronkorken ins nachtdunkle Wasser.
Bis einer von uns aufsprang, den letzten Schluck aus der Stroh-Rum-Flasche (das übliche Mitbringsel von Skifahrten) trank, sie an die Brüstung warf und „Da müssen wir doch was machen!“ schrie. Darin waren wir uns alle einig, nur wussten wir nicht, was. Weil uns nichts Besseres einfiel, griffen wir uns die Farbdosen, die zum Handgepäck der gerade zurückgekehrten Sprayer gehörten. Wir wollten schon lange den Kampf ausfechten, jetzt starteten wir ihn: Der komplette Container, der seit Jahren für die Oberstufe als Provisorium auf dem Schulhof stand, wurde mit Parolen besprüht. In dieser Nacht gab es keinen Morgen mehr.
Als es dann wieder einen gab, wurden die Beweise gesichert und die Verweise ausgesprochen.
Kurt war damals zehn Jahre älter als ich. Jetzt bin ich zehn Jahre älter als er je geworden ist. Niemand konnte die Lücke füllen: Er fehlt. Immer noch. Eigentlich mehr denn je.
Was auch passiert, das (und so viel mehr) wird bleiben:
[Update: Tja, von wegen, jedenfalls was Youtube-Videos betrifft. Aber ich hatte noch dunkel im Kopf, dass ich das gemeinte Konzert früher schon verlinkt habe. Und dieser Link funktioniert noch. Ich pack es noch mal unten rein, mal sehen…]
Hier noch einer meiner Lieblingsnachrufe.
[Ja, es ist verdammt lang geworden: leicht überarbeitete & erweiterte Komplettfassung. Für alle, die Teil 1 + 2 schon kennen & nicht nochmal lesen wollen, geht es hier weiter.]
Intro:
Und Berlin war wie New York
Ein meilenweit entfernter Ort…
Es war irgendwann im August 1997, kurz vor Ferragosto, als mich im heissen Süditalien die Nachricht erreichte: Berlin! Jetzt!
Der Zivildienst war gerade beendet, der Studienplatz an der Humboldt-Uni zugesagt und mit der damaligen Freundin, die nach dem Abi schon zwei Semester Kunst hinter sich hatte, fuhren wir nun endlich durch Italien: Die klassische nicht ganz so grosse Grand Tour deutscher Abiturienten, schon irgendwie. Dafür hatten wir so Sachen wie Ferragosto gelernt, ganze drei Tage in den Vatikanischen Museen verbracht und uns wie in Arkadien gefühlt. Es war toll, selbst der kleine blaue Fiesta namens Ozzy hielt trotz mautvermeidenden Apenninenserpentinen tapfer durch. Und jetzt schien das mit der Wohnung im Prenzlauer Berg also auch geklappt zu haben! Wir hatten drei Tage, um von dem Fährableger statt nach Griechenland wieder zurück nach Hause zu fahren. Was ab jetzt Berlin hiess.
Vor dem Mauerfall war Berlin für mich – ausser Hauptstadt der DDR natürlich – ein Ausflugsziel, um mit der von dort stammenden Verwandtschaft in den Tierpark zu fahren, einzukaufen, noch entferntere Verwandte zu besuchen und die große, weite Welt zu bestaunen.
Als wir mal wieder umzogen, diesmal richtig weit und nicht nur ins nächste Dorf oder unter der Woche ins Studentenwohnheim, wurde Berlin Durchfahrtsort auf der Strecke zum Familienstammsitz. Oft fuhren wir dran vorbei, aber wenn die Eltern gute Laune und Zeit hatten, ging es auf der langen Fahrt längs durch die sozialistische Heimat nachts auch manchmal quer durch die glitzernde, blinkende grosse Stadt. So viele Lichter auf einmal gab es sonst nirgendwo in der ganzen Republik zu sehen. Ich sprang vor lauter Begeisterung auf der Rückbank des alten Skoda hin und her, bis ich nur noch müde und staunend mit offenem Mund da saß, als die Brandenburger Dunkelheit uns wieder langsam umhüllte, draussen auf der F96.
Noch eine Weile später, immer noch Kind, war Berlin für ein paar Sommer lang der Ort, von dem mich die Iljuschins in den grossen Ferien zu den Eltern brachten.
Da war es nur naheliegend, nicht nur geographisch, dass das erste Westgeld natürlich auch in Westberlin abgeholt und ausgegeben wurde: Doppelkassettenrekorder! Später dann soviel skurrile Klamotten, wie wir uns im Basement kaufen konnten: Kilopreise!
Der Zufall wollte es, dass wir kurz darauf ein paar Berliner kennenlernten, wegen denen wir in den nächsten Jahren auch immer wieder so oft wir konnten zurück kamen. Sie waren damals gerade dabei, eine Band zu gründen, die zufälligerweise ebenfalls Basement im Namen trug.
Ausserdem schaffte es der grosse Bruder des besten Freundes, der uns über die Jahre all die verbotenen und spannenden Sachen, Substanzen und Gedanken nähergebracht hatte, nach Weissensee. So waren wir fast jedes Wochenende in der Oberstufe hier: Es war ein Paradies. Selbst Hamburg, was ungefähr gleich weit weg war, schien uns längst nicht so so aufregend, trotz einiger Abenteuer, die wir dort erlebten. Obwohl es norddeutsch war, was uns wiederum vom Gemüt und der Sprache eher lag.
Also keine Frage, dass es für’s Studium die HU sein sollte – also Berlin. Was hatten wir inzwischen hier in den letzten Jahren schon alles erlebt, ausprobiert und kennengelernt! Die wilden 90er, manchmal sogar mit elektronischer Musik, da kam man kaum drum rum zu dieser Zeit. Und wie toll würde das erst werden, wenn man hier ganz und gar wohnte! Die Konzerte, die Partys, die illegalen Wochentagsbars irgendwo im Hinterhof, im Keller oder in einer leeren Wohnung. Das Bandito! Die Köpi! Der Eimer! Das Acud! Die Fehre! Der Schokoladen! Das Tacheles!
Wo wir lebten gab es dagegen – trotz Fachhochschule und laut DDR-Statistik festgestellten 77.000 Einwohnern – ganze zwei halbwegs passable Kneipen. Zum Tanzen fuhr man in die nächstgelegene Uni-Stadt, weil: Man wollte ja keine Chartmusik hören, sondern mindestens Indie, besser Punk oder Ska. Es wurde also höchste Zeit für die Metropole: Kindheit in Lausitzer Heidewäldern, Jugend an der Küste, und nun endlich Berlin – das war nur logisch.
Der grosse Bruder wohnte in der Senefelder, so wurde dieser Kiez unser Basislager. Grenze zu Mitte, Klo auf der halben Treppe, ein Zimmer mit Hochbett und Ofenheizung. Deshalb wollte ich auch unbedingt die Wohnung in der Christburger haben, wegen der wir die 2200 Kilometer von Brindisi in die alte Heimat und die 300 Kilometer von dort zurück nach Berlin gern in einer Drei-Tage-Monstertour abrissen: Mir war die Gegend sehr vertraut, ich fühlte mich hier schon heimisch, bevor ich es überhaupt war.
Zwei Zimmer Altbau, Wannenbad, Gamat-Aussenwandheizkörper. Die Vormieter aus Moskau sagten, sie hätten eine Greencard gewonnen und wollten weiter gen Westen ziehen. Ich liess mich mit 1.500 Mark Abstand für ein paar Möbel und anderen Kram über den Tisch ziehen, aber es war immerhin die erste eigene Wohnung und dank der Zivi-Abfindung samt rund-um-die-Uhr-ISB-Zuschlag konnte ich das problemlos verschmerzen. Also machten wir uns ans Renovieren. Beim Stuckabpinseln und Malern wurden dann die Modalitäten für die zukünftige Fernbeziehung festgelegt: Sie wollte von Anfang an nicht in Berlin studieren – zu gross, zu viel los und nicht zuletzt kein passender Studiengang.
Dann der Semesterstart: Ausgestattet mit jahrelanger Berlin-Besucher-Erfahrung, einer wunderbar dilettantisch hergerichteten Erstsemesterwohnung im Prenzlauer Berg und unbändiger Vorfreude stürzte ich mich von den Einführungsveranstaltungen direkt in das Zentrum des Aufstands. Was mich bis heute versaut hat.
Schon bevor mit dem Streik alles Übel seinen Lauf nahm, fand sich recht schnell ein kleines Grüppchen zusammen, dank der verschiedenen Magisterteilstudiengänge bunt gemischt. Einige hatten Wohnungen oder WGs in Mitte, andere im Prenzlauer Berg, nur wenige in Kreuzberg – die wohnten dann meist schon länger in Berlin. Selbst Avantgardisten aus Friedrichshain waren dabei; vereinzelt gab es auch Leute aus Lichtenberger Studentenwohnheimen, Charlottenburger Hinterhofwohnungen oder aus Spandau. und es gab schon damals nur verschwindend wenige Urberliner. Anfangs waren die Freundeskreise noch in Bewegung – gerade auch durch die ganze Streik-Geschichte – aber bestimmte Kerne bildeten sich doch recht schnell und blieben sehr lange bestehen. Wir eroberten Berlin auf so vielfältige Art und Weise:
All das Wissen, was die Uni zu bieten hatte, selbst und gerade in den autonomen Streik-Seminaren. All die Kultur an jeder vergammelten Strassenenecke, an denen damals noch der alte Ostberliner Putz abbröckelte (Lesebühnen! Schlingensief!). Die Menschenmassen überall, mal als Beobachtungsobjekt, mal als ein Etwas, dem man selbst angehörte. Interessante neue Menschen und Begegnungen allerorten. Und auf einmal ist man mitten im Geschehen und meint – euphorisch wie man ist – einen Hauch von Anarchie und Revolution zu spüren, der sich hartnäckig an einem festsetzt. Tagsüber dem Universitäts- und Politgeschäft nachgehen und nachts dann die Tour runter vom Prenzlauer Berg, über die Sredzki-, Ryke- und Kollwitzstrasse bis zur Zionskirchstrasse oder Senefelder Richtung Mitte, und in jedem dritten Hinterhof tat sich eine neue Welt auf. Zum Schluss landete man immer irgendwie beim Imbiss International.
Die Wohnung in der Christburger hielt nicht lange, aber immerhin länger als die Fernbeziehung. Die war im Frühling vorbei: Die Verlockungen waren zu gross, die Strecke zu weit, wir zu jung und das neue Leben zu fordernd. Wie ich später herausfand, wurde auch schon im Herbst bei einer der ersten Vollversammlungen ein interessierter und folgenreicher Blick auf mich geworfen.
Irgendwann im neuen Jahr, nach der verhängnisvollen Silvesternacht, in der ein Stuhl in der Heckklappe des Fiesta landete und dessen langsamen Untergang einläutete, kam dann die Nachricht von der WIP: Meine Wohnung würde – zusammen mit tausenden anderen – von der kommunalen Genossenschaft verkauft werden. Sanierung und so weiter wahrscheinlich, man sollte sich mal unterhalten. Nach gerade mal einem knappen halben Jahr.
Würde ich irgendeinen roten Heller auf Herkunft legen (was ich natürlich mache), dann hätte ich bestimmt längst Zigeunerblut zwischen den ganzen Kommunisten, Sorben, Juden und Franken in der Ahnentafel ausgemacht. Schon bevor ich die erste eigene Wohnung in Berlin bezog, bin ich gut ein Dutzend Mal umgezogen. Einerseits lag das an dem unsteten Lebenswandel der Mutter, doch auch die dörferfressenden Braunkohlebagger trugen dazu bei, ebenso wie die Sportkaderförderung der DDR, die ich kurzzeitig am eigenen Leib erfahren durfte, und der Auslandsaufenthalt der Eltern.
Deshalb war der anstehende Umzug eigentlich kein Problem für mich. Über politische Theorien zum Thema Verdrängung machte ich mir damals noch keine grossen Gedanken, wenn, dann nur am Rande und ohne das, was um mich herum passierte, konkret in diese Überlegungen einzubeziehen. Ich war jung, und Jugend braucht Veränderungen, auch räumliche. Ärgerlich war lediglich die Arbeit, die wir liebe- und mühevoll in Bad und Küche, Stuck, Dielen und Türen gesteckt hatten. Als Trostpflaster gab es immerhin 2.500 Mark, womit das nächste halbe Jahr Miete und Leben gesichert war. Der Norma in dem Zelt vorne an der Prenzlauer war zwar unsagbar hässlich, aber auch unschlagbar billig.
Inzwischen – das nahm noch in der Christburger seinen Anfang – war ich mit besagter Blicke werfenden Frau zusammen gekommen, ohne viel eigenes Zutun. Sie, ein radfahrverrückter halbniederländischer Friese und ich bildeten die eingeschworene norddeutsche Aussenstelle, später kamen noch ein Schweriner und ein Bremer dazu.
Dieses Mal war es auf Kuba – der erste grosse gemeinsame Urlaub – als uns die Nachricht erreichte, dass der Friese eine sehr schöne, sehr grosse, sehr preiswerte und etwas ungünstig geschnittene Wohnung in der O-Strasse aufgetan hatte. Zwar direkt über einer Kneipe, aber was soll’s, wir waren Studenten, es gab ein paar interessante gewerblich genutzte Hinterhöfe samt ständig präsentem Haus-Hof-Meister mit Schnauzer über der Berliner Schnauze – und eben: Kreuzberg!
Madame wohnte damals noch in Moabit, Beusselkiez. Ihre Berliner Verwandtschaft, die tief im Westen neben Grönemeyer residierte, hatte das organisiert. Zu dieser Zeit war diese Gegend ein grauer Fleck auf allen Stadtplänen, die man als frischer Student so im Kopf hatte – abgesehen von den Nazis der gleichnamigen Kameradschaft, von denen hatte man sehr wohl schon was gehört. Es war nicht ganz so billig wie im Prenzlauer Berg, dafür in den 80ern saniert, halbwegs zentral zu allen drei Unis gelegen und mit vernünftiger Heizung.
Wenn ich mir (was ich oft tat) spätnachts von der Uni, aus der Christburger oder irgendeiner Kneipe in der Nachbarschaft auf wackeligen Rädern den Weg Richtung Westen bahnte und der Morgen irgendwo zwischen Tiergarten und kleinem Tiergarten zu dämmern begann, dann konnte ich mir, trunken und liebestrunken wie ich war, kaum vorstellen, glücklicher zu sein. (Manchmal stieg ich vom Rad – manchmal fiel ich – und legte mich einfach auf den taunassen Rasen zwischen die vorsichtig aus ihren Löchern lugenden Kaninchen, blickte in den Himmel, war überrascht, dass die Siegessäule an einer ganz anderen Ecke auftauchte als gedacht und genoss den Moment, die Gegenwart, das Leben und den ganzen Rest.) Bis sie mir die Tür öffnete, verschlafen und wunderbar.
Und nun also Kreuzberg. Der Weg nach Moabit war ähnlich weit, der zur Uni sogar kürzer und überhaupt: Es war fantastisch.
Als ich in die Christburger einzog, ging in der gesamten Strasse nur das Haus direkt gegenüber als saniert durch. Als ich nach einigen Jahren dort wieder vorbei schaute, gab es noch ganze zwei unsanierte Häuser. In Kreuzberg dagegen schien die Zeit mehr oder weniger stillzustehen seit den 80ern. Sicher, es war viel passiert – und es würde noch viel mehr passieren! – aber als wir hier ankamen, schien es sich nur sehr, sehr langsam zu verändern. Ausgehen, falls man das denn so nennen kann – fand jedenfalls noch lange überwiegend eher in Mitte, Friedrichshain oder Prenzlauer Berg statt.
Allerdings hatte auch Madame langsam, aber sicher Gefallen an dem Kiez gefunden; jenseits der Legenden und des stetigen Studentenzuflusses war es hier auch einfach sehr schön: Bunt, grün, zentral, Kanal. Und immer mehr Bekannte, die in der Gegend wohnten.
Ein paar Häuser die O-Strasse rauf zum Beispiel zwei, die bald zu unseren engen Freunden zählen sollten, erstaunlicher- und erfreulicherweise beides geborene Westberliner und keine Studenten. Dafür aber in der Punk- und Skinkultur grossgeworden und dort noch tief verwurzelt. Wieder so viele neue Erfahrungen und Einblicke! Und ein Hund: Wie sich das für ordentliche Potse-Punks gehörte, hatten die beiden einen Hund. Besser gesagt eine Hündin, die beste, die man sich vorstellen konnte. Sie sollte nun geplanterweise die Berliner Hundebevölkerung um weitere anarchistische Racker bereichern. Was ich wieder viel zu spät registrierte war, dass Madame auch hier schon längst was ins Auge gefasst hatte.
Lass uns doch einfach mal ganz unverbindlich die Welpen angucken gehen, meinte sie. Es bedurfte aber ehrlich gesagt auch keiner grossen Worte, mich davon zu überzeugen, diesem kleinen, braunen, erst ein paar Tage alten Fellknäuel zukünftig ein zu Hause zu bieten.
Das sollte Madames neue Kreuzberger Wohnung werden: Knapp ein halbes Jahr nach unserer WG-Gründung, wieder war es Sommer, begab sie sich auf Wohnungssuche in 36 und 61, was damals noch gemütlich war, wenn man die heutigen Zustände betrachtet. Als wir bei der ersten Besichtigung eintrafen, fand keine 15 Minuten entfernt gerade die letzte Loveparade des Jahrtausends statt; gleich um die Ecke lag der geographische Mittelpunkt Berlins.
Zu dieser Zeit gingen wir noch davon aus, dass ich erst mal in der O-Strassen-WG bleiben würde, trotzdem suchten wir – gerade auch wegen der niedrigen Preise – grosszügig. So rutschte die eigentlich für eine Person viel zu grosse 3-Raum-Wohnung in die Auswahl: Vorderhaus, Ofenheizung, Balkon mit Blick auf die Hochbahn.
Die Vormieter, eine Kleinfamilie, wollten wegen des demnächst anstehenden Schulbeginns ihres Kindes dann doch in eine eher ruhigere Gegend ziehen. Sie hatten immerhin ordentlich selbst Hand angelegt: Küche und Bad sahen ganz passabel aus, erstere recht gross, letzteres in der üblichen Altbau-Schlauchform, aber zumindest gekachelt und mit vernünftiger Duschkabine. Die Öfen störten nicht weiter, kannten wir ja von vielen Bekannten – eigentlich waren wir damals eher die Aussenseiter: Studenten, die nicht mit Kohlen heizten.
Dadurch, dass ich aber auch früher schon längere Zeit in der Wohnung des grossen Bruders in der Senefelder zubrachte, war ich mit Kohleöfenbefeuerung recht vertraut und versprach Madame, dass ich ihr das gerne beibringen würde.
Als wir bei der Besichtigung dann schliesslich auf dem schönen grossen Balkon standen (von dem wir bei dieser Gelegenheit erfuhren, dass er eigentlich Loggia hiess), sahen wir direkt unter uns ein paar recht punkig daherkommende Nachbarn das Haus verlassen. Sie bekamen trotz des Strassenlärms mit, wie die Mitbewerber und wir uns über die Brüstung gebeugt laut unterhielten, und schauten zu uns nach oben, wobei sie freundlich grüssten, indem sie mit den Äxten winkten, die sie in den Händen hielten: „Willkommen, neue Nachbarn, wir gehen jetzt zur Loveparade!“ Das gefiel uns.
Nachdem die Besichtigung vorbei war, gingen wir Richtung U-Bahn, unten am Kanal lang. Madame sagte, sie müsse sich erst mal auf eine der Bänke setzen und durchatmen, zur Ruhe kommen. Sofort hätte sie sich in die Wohnung verknallt, sie wollte sie unbedingt haben. Das wunderte mich dann doch ein wenig: Sicher, wir waren in den gleichen Kreisen unterwegs, und sie war mir in manchen Belangen weit voraus, nicht nur mit ihrer Bongsammlung und ihrer Wagenburgvergangenheit. Trotzdem steckte ihre wohlbehütete westdeutsche Obere-Mittelschicht-Herkunft tief in ihr drin, wozu sie auch stand, was unsere Beziehung ab und an recht interessant machte und wofür ich sie auch liebte, unter anderem.
Deshalb überraschte es mich ein kleines bisschen, dass ihr weder die über die letzten Jahre gesammelten und im Hausflur angeklebten Revolutionäre-Erste-Mai-Aufrufe noch die sonstigen, teilweise durchaus sehr ansprechenden Kunstwerke an den Hauswänden etwas ausmachten. Ganz zu Schweigen von der Ofenheizung, der Sperrmüllsammlung im Hinterhof oder der aufgerissenen, notdürftig mit einer Hühnerleiterkonstruktion ersetzten Treppe im Vorderhaus. Das Haus hatte nämlich Schwamm, wie wir später erfuhren. Ach was: das Haus – der gesamte Block!
Doch ganz im Gegenteil, es gefiel ihr sehr, gerade auch weil es von aussen daherkam wie eins der damals noch existierenden besetzten Häuser. Ich hatte noch viel über sie zu lernen, das begriff ich langsam.
Gut einen Monat später war es soweit. Madame hatte gegen die für damalige Verhältnisse riesige Anzahl von sieben Mitbewerbern den Zuschlag bekommen. Am Tag der Sonnenfinsternis war der Umzug, beides gute Anlässe für die Party danach. Auf den obligatorischen „Es könnte etwas lauter werden, ihr könnt gerne vorbei kommen“-Zettel hin fand sich – bis auf wenige Ausnahmen – die gesamte neue Nachbarschaft ein.
Die nächste gute Überraschung, die das Haus barg, auch wenn sie uns zuerst ein wenig überforderte. Partys sollte es in den nächsten Jahren hier noch unzählige geben: Komplette Hauspartys, das jährliche Hoffest mit Livebands im Sommer, Silvester auf dem Dach, Grillpartys ebenda, und natürlich die obligatorischen Privatfeiern in den Wohnungen, geplante zu Geburtstagen oder ähnlichem wie auch spontane, weil plötzlich so viel Besuch auf einmal da war oder die ganzen guten Clubs und Kneipen schon geschlossen oder zu weit weg waren.
Wir fühlten uns alle drei sehr wohl in der neuen Wohnung: der rasant wachsende kleine Hund, Madame und auch ich. So war es kein Wunder, dass die gemeinsame WG mit dem Friesen für mich nach und nach nur noch die Funktion einer Abstellkammer hatte, trotz der netten Gesellschaft und der vorzüglichen Lage, die uns zum ersten Mai immer ein paar Kamerateams im Wohnzimmer bescherte. Aufrecht, wie wir waren, versuchten wir nicht, von dieser privilegierten Situation zu profitieren, sondern vergaben die Fensterplätze an diejenigen, die dann im Nachhinein nachweisen wollten, wie die schlecht getarnte Staatsgewalt die brennenden Mülltonnen aus den Hinterhöfen zog und mit welchen Codes sie sich verständigten.
Uns das einzugestehen, war auf die eine Art unschön, da die gemeinsame Zeit nun wohl vorbei war. Andererseits hatten Madame und ich in der Gitsch gut zusammen gefunden und auch so viele neue Leute kennen zu lernen – da lagen alte Kontakte durchaus mal eine Weile brach.
Der Balkon wurde bepflanzt, die Wände gestrichen und die Zimmer eingerichtet. Wir waren begeistert von dem professionell gezimmerten Podest im Schlafzimmer und genervt von den morschen 80er-Jahre-Kindersicherungen an den Steckdosen.
Als Überraschungsgeschenk zur Einweihung besorgte ich zusammen mit dem Schweriner nach durchzechter Nacht eine spezielle Hängematte: Er wohnte noch im Prenzlauer Berg und dort sprossen auf nahezu jedem freien Stück Land Kinderspielplätze aus dem Boden, die oft mit sehr grossen und stabilen Kletternetzen ausgestattet waren. Eins davon hing dann – nachdem ich lange die dicken Holzbalken in der Altbaudecke gesucht habe – mitten in unserem Kreuzberger Wohnzimmer, mit halbwegs professionellen Seilzügen ausgestattet. Als nächstes galt es, die Nachbarschaft zu erkunden, ehrlich gesagt konnten wir nach der Party kaum einen Namen oder ein Gesicht zuordnen, es war einfach ein zu grosses Gewusel.
Der Nachbar direkt nebenan war mit allerlei Technik ausgestattet: Zum Musikschrauben, wie er es nannte. Sein Hauptberuf bestand aber darin, Haschplatten mit dem Zug in die westdeutsche Provinz zu schaffen. Manchmal, wenn er zu faul war, schickte er sie auch einfach per Post. Dank dieser Tätigkeit konnte er sich auch das ganze Equipment leisten, ein Apple-Fanboy der ersten Stunde. Wir lernten uns näher kennen und schätzen, als ich kurz nach Madames Einzug in seinem Studio – die guten alten Zeiten – von den auf VHS-Bändern gesammelten Simpsons-Episoden alle Itchy-und-Scratchy-Parts rausschneiden wollte.
Bevor wir uns an die Arbeit machten, musste er erst einmal auf Betriebstemperatur kommen: Die Rechner wurden hochgefahren und die schlichte, doch trotzdem imposante Glasbong gestopft. Aus falschem Stolz heraus lehnte ich sie nicht ab und nahm einen tiefen Zug. Madame berichtete mir später, dass sie etwas überrascht war, mich mitten am Tag im Tiefschlaf auf der Couch zu finden, auf die ich mich wohl noch irgendwie hinüber gestohlen hatte. Die beiden lachten sich über mich kaputt, als er nach ein paar Stunden mit dem fertigen Zusammenschnitt bei ihr an der Tür klingelte. Immerhin hatte ich jetzt eine vorzügliche Haschquelle.
Direkt über uns wohnte der einzig normal scheinende Typ, er war circa zehn bis fünfzehn Jahre älter als wir und arbeitete seinem Äußeren nach auf dem Bau. Deswegen bekam man ihn wohl auch so selten zu Gesicht, die Tagesrhythmen waren doch sehr verschieden. Die Wohnung neben ihm stand leer. Im dritten Stock lebte eine Architektin, die eine Gasetagenheizung und häufig sehr lauten Sex hatte. In der anderen Wohnung auf dieser Etage befand sich die Drogenhölle.
Ich war nicht oft dort, letztendlich aber doch zu oft. Von hier bezog der Nachbar seine Platten, und meine paar Krümel bekam ich wohl fast zum Einkaufspreis von ihm. Die aus dem Dritten wollten mit solchem Kleinkram nichts zu schaffen haben, ihre Dimensionen waren, schon alleine wegen ihrer Kokserei, ganz andere.
Ab und zu verirrte man sich dann aber doch mal hier her: Wenn es etwas Besonderes und Seltenes zu verkosten gab, wenn eine Party gegeben wurde oder wenn man dem Notarzt mit dem Ersatzschlüssel die Tür öffnen musste, weil man einen panischen Anruf von oben bekommen hatte („Ich kann meine Beine nicht mehr bewegen, da muss irgendein Scheiss drin gewesen sein…!“).
Meist waren es allerdings die Gäste, die Grauzone, die um diese Wohnung herumwaberte, die dringend ärztlicher oder psychologischer Hilfe bedurften. Mickey Mouse zum Beispiel. So stellte sie sich debil grinsend vor, als sie mal versehentlich bei uns, zwei Treppen zu tief, klingelte. Und so stand sie in der Tür, bis wir sie auf die Idee brachten, vielleicht weiter zu suchen, wo sie hier doch falsch war. Ein paar Wochen später flog nachts um drei die komplette Kücheneinrichtung aus dem Fenster der Drogenhölle in den Innenhof. Erst der Inhalt des Kühlschranks, dann der Kühlschrank. Erst das Besteck, dann die Besteckschubladen und der klapprige Schrank. So ging das eine halbe Stunde: Wenn die zierliche, apathische Mickey Mouse Ärger mit ihrem Freund, einem der drei Höllenbewohner, hatte, konnte sie auf einmal ungeahnte Kräfte freisetzen.
Zusammen genommen waren das allesamt recht traurige und fahle Gestalten dort oben, sowohl die Kundschaft als auch die Bewohner. Trotzdem wuchsen sie uns mit der Zeit ans Herz, denn es waren eigentlich recht nette Zeitgenossen, keine Gangster-Dealer, eher welche von der Hippie-Fraktion. Deshalb war es auf eine Art auch schade, dass sie eines Tages ganz in ihre umgebauten alten Mercedesbusse und mit diesen dann gen Marokko zogen. Als sie ein paar Jahre später wieder auftauchten, zeigte ihre gesunde Gesichtsfarbe allerdings, dass das eine gute Entscheidung war.
Ganz oben, im Vierten, über der Drogenhölle, wohnten die – im Gegensatz zu unserem direkten Nachbarn – richtigen Musiker. Wie das in der Branche so üblich ist, gingen auch hier viele Leute ein und aus: Groupies, Freunde, Fans und Kollegen.
Aus dieser Masse schälte sich dann ein Kern von vier, fünf Leuten, die – als die Drogenhölle frei wurde – auch in das Haus zogen. Die WG im Vierten bestand aber eigentlich nur aus zwei Typen: Das verpeilte Genie mit dem markanten Lachen und der Keyboard- und Synthiebastler. Wir kamen gut miteinander aus und hofften für die damals mehr oder weniger erfolglos, aber enthusiastisch aufspielenden Jungs, dass sie irgendwann den Erfolg haben würden, den sie dann Jahre später auch hatten. Mindestens.
Neben ihnen wohnte eine weitere alleinstehende Frau, Künstlerin, die das halbe Jahr über in Goa oder auf Gomera oder sonst wo verbrachte. Sie war gut befreundet mit der Architektin aus dem Dritten, zu deren Schreiorgien sie auch gerne dazu stiess.
Abgesehen von uns im Vorderhaus gab es noch zwei Hinterhäuser – für uns hiessen sie Nummer eins und Nummer zwei, im Berliner Vermieterdeutsch aber wohl Quergebäude und Gartenhaus. Wie auch immer. Die allgemeine Pauschalisierung lautete: in Nummer eins wohnt die aktuelle Revolutionärsgeneration, in Nummer zwei die, die sich aufgrund der anstrengenden Kämpfe der 80er Jahre bereits in den Vorruhestand begeben hatten. Letztere bekam man auch seltener zu Gesicht – aus den Augen, aus dem Sinn – aber doch mindestens einmal im Jahr zum von ihnen ins Leben gerufenen und immer noch organisiertem Hoffest.
In Nummer eins hatte, wie auch an der Hausflurdekoration zu erkennen war, der örtliche Antifavorstand in einer heruntergekommenen WG mit unüberschaubarem Mitgliederbestand seine Zelte aufgeschlagen. Wenn man die Leute aus Nummer zwei sehen wollte, ging man zum alljährlichen Hoffest. Bei denen aus Nummer eins brauchte man nur die Pressekonferenzen nach den 1.Mai- oder sonstigen obligatorischen Kreuzberger Demos anschauen und schon sah man sie auf dem Podium, da half auch kein Dreieckstuch vorm Gesicht, selbst mit der Sonnenbrille und dem Basecap waren sie gut zu erkennen. Vor allem, da sie das Haus auch fast immer derart gekleidet verliessen.
Unter den Antifas wohnte die Säuferin, und zum Erstaunen aller lebt sie (dort) noch immer. Auch in ihrer Wohnung gab es ein reges Kommen und Gehen, zwangsläufig wechselte man ein paar Worte, wenn man sich im Hof beim Müll- oder Asche-Runtertragen begegnete. So lernten wir also auch die lokale Alkoholiker-Gang kennen, die sich meist vorne am U-Bahn-Kiosk draussen auf den Bänken traf und dort ihrem Tagesgeschäft nachging. Sie soffen so lange es ging unter freiem Himmel und immer in einer großen Gruppe.
Irgendwann wurde offensichtlich, dass der Typ, der gleichzeitig in zwei Richtungen schaute, und das fast immer mit einem irren Blick, wohl mehr mit der Säuferin teilte als nur den Schnaps. Dummerweise gehörte auch bei diesen Alkoholikern Gewalt zum Habitus, sie schwankte jetzt öfters mit einem blauen Auge durch den Hof. Wir schauten uns das eine Weile mit an, befragten sie in ihren seltenen lichten Momenten und als es einmal im Flur kräftig krachte – er schlug wohl erst sie, und dann vor lauter Wut die Glasscheibe der Hoftür aus dem Rahmen – sprinteten wir runter und machten ihm klar, dass er mit dieser Attitüde hier nichts mehr zu suchen hat.
Anschliessend nahmen wir sie erst mal mit nach oben, setzten einen Kaffee auf und unterhielten uns eine Weile mit ihr. Dabei stellte sich heraus, was sie uns mehrfach wortreich bestätigte: Ihr ist sowieso nicht mehr zu helfen. Sie war vor Jahren zum Kunstgeschichtsstudium nach Berlin gekommen und eben leider in falsche Gesellschaft geraten. Bei ihr war es halt der Alkohol, von dem sie nicht loskam, ebenso wenig wie von den falschen Typen. Ihre Saufkumpane begaben sich auch gerne mal in die Wattewelt, die Schore einem so vorgaukelt. Therapien hatte sie einige erfolgreich abgebrochen. Nach zwei Stunden aufwärmen und Kaffeetrinken liess sie sich immerhin darauf ein, uns wirklich Bescheid zu geben, wenn es brenzlig werden würde. Erschüttert und irgendwie hilflos mit der Einsicht in die Ausweglosigkeit des Säuferdaseins liessen wir sie wieder gehen.
Last but not least gab es dann noch den sympathisch durchgeknallten Polen und seine Freundin, die in Nummer eins unter dem Dach wohnten: Er war einer von den Axtträgern, die uns schon bei der ersten Wohnungsbesichtigung so positiv auffielen, und sie waren vom Äußeren her vielleicht Punks – die polnischen Punks waren damals in Berlin eine nicht zu unterschätzende Gruppe – aber musikalisch eher in der Elektroecke unterwegs. Das betrieben sie auch aktiv irgendwo im RAW-Tempel-Umfeld im Friedrichshain. In unserem Haus bauten sie sich später die ehemaligen Kugellager-Lagerräume aus und versuchten, mit einem Verein die Kids aus der Nachbarschaft von der Strasse und vor die Drumcomputer zu bekommen. Meistens war deren Terminkalender aber schon mit Drogen nehmen und verkaufen, Leute in der U-Bahn abziehen und im Familienunternehmen aushelfen ausgebucht.
Und mit der Wohnung der Polenpunks hat auch eines der denkwürdigsten Ereignisse in der Hausgeschichte unmittelbar zu tun:
Eines Tages wachte er mal wieder nach einer langen Partynacht auf, vielleicht war sein Hund schuld – den hatte ich ja noch gar nicht erwähnt, ein sehr netter Schäferhundmischling namens Albert, soweit ich mich erinnere, der für unseren Nachwuchs gern mal den grossen Bruder spielte. Jedenfalls tropfte etwas auf seinen Arm.
Nun war das Haus wie gesagt ziemlich runtergekommen und genau in der Ecke direkt unter dem Dach ergoss sich bei kräftigem Regen sowieso immer ein veritabler Wasserfall in den Innenhof. Es hätte also auch einfach Regenwasser sein können.
War es aber nicht. Das merkte er spätestens, als sich die Stelle, auf die die Tropfen gefallen waren, rot verfärbte und heftig anfing zu jucken. Er rief sofort Hausverwaltung, Arzt und schliesslich auch die Feuerwehr an.
Als ich an diesem Tag nach Hause wollte, war an der Strassenecke erst mal Schluss. Ich muss mit der U7 gekommen sein, sonst wäre es mir schon vorher aufgefallen: die U1 fuhr nämlich schon längst nicht mehr. Erst als ich dem Polizisten hinter dem Flatterband meinen Ausweis zeigte und schon allein wegen dem Hund, der alleine in der Wohnung war, unbedingt darauf bestand, noch mal ins Haus zu gehen, sagte der nur kurz „Na gut, aber schnell“ und schien wirklich besorgt dabei. Ich durfte den Spruch noch an drei weiteren Sperren aufsagen, bevor ich schliesslich vor unserer Tür stand. Dort war mit Kreide ein weisses Kreuz draufgemalt, dazu noch das Wort „Hund“ mit Ausrufezeichen. Etwas sehr Ernstes schien im Gange zu sein, denn sonst kümmerten sich die Cops einen Scheiss um unser Haus, seit ihnen bei den Hoffesten mehrmals die Reifen durchgestochen wurden.
Ich packte den Hund und ein paar willkürlich für wichtig erachtete Unterlagen und ging in die Eckkneipe, die es damals noch gab. Vorher gab ich noch Madame bescheid, die auch arbeiten war und bei der es wie immer spät werden würde.
Wie sich herausstellte, war die komplette Hausgemeinschaft erst mal für einen Schnaps auf den Schreck bei Charly gelandet, selbst der Bauarbeiter. Der erzählte uns an diesem Abend, der noch sehr lang werden sollte, auch eine Menge interessanter alter Geschichten aus dem Haus – er war hier in den 80ern eingezogen, es war seine erste Wohnung.
Just zu dieser Zeit gab es gerade in dieser speziellen Ecke von Kreuzberg wohl ein paar komische Nazi-Gestalten. Und wie es der Zufall so wollte, legten die ihr Waffenlager auf unserem Dachboden an: Granaten, Schwarzpulver aus Weltkriegsmunition, Batteriesäure oder ähnliches, was dem polnischen Punk schliesslich auf die Arme tropfte.
Irgendwann durfte die U-Bahn dann wieder fahren, das Sprengstoffräumkommando machte seinen Job und kurz nach Mitternacht konnten wir endlich nach Hause. Die Wohnung der Polen wurde notdürftig instandgesetzt, die Hausverwaltung machte nie mehr als sie musste, aber sie nervte halt auch nicht: Das Glück einer seit Jahrzehnten zerstrittenen Erbengemeinschaft. Die beiden Polen suchten sich was im Friedrichshain und standen bei der alljährlichen Gemüseschlacht auf der Warschauer Brücke jetzt eben auf der anderen Seite. Die Friedrichshainer konnten die Verstärkung gut gebrauchen.
[2]
Midtro:
Für das Wahre, Schöne, Gute
Will jeder gerne bluten
Und fühlen
Was es zu fühlen gibt.
An dem Abend bei Charly in der Kneipe erfuhren wir auch, was es mit dem alten Mann auf sich hatte, der so gut wie jeden Morgen pünktlich um neun mit seinem Uralt-Kadett ankam und in dem kleinen Kabuff im Erdgeschoss verschwand. Der hatte dort nämlich mal einen Laden, der längst verriegelt und verrammelt war, und wohnte bis kurz nach dem Krieg auch in dem Haus. Er war locker über 80 und wurde mit der Zeit auch immer wackeliger auf den ohnehin schon durch Krücken verstärkten Beinen. Ab und zu kamen wir ins Gespräch und eines Tages brachte er diesen Riesenstapel Fotos und Postkarten mit – unser Kiez zwar, aber so kannten wir ihn nicht, dafür waren wir viel zu jung: Wasserwege, die längst zugeschüttet sind, Gasometer, die nicht mehr existieren und Kirchen, die zerbombt wurden. Irgendwann kam er dann allerdings nicht mehr so regelmässig, und dann gar nicht mehr.
Mit Kleingewerbe sah es in unserem Block auch sonst eher schlecht aus. Ein paar Häuser weiter gab es mal einen schlechten Pizza-Lieferservice, der schnell wieder zumachte. Einige Monate später eröffnete ein Videospielverleih in denselben Räumen, der sich erstaunlich lange hielt und von den ortsansässigen Jugendlichen begeistert frequentiert wurde, bis er einem Bäcker weichen musste. Dieser wiederum kam uns sehr entgegen: Wir konnten endlich mal ausprobieren, wie es aussehen würde, wenn der Hund wie im Klischee die Brötchentüte nach Hause trägt, es waren ja nur ein paar Meter. Dann wurde aber der Schwamm unter dem kompletten Häuserblock entdeckt, und eben auch im Gemäuer des Bäckerkellers, und das ging natürlich gar nicht. Dafür trat der Puff, der fünf Häuser weiter in der anderen Richtung lag und über den schon lange gemunkelt wurde, den offensiven Weg nach vorne an und hängte neben dem verstohlen blinkenden Herz im Fenster auch eine Leuchtreklame über die Tür. Die Geschäfte schienen gut zu laufen, nur der Kronleuchterladen hält sich genauso lange.
So zogen die Jahre auch in unserer immer weniger neuen Kreuzberger Heimat ins Land und neue und alte Hausbewohner ein und aus. Nach den Polen war es unser direkter Nachbar, der nach Connewitz zog, was eine zeitlang sehr angesagt war unter Berlinern: die Flucht aus der grossen, hässlichen Stadt nach Sachsen. Kurz darauf verschwanden dann wie schon erwähnt die Dealer aus dem Dritten. Dafür kam ein sehr angenehmer Münchener dazu, der später mit seinem kleinen Bruder dort eine WG aufmachte. Madame und ich holten die Hundegrosseltern aus der O-Strasse ins Haus, später zog noch ein weiteres befreundetes Pärchen in die Wohnung der Musiker-WG.
Wir studierten mehr oder weniger vor uns hin, machten mehr oder weniger gute Nebenjobs und genossen so gut es ging unsere besten Jahre. Der Hund war viel zu schnell erwachsen geworden. Irgendwann fanden wir sogar – nach ein paar handvoll Versuchen – für den mindestens jährlichen Dänemark-Hundeurlaub im stürmischen Februar den idealen Ort im Nirgendwo inmitten der Dünen. Natürlich hatten wir den Fiesta inzwischen standesgemäß durch einen schönen alten eckigen Volvo ersetzt, der Dicker hieß. Schon allein wegen dem Hund, ohne den bräuchte man in Berlin sowieso kein Auto (und keine Urlaube in Dänemark). „Oh, die Dame hat extra Lippenstift für mich aufgelegt!“ spottete der Tierarzt süffisant, als wir ihn im ersten Kohleofenwinter besuchten, weil der Hund unbedingt die heisse, gusseiserne Ofentür beschnuppern musste.
Die Kreise, in denen wir uns bewegten, wurden immer kleiner, der Kiez und auch Berlin sind irgendwann durcherkundet, was eher daran liegt, dass man genügend angenehme Orte gefunden hat, als dass es nichts Neues mehr geben würde.
Jedenfalls lagen die Koordinaten unseres gedanklichen Stadtplans inzwischen zum größten Teil in Kreuzberg, aber auch die althergebrachten in Mitte und Prenzlauer Berg wurden noch regelmässig besucht. Ansonsten kamen auf dem Berlin-Plan in unserem Kopf nur noch sporadisch neue dazu: Der Kickermeister aus dem Bandito machte eine neue Kneipe drei Strassenecken weiter auf. Zwei andere Leute zogen noch drei Ecken weiter ihr „Wie verprass ich mein Erbe“-Experiment noch eine Nummer grösser auf. Der Eimer hatte dafür längst zu. Dann noch der Grunewald –so oft wie es ging für den Hund und wegen des jährlichen Kistenrennens der Potsepunks. Durch Madames Job natürlich alles, was irgendwie mit dem wunderbaren alten Kino in der Nähe vom Zoo zu tun hatte, und das war eine Menge: Premierenfeiern hier und da, obskure Festivals und Privatvorführungen diverser cineastischer Raritäten, nicht zu vergessen der hundertste Geburtstag des Chefs, der noch jeden Tag ins Büro kam, und zum Leidwesen seiner Angestellten auch regelmässig ans Telefon ging.
Stattdessen fuhren wir in der Weltgeschichte umher, sobald sich die Möglichkeit dazu bot: Kuba wie gesagt war die erste gemeinsame Reise, Dänemark jedes Jahr nach der Berlinale, mindestens. Der Band, in der Madame Schlagzeug spielte, ging die Gitarristin in Richtung Südafrika abhanden, was uns ein paar schöne Zeiten in diesem tollen Land bescherte. Der ehemalige Mitbewohner aus der O-Strasse hatte sich und seinen berechtigten Ärger gefangen und arbeitete inzwischen in Amsterdam, was uns als Stadt ebenso begeisterte wie Tel Aviv. Kurz gesagt: Es war eine tolle Zeit, aber es war klar, dass es nicht ewig so weitergehen konnte.
Doch bevor es sich richtig änderte, wurde es erst noch mal richtig besser: Madame steckte mitten im Examensstress, als ich mich entschied, vielleicht doch zurück an die Uni zu gehen und die letzten Scheine zu machen, die Umstände boten diesen Schritt geradezu an. Das Problem war allerdings, dass wir recht schnell bemerkten, dass ein gemeinsam genutztes Arbeitszimmer keinem von uns gut tat, und uns zusammen erst recht nicht. Es sah so aus, als ob wir uns nach etwas Neuem umsehen würden müssen. Obwohl wir doch eigentlich – trotz all der Jahre und all der Veränderungen – dieses Haus und diese Wohnung immer noch sehr mochten.
Sicher, viele Leute waren ein- und ausgezogen in der Zeit, und zugegeben: es hat sich nicht unbedingt nur zum Besseren gewandt. Irgendwann hörten die Hofpartys auf, irgendwann zogen neue Nachbarn ein, die selbst wir „die Jugendlichen“ nannten. Von den ursprünglichen Bewohnern – denen, die da waren als wir hier einzogen – waren nicht mehr viele übrig, und vor allem wenige, die zu richtigen Freunden geworden sind.
Darüber hinaus, wenn man ehrlich ist: Nach zehn Berliner Wintern, einige davon mit sibirischen Ausmaßen, reicht es auch mal mit der Kohlenheizung. Wobei es gar nicht die Öfen oder das Heizen oder das Kohlen-aus-dem-Keller-schleppen war – das Nervigste war die Asche, die überall rumfliegt. Die Kombination aus der flauschigen und unglaublich dichten Husky-Unterwolle des rekordverdächtig haarenden Hundes und der feinen Asche killte ungefähr einen Staubsauger pro Jahr. Und ausserdem wurde in der letzten Zeit ständig die Strasse aufgerissen und mindestens zur Hälfte gesperrt, oder ein geplatztes Wasserrohr aus dem vorletzten Jahrhundert erledigte diesen Job, oder die BVG erneuerte die Hochbahnschienen. Irgendwas war immer.
Erstaunlicherweise gab es – wir sind irgendwo in der ersten Hälfte der sogenannten 00er Jahre – selbst zu dieser Zeit Wohnungen, die unseren Vorstellungen von Grösse, Lage und Bezahlbarkeit entsprachen, sogar in der Nähe, denn den Kiez wollten wir eigentllich nicht verlassen. Allerdings schafften wir es nicht, auch nur einen einzigen Besichtigungstermin zu absolvieren, vielleicht hätten wir ansonsten damals schon die Vorläufer der inzwischen berühmt-berüchtigten Wohnungscastings hautnah erleben können.
Der Grund dafür war recht simpel: Wir blieben doch im Haus. Überraschenderweise zog die WG aus dem Musikerumfeld, die sich nebenan eingerichtet hatte, nachdem der Nachbar gen Sachsen aufbrach, in die ehemalige Drogenhölle. Der Münchner war dabei, der Frankfurter, der manchmal nachts auf dem Balkon Kontrabass spielte auch, insgesamt also alles nette Leute. So nett, dass sie uns fragten, ob wir nicht die Wohnung haben wollten – sie hatten von unseren Plänen gehört und sie nicht gerade goutiert. Nun hatte ihre Wohnung aber auch nur 3 Zimmer und eine etwas größere Abstellkammer, ausserdem war der Grundriss eigentlich ziemlich ungünstig. Es war schlauchig, das Bad war auch nicht so dolle, bis auf die Wanne, die hätten wir schon ganz gerne wieder mal genossen. Von der Küche ganz zu schweigen, die war im Grunde nicht vorhanden. Okay – zwei Arbeitszimmer wären drin gewesen, aber dafür auf unsere inzwischen optimal eingelebte und viel besser geschnittenere Wohnung verzichten?
Andererseits: Mit dem Budget, das wir für eine neue Wohnung eingeplant hatten, konnten wir uns auch beide Wohnungen zusammen leisten, wir würden damit sogar entscheidend unter der vorher festgelegten Schmerzgrenze liegen. Nachdem uns diese Idee kam, mussten wir nicht mal eine Nacht drüber schlafen – konnten wir vor lauter Begeisterung auch gar nicht – um eine Entscheidung zu treffen. Kurzerhand stellte mich die WG bei der Hausverwaltung als Nachmieter vor und wir begannen, im Kopf schon mal die neuen Räume aufzuteilen: Zwei Bäder können nie schaden, wir waren längst in der Beziehungsphase, in der man das sofort einsieht. Aus dem grossen langen Balkonzimmer würde die Bibliothek werden, mit den Flügeltüren zu meinem neuen Arbeitszimmer. Dahinter dann das zweite Wohnzimmer mit Kicker, und ganz hinten das Gästezimmer. Und als Krönung zwei Balkone! So standen meine Graspflanzen Madames Tomaten nicht mehr im Weg. Am nächsten Morgen klopften wir die Wand ab, um eine geeignete Stelle für den Durchbruch zu finden.
Allerdings leisteten wir uns diesen Luxus keine drei Jahre. Immerhin gab es so noch zwei legendäre Partys, eine zum Einzug und eine, als wir die zweite Wohnung wieder aufgaben und den Durchbruch wieder zumachten. Madame war mit dem Studium fertig und fing an, sich einen Referendariatsplatz zu suchen, was aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in Berlin passieren würde. Und ich war mal wieder in einer veritablen Krise: Wie befürchtet ging es für sie ins tiefste Westdeutschland, während der Hund und ich zusahen, wie wir alleine in Kreuzberg und vor allem auch mit der Pendelei klarkamen. Es war keine Frage, dass der Hund erst einmal bei mir blieb, schon allein, weil ich viel mehr Zeit hatte, und die Ein-Zimmer-Einliegerwohnung irgendwo auf dem Acker kurz vor Holland wäre für die Hundedame auf Dauer auch nicht so toll gewesen. Obwohl die frisch mit Mist gedüngten Felder ihr ausserordentlich gut gefielen.
So richteten der Hund und ich uns neu in Berlin ein, aber trotzdem wurde ich den Eindruck nicht los, dass etwas fehlte, dass etwas weg war, dass das Leben in der halben, ganzen Wohnung ab und zu mal einen Phantomschmerz-Stich verteilte, wie es nach einer Amputation nun mal oft so ist. Und das lag nicht nur daran, dass uns ein paar Zimmer abhanden gekommen waren. Wir schlugen die Zeit in Kneipen und den wenig übrig gebliebenen Hausprojekten tot, gingen stundenlang am Kanal und fast täglich im Grunewald spazieren, aber eigentlich warteten wir nur darauf, dass Madame uns besuchen kam. Da dies immer seltener passierte, liess ich den Hund immer häufiger übers Wochenende bei ihren Großeltern, die inzwischen längst in den Wedding gezogen waren, und fuhr mit der Bahn gen Westen. Berlin war selten so uninteressant für mich wie in dieser Zeit, obwohl ich tun und lassen konnte, was ich wollte. Überhaupt etwas zu tun war aber in dieser Zeit das Schwierigste für mich, zum Glück war der Hund da, der seinen geregelten Tagesablauf einforderte, und ihren braunen Kindchenschema-Augen konnte ich selbst im dunkelsten Tal keinen Wunsch abschlagen. Als ich dann anlässlich irgendeines Jubiläums an die Uni geladen wurde, um von der guten alten Zeit zu erzählen, merkte ich, dass eine Veränderung jetzt vielleicht nicht das schlechteste wäre. Obwohl es mich natürlich freute, die ganzen anderen Veteranen mal wieder zu sehen.
Es wäre uns trotzdem nie in den Sinn gekommen, damals, die Berliner Wohnung aufzugeben. Aber sie hiess eben inzwischen auch nur noch „die Berliner Wohnung“. Nachdem Madame die Qualen des Referendariats hinter sich gelassen hatte und sogar übernommen wurde, machten wir uns wieder mal auf Wohnungssuche – oder besser gesagt: Mal wieder sie alleine, obwohl wir wenig später gemeinsam einziehen würden. Da Madame in Berlin Jahre auf eine Stelle hätte warten müssen, die dann auch noch viel miesere Konditionen gehabt hätte – dit is Balin! – war klar, dass unsere Zukunft woanders stattfinden würde. Ich war zu dieser Zeit sowieso mal wieder viel flexibler als mir lieb war, und so suchten wir uns eine passende Grossstadt – das musste schon sein, das brauchten wir beide – in der Gegend aus, die Auswahl war hier zum Glück recht gross. Ausserdem konnten wir so aus Jux Briefköpfe mit zwei wichtig klingenden Adressen anlegen, genau wie diese ganzen wichtigtuerischen Jungliteraten der Jahrtausendwende, die wir halb verachteten und halb bewunderten.
In der Gitsch räumten wir zwei Zimmer komplett leer und packten alles, was übrig blieb, in das dritte, das eheamlige Schlafzimmer mit dem Podest, was nach hinten raus ging. Dazu holten wir noch ein paar Bohlen und Bretter von Holz-Possling und bauten ein Hochbett – ausreichend für ein paar (hoffentlich regelmässige) Stippvisiten in der alten Heimat, dachten wir. Ausserdem hatte ich noch einige Termine im nächsten Jahr in der Stadt zu absolvieren – aber unser neues, gemeinsames Zuhause war jetzt definitiv woanders. Es stimmte schon, tief im Westen, wo die Sonne schon lange nicht mehr verstaubt (und ausserdem um einiges später versinkt und es im Winter sehr viel milder ist), ist es viel besser, als man glaubt. Madame hatte grosse Freude daran, das Nest zu bauen: Es war alles perfekt aufeinander abgestimmt und kam ganz ohne Ikea aus. Selbst der Hund gewöhnte sich, trotz ihres Alters, erstaunlich gut an die vielen Treppen – dafür wartete oben ein schöner flauschiger Teppich, so was gab es in der Kreuzberger Studentenbude natürlich nicht.
Bei der machte sich wiederum der gute Schnitt bezahlt: Wir hatten zwei separate Zimmer, die wir untervermieten konnten, noch dazu mit guten Kachelöfen (in den meisten anderen Wohnungen im Haus waren die inzwischen mit preisgünstigen, blöden Allesbrennern ersetzt) und einer komplett eingerichteten Küche samt Geschirrspüler und Waschmaschine, natürlich ganz zu schweigen von dem trotz allem immer noch angenehmen Haus. Weil Madame in der Ferne den Neustart organisierte, übernahm ich die Hin- und Herfahrerei und das Casting. Dummerweise hatten wir die Entscheidung recht spontan getroffen und keiner unserer Berliner Bekannten hatte jemanden zur Hand, der gerade eine Wohnung suchte. Jedenfalls nicht so eine, wir waren schliesslich alle älter geworden und die Leute arbeiteten inzwischen zum Teil im Bundestag oder ähnliches. Da will man nicht mehr mit dem Ofen heizen, den hat man höchstens noch als nostalgische Reminiszenz in der Ecke stehen. Das ging uns nicht anders. Aber wir hatten ja keine Ahnung, auf was wir uns da eingelassen hatte.
Sicher, auch wir hatten inzwischen im Freundes- und Bekanntenkreis hier und da mal eine Geschichte mitbekommen, die von absurden Wohnungsbesichtigungen handelte. Wo der Geruch der zuvor Verstorbenen buchstäblich noch in der Luft lag, während sich dutzende Leute durch die Bude drängelten: So lange die Lage stimmte, konnte man sich so was scheinbar erlauben. Aber das waren doch irgendwie so Lagerfeuer-Schauergeschichten aus Mitte. Dachten wir. Uns war klar, dass die Zeiten längst vorbei waren, in denen eine riesige Studenten-WG mit einer unvorstellbar hohen Summe aus ihrer sehr schönen Wohnung in der Torstraße rausgekauft wurde. Die Zeiten, in denen wir Studenten-WGs in der Torstraße kannten, allerdings ebenso.
Trotzdem: Madame hatte schliesslich gerade erst eine mehr als passable Wohnung auf einem der teuersten Pflaster Westdeutschlands gefunden. Teuer, das muss man zugeben, in Berlin bekommst du dafür doppelt so viele Quadratmeter. Dachten wir.
Am Mittwoch gab ich die Annonce auf, ich sass mit dem Laptop auf dem Balkon, in der Ferne blinkte der Rheinturm in der Abendsonne und ich überlegte noch, ob es wirklich reicht, nur auf einem einzigen Portal zu inserieren, und vor allem, ob der Besichtigungstermin am Wochenende nicht zu knapp gewählt war. Die nächsten Tage verbrachte ich dann damit, stündlich mein Postfach zu leeren und unzählige Mails zu beantworten, die meisten davon auf Englisch, aber nicht wenige waren auch gleich auf Spanisch geschrieben. Am Samstag durfte ich an die 50 hellauf begeisterte Interessenten durch die Wohnung lotsen und jedes Mal den gleichen Text aufsagen, obwohl ich die Anzeige schon nach einem Tag wieder aus dem Netz genommen hatte.
Die Auswahl war also recht gross, und am Ende ist es dann doch die sprichwörtliche Schwäbin geworden, man mag es kaum glauben. Ihr Argument war – neben ihrer sympathischen Art an sich – allerdings auch schlagend, bei uns jedenfalls: Sie suchte schon seit Monaten, allein der Hund, dieser wirklich freche (sprich nicht erzogene) Australian Shepherd, den sie im Schlepptau hatte, machte es ihr recht schwer. Da wollten wir nicht im Weg stehen, Madame hatte ja auch einige Schwierigkeiten gehabt, unsere alte Hundedame in der neuen Heimat mit ins Boot zu holen. Die Sache wurde mit einem formellen Untermietvertrag offiziell gemacht, alle waren überglücklich und am Montag war ich wieder zurück am Rhein.
Das nächste halbe Jahr verbrachten wir damit, uns einzuleben und die neue Stadt – ach was sag ich – die neue Welt kennen zu lernen. Ein Ballungsraum ballte sich an den nächsten, von Ort zu Ort veränderte sich der Menschenschlag und die Grenzen der Nationalstaaten, die hier teilweise mitten durch die Dörfer verliefen, nahm man wirklich nur beiläufig wahr. Wir begannen, uns wohl zu fühlen und einzufügen. Gut – Karneval ging für uns Norddeutsche gar nicht, und das war ein grosses Hindernis bei der Assimilation. Aber ansonsten klappte es meistens ganz gut.
Doch ab und zu gab es einen empfindlichen Stich, vor allem, da ich in den ersten Monaten noch wirklich oft nach Berlin fuhr, zumal mittlerweile die komplette Familie hier wohnte, über die ganze Stadt verstreut. Was für eine Ironie: Endlich waren wieder mal alle zusammen, da ziehe ich so weit weg, wie es in diesem Land nur geht.
Richtig schmerzlich bewusst wurde uns die Entfremdung von der alten Heimat, als wir einmal mit Auto und Hund herkamen für ein paar freie Tage – Pfingsten – und uns zuerst noch wunderten, dass wir keinen Parkplatz fanden und die Zufahrtsstrassen gerade abgesperrt wurden. Ist ja wie zum Karneval der Kulturen, dachten wir. Und genau so war es dann auch, das hatten wir nur absolut nicht mehr auf dem Schirm, die Verknüpfung Pfingsten-Karneval der Kulturen existierte schon nicht mehr.
Nach nichteinmal sechs Monaten wurde unserer schwäbischen Untermieterin dann langsam bewusst, dass sie das Berliner Nachtleben, was sie in vollen Zügen auskostete, am Ende viel zu vieler Nächte meist im Trinkteufel, ihre Verantwortungen als Hundebesitzerin und ihren Hammeraltenpflegejob nicht unter einen Hut bekommen würde und leider wieder zurück ins beschaulich-ländliche Baden-Württemberg gehen müsste. Was wir komplett einsahen. Da war es uns – gerade nach den Erfahrungen des letzten Castings – auch egal, dass wir eigentlich eine Kündigungsfrist von drei Monaten und eine Mindestmietdauer von einem halben Jahr ausgemacht hatten. Also spielten wir das Spielchen einfach noch mal durch, die Schwäbin hatte auch drei Interessenten an der Hand und so wurden wieder dutzende Leute durch die Wohnung bugsiert. Madame deutete an – es war ja ihre Wohnung, immer noch – dass sie im Hinblick auf die Auswahl der neuen Untermieter hoffte, dass wir uns jetzt nicht alle halbe Jahre einen Kopf um die Kreuzberger Wohnung machen müssten. Denn um ehrlich zu sein, wenn wir wieder nach Berlin zurück gehen würden, was immer noch vage im Raum stand, dann bei aller Liebe wohl nicht zurück in diese Wohnung. Sagte sie.
Von den beiden Münchenern wohnte keiner mehr wirklich im Haus, aber sie hatten es so gemacht wie wir und noch ein Zimmer in der Hinterhand behalten. Der Frankfurter wohnte inzwischen im Vierten zusammen mit einer Kanadierin und erzählte davon, dass er nach Uruguay auswandern wollte. Wir hatten eine neue Nachbarin, die wir nicht kannten und die tagelang scheinbar selbst ihre Wände verputzte, so hörte es sich an. Der Bauarbeiter wohnte immer noch über uns und lebte inzwischen ein befreites, offen schwules Leben samt Rockerkumpels. In der Wohnung der Hundegrosseltern wohnte die nächste Musiker-WG, allerdings aus einer Generation, für die Nirvana das ist, was für uns Janis Joplin und Bob Marley waren: Hätte man gerne noch selbst erlebt. Dafür kehrten die mittlerweile halbwegs berühmt-erfolgreichen Musiker aus dem Vierten ab und zu wieder zurück, oder wenigstens ein paar angenehme, altbekannte Gesichter aus ihrem Umfeld. Die hatten die Wohnung also auch noch gehalten. Die Neuigkeiten aus dem Hinterhaus waren gemischt: Einiges blieb ganz beim Alten, der Juraprof mit dem alten Benz war leider gestorben und die Antifa war mit dem studieren fertig und schwanger. Das war der Stand der Dinge, als ich mich nach einem neuen Untermieter umsah.
Auch Berlin hatte sich verändert. Das lag nicht nur daran, dass ich jetzt quasi von aussen kam und mir der Dreck und die Hundescheisse wirklich auffielen. Denn auf der anderen Seite sah es so aus, dass die halbmeterdicken Plakatschichten in den Hauseingängen in der O-Strasse inzwischen noblen Granitschildern gewichen sind, auf denen „Plakate ankleben verboten“ eingemeisselt war. Bei uns in der Strasse hatte neben dem Puff eine recht populäre und stark frequentierte Ferienwohnung aufgemacht. Und das, was da auf der Admiralsbrücke und im Görli, in den ganzen kleinen Seitenstrassen jenseits des Kanals passierte, damit hatten wir nichts mehr zu tun. Vor Jahren kannten wir die Leute hier noch und feierten zusammen mit dem Musikschrauber-Haschplattenverkäufer-Nachbarn die Eröffnung seines T-Shirt-Ladens (seine neue Berufung!), den er sich mit einem buddhistischen Kumpel teilte, der dort Räucherstäbchen, Bambuskerzen und Batikklamotten vertickte. Ihre Ladeneröffnung hatten sie günstig auf das Graefestrassenfest gelegt, so fanden sie vom ersten Tag an eine treue Kundschaft. Der Laden ist dann später in den Prenzlauer Berg gezogen, irgendwo am Eingang vom Mauerpark lief er noch eine ganze Weile ganz gut.
Wir machten uns einen Spass daraus, die Gegend neu zu erkunden, so als ob wir auch Touristen wären, vom Kanal über die kanadische Pizzeria in der keiner Deutsch spricht bis hoch zum frisch eröffneten Tempelhofer Feld. Hätte ich noch ernsthaft studiert, wäre das eine lohnende Feldstudie wert gewesen. Dazu kamen im Stadtbild merklich mehr offensichtlich arme Menschen, übrigens selbst an den noblen Ufern des Rheins in unserer neuen Heimat. Flaschensammler. In Berlin konzentrierte sich das alles wie unter einem Brennglas. Auch wenn andererseits einige althergebrachte Ecken nicht mehr existierten: Die Abkürzung entlang der S-Bahn-Bögen, die Madame vom Zoo zu ihrem Kino immer nahm und die von den ansässigen Junkies zur Verrichtung aller möglichen Geschäfte genutzt wurde, die gab es längst nicht mehr. Dafür hatten wir jetzt ein Flüchtlingscamp vorm Brandenburger Tor und eins auf dem O-Platz.
Am Ende des zweiten Castings blieben zwei mögliche Kandidaten übrig, die es unserer Ansicht nach am ehesten verdient bzw. nötig hatten und auch gut in Haus und Wohnung passten. Auf der einen Seite zwei niedliche Nachwuchspunks, die wie alle anderen Bewerber die beiden Zimmer zu diesem Preis in dieser Lage natürlich sofort haben wollten. Als Sicherheit hatten sie sogar einen von Mutti abgeschlossenen Bausparvertrag oder etwas in der Art dabei. Das interessierte uns jedoch nicht so sehr, wir hatten das ja alles schon mal durch und der Hausverwaltung war sowieso immer noch alles egal, solange sie keinen Finger krümmen musste. Aber dafür hatten die beiden Punkerjungs zwei Trümpfe, von denen sie gar nichts wussten: Erstens erwähnten sie am Rande, dass sie sich im Tommihausumfeld rumtreiben würden. Und dort waren ja auch die Hundegroßeltern aktiv, die uns auf eine kurze Nachfrage sehr nahelegten, die beiden putzigen Kerle aufzunehmen. Und außerdem erinnerten sie uns an den anderen Jungpunk, der hier kurzzeitig im Haus wohnte.
Der hatte nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit den Kreis zu unseren Anfangstagen im Bandito geschlossen und daher muss das noch kurz erwähnt werden: Als die Bindungen im Haus schon nicht mehr so eng waren, zog er irgendwann bei dem Frankfurter in die WG. Und kurz danach sprach mich der alte Kickerkumpan auf ihn an, mit dem ich früher den Prenzlauer Berg unsicher machte und der – bevor er mit seiner Freundin über Neukölln weiter nach Tempelhof zog und ein Kind bekam – auch kurzzeitig in der Gitsch wohnte. Er meinte, dass das ja ein dolles Ding sei, was aus dem geworden ist. Zuerst hatte ich keine Ahnung, wovon er redete. Dann aber fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Der kleene Punk, der inzwischen gut und gerne in seinen Mittzwanzigern war, hat uns als vierzehn- oder fünfzehnjährige Jugendantifa-Thresenkraft regelmässig beim Kickern über den Tisch gezogen. Ganz selten sogar unter ihn durch kriechen lassen. Damals, vor über zehn Jahren. Das durfte und konnte sonst nur der Meister. In der WG übte er sich dann leider hauptsächlich in Selbstmitleid und dem Verfassen von Songtexten, meist gleichzeitig.
Daher hatten die beiden Punks also eigentlich gute Karten. Doch da war auch noch der zweite Kandidat, einer von den Empfehlungen der Schwäbin. Alle anderen waren raus, die bekamen auch woanders Wohnungen und konnten sich das vor allem leisten. Sie war ihm im Hinterhof über den Weg gelaufen, als er gerade mit einer Rikscha durch die Einfahrt fuhr und sie sind ins Gespräch gekommen, was schliesslich auch bei den freiwerdenden Zimmern landete. Er wohnte gerade notdürftig auf der Couch der Antifa, suchte aber eigentlich was anderes. Und er war Musiker, natürlich! Da würden ihm die zwei Zimmer gut passen, könnte er in einem ein Studio einrichten und überhaupt: Das wäre die Chance für ihn.
Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass ich auch ihn eigentlich schon kannte. Er erzählte mir von seiner Hip-Hop-Karriere, dass er mal illegal gewesen und überhaupt einiges schief gelaufen wäre, inklusive an die Wand gefahrener Ehe. Aber er hat sich endlich gefangen, macht mit den Kids aus der Nachbarschaft im Statthaus irgendwelche Workshops und schaut, dass er ansonsten das mit den Rikschas auf die Reihe bekommt. Nebenbei hatte er noch eine Ausbildung und einen Halal-Lammwürstchen-Fliegenden-Imbiss im Görli zu laufen, und nun ja, der lief wie geschmiert, den neuen Zeiten sei dank. Ihm würde halt nur eine richtige Bleibe fehlen, und diese Möglichkeit im gleichen Haus wäre ja fast schon ein Wink Gottes, Allahuakbar.
So sass ich dann also an diesem Abend wieder da und wusste nicht, wie ich mich entscheiden sollte. Madame hatte nach langen Beratungen per Skype die Segel gestrichen und alles in meine Hand gelegt. Die Schwäbin war zwar die ganze Zeit vor Ort dabei, aber auch heilfroh, dass die Sache überhaupt so glatt über die Bühne ging – letztendlich war sie auch bei den beiden Finalisten gelandet. Wenig überraschend kannte sie sogar die beiden Punks aus einigen Absturznächten in der Tommihauskneipe. Und dann stolperte ich beim Nachdenken und Rumsurfen doch noch mal über den Stagename, den mir der Rapper am Nachmittag bei der Besichtigung nannte.
Da ich mit dieser Musikrichtung nicht allzu viel am Hut habe – oder nur sehr speziell, sagen wir es mal so – hatte es mich schon gewundert, dass mir der Name doch irgendwie bekannt vorkam. Und richtig, es lag nicht an seiner Musik: Vor Jahren gab es mal eine Anti-Abschiebungs-Kampagne für ihn, die relativ breit aufgezogen wurde und mir im Gedächtnis geblieben ist, in einer schummerigen Ecke. Der war jetzt also auf dem Sofa der Antifa-WG gelandet.
Letztendlich beschlossen wir, er hätte die Chance verdient, und die beiden Nachwuchspunks würden mit ihrem Bausparvertrag bestimmt leicht etwas anderes finden. Am Sonntagabend sass ich mit einem weiteren unterschriebenen Untermietvertrag wieder im Zug Richtung Westen, während die Schwäbin mit dem Rapper klären sollte, wer welche Möbel behielt.
Die Pendelfrequenz ging vom Zweiwochenrhythmus in der Fernbeziehungszeit jetzt stark gegen Null. Keine ausgebuchten Wochenenden mehr, weil man alle und alles sehen will und muss. Nicht mehr suchen, ob ein Flug vielleicht billiger wäre als das Bahnticket, was unverschämt ist, und unverschämt oft der Fall war. Mit der 50er Bahncard, wohlgemerkt. Die jetzt nach jahrelangem Abo auch gekündigt werden konnte. Selbst Weihnachten und Silvester fanden nicht mehr in Berlin statt, sondern im neuen Zuhause und am Mittelmeerstrand. Da waren wir also: Angekommen?
Immerhin konnte ich inzwischen ganz gut abschätzen, wann das Hochwasser den recht idyllischen Strand und die unteren Wiesen überfluten würde und man zum Hundespaziergang besser die Gummistiefel mitnahm. Ganz wie im Grunewald, obwohl die hohe Kunst dort darin bestand, im Winter zu wissen, ab wann man die Spikes brauchte, weil der Weg um den See mal wieder glatter war als das Eis auf ihm. Solche Überlegungen konnten wir im milden Klima der neuen Heimat allerdings getrost vergessen; ich begann allmählich zu verstehen, warum für Adenauer hinter Braunschweig die sibirische Steppe begann.
Trotzdem fehlte mir Berlin immer wieder mal ein bisschen, auch wenn wir in der neuen Heimat inzwischen nicht nur eine Stammkneipe, sondern mehrere wirklich gute Punkschuppen ausgemacht hatten. Und uns selbst mit dem lokalen Fussballverein halbwegs arrangieren konnten, vor allem, weil der aktivistische Teil seiner Anhängerschaft uns an die alten Zusammenhänge erinnerte: Sie veranstalteten zum Beispiel ein sehr spassiges antirassistisches Freizeitfussballturnier mit Gästen aus dem ganzen Bundesgebiet. Es gab leckeres Essen und beste Stimmung, inklusive Mini-Ultra-Block für jedes Team und den obligatorischen Pyro-Zwischenfällen. Dank der dazu scheinenden Sonne und der reichlich vorhandenen Zeit war das einer der schönsten Tage seit langem. Irgendwann war es nach einer längeren Pause dann aber doch mal wieder an der Zeit, in der alten Wohnung und der alten Stadt nach dem Rechten zu sehen.
Ein wirklich trauriger Anlass gab dann den letzten Anstoss. Leute sterben, und es war beileibe nicht das erste Mal, dass es jemanden aus meinem direkten Umkreis traf. Trotzdem war es überraschend, und vor allem ein fatales Signal: Das Herz. Ich machte Madame Vorwürfe wegen ihres stressigen Jobs und mich auf den Weg zur Trauerfeier nach Berlin. Viele alte Bekannte fanden sich ein, man war sich einig, dass es nicht so weit hätte kommen dürfen, dass man sich erst zu solch einem Anlass wieder zusammen findet. Das alles und noch viel mehr wurde am Abend ausführlich in der alten Stammkneipe diskutiert, zum Bier gesellten sich mehr und mehr Mexikaner und vernebelte Erinnerungen an die alte Zeit.
Ich hatte dem neuen Untermieter nur kurz vorher per SMS mein Kommen angekündigt. Er antwortete ebenso kurz, dass er gerade leider gar nicht da wäre, dafür aber ein Kumpel von ihm. Dazu noch ein paar unverständliche Hip-Hop-Floskeln. Alter, Digga usw. Als ich nach Hause – also in die Kreuzberger Wohnung – kam, war der Flur ziemlich zugestellt, doch ich war ja auch ganz schön voll, und ausserdem genug damit beschäftigt, das Vorhängeschloss zu meinem Zimmer aufzupfriemeln und meinen betrunkenen Arsch unbeschädigt auf das Hochbett zu bekommen.
Am nächsten Morgen lernte ich dann mit etwas dickem Schädel den schüchternen Mitbewohner vom Rapper kennen. Denn das schien er zu sein, er machte nicht den Eindruck, als ob er nur kurz übers Wochenende hier wäre. Die beiden Zimmer waren auch dementsprechend aufgeteilt, soweit ich das erkennen konnte. In dem einen schien sich darüber hinaus aber wirklich noch ein Tonstudio zu befinden. Gut: Er meinte, dass er vielleicht ab und zu mal einen Freund aufnehmen wollen würde, er bewegte sich schliesslich immer noch in Sans-Papiers-Kreisen. Ich entgegnete damals, dass das prinzipiell kein Problem sei, er aber auch an seinen eigenen wackeligen Status denken sollte. Trotz alledem hätte ich es schon nett gefunden, wenn er uns über die neue Aufteilung der Wohnung vorher informiert hätte.
Egal – Küche und Bad sahen halbwegs in Ordnung aus, auch wenn eines der kleinen Fenster der Badtür kaputt war. Kann passieren, musste repariert werden. Das alles sprach ich dem Rapper auch gleich auf die Mailbox, ich hatte es schliesslich eilig und musste zum Bahnhof, Madame hatte Geburtstag. Irgendwo zwischen Porta Westfalica und Hamm rief er dann zurück und entschuldigte sich wortreich. Kein Thema, sagte ich; ich muss auf alle Fälle wieder öfter nach Berlin, dachte ich. Beim Nachgeburtstagsfrühstück am nächsten Morgen sprach ich das Thema vorsichtig an und Madame machte ein skeptisches Gesicht.
Ein paar Wochen später, wir hatten endlich mal wieder etwas mehr Zeit und den Kopf frei, machten wir uns an die Urlaubsplanung für das Jahr. Zwischendurch stattete ich dem neuen Mitbewohner noch einmal einen Besuch ab, diesmal war ich fair genug, einige Tage im Voraus Bescheid gesagt zu haben. Das sah man der Küche und dem Bad auch an.
Er hatte es sich in der Küche gemütlich gemacht und dort einen kleinen, wackeligen Schreibtisch aufgebaut. Auf dem war gerade mal Platz für den Laptop, einen Ascher und das Tabakpäckchen nebst ein paar losen langen Blättchen. Daneben breiteten sich über den gesamten kleinen Tisch unzählige Papierschnipsel, Visitenkarten und Bierdeckel mit Songtextfragmenten, oder Rhymes, wie er später mal sagte, aus.
So sass er mir gegenüber auf dem winzigen, ächzenden Stuhl – massig und gutmütig, fast kindlich – wie ein Maghreb-Buddha, und erzählte begeistert von seinen letzten Erlebnissen in der Hip-Hop-Welt, und wie es auch bei ihm vorangehe. Just in den kommenden Tagen wolle er ein paar Aufnahmen machen, ein Soli-Ding für die O-Platz-Leute. Aber eigentlich war er auch erst gestern aus der Stadt zurück gekommen, in der Madame und ich uns gerade versuchten heimisch zu fühlen. Zufälle gibt’s! Dort musste er eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Crews schlichten, richtig heftiger Scheiss mit ernstgemeinten Morddrohungen und so weiter. Das war das, was ich verstanden habe, dann zeigte er mir noch ein paar ziemlich grässliche Youtube-Videos auf dem Laptop, dazu schepperten die Aktivboxen, die sich unter dem Schreibtisch versteckt hatten.
Eine weitere Parallelwelt, von der man keine Ahnung hatte, böse Hip-Hop-Gangster, die sich wirklich für solche halten, und das selbst in der neuen Heimat. Aber gut – bevor die 36 Boys in Berlin zum Modelabel wurden, wie ich bei einem meiner vorherigen Besuche erstaunt registrierte, kam man in Kreuzberg um die ja auch nicht rum. Am Abend erzählte der Rapper dann bei ein paar Tüten noch einige interessante Geschichten von früher, bevor seine Brüder kamen und sie im Home Studio verschwanden.
Als ich nach ein paar Stunden die Tour durch das Haus beendet, alle Nachbarn abgeklappert und damit noch einiges mehr intus hatte, waren die Aufnahmen weiter in vollem Gange und die Künstler einige mehr geworden. Ich kletterte auf das Hochbett und erinnerte mich mit Grausen daran, wie früh ich am nächsten Morgen raus musste, nur weil ich den billigen Flug genommen habe. Doch wir wollten ja schliesslich noch den Sonntag zusammen verbringen. Das, was ich von der Musik nebenan unvermeidlicherweise beim Einschlafen mitbekam, war zwar ziemlich laut, aber streckenweise auch überraschend gut.
Urlaubsplanung also. Viel war nicht drin dieses Jahr, schon rein zeitlich. Schliesslich waren wir auch vor ein paar Wochen erst – zwischen den Jahren, für zehn Tage – weit weg gewesen, inklusive einer einsamen, angenehm lauen Silvesternacht am Mittelmeerstrand und einem Schlamm- und Salzbad im Toten Meer am Neujahrstag. Vielleicht ja in den Herbstferien wieder dorthin, meinte Madame, und ich war froh, dass es ihr immer noch so gut gefiel wie mir. Kein Dänemark dieses Jahr, das würde wohl wieder mal nichts werden. Aber wenigstens Ostsee im Sommer, sagte ich. Vielleicht sollten wir das dieses Mal etwas verkürzten, meinte sie, und dafür länger nach Berlin.
Madame hatte gekündigt. Die Kreuzberger Wohnung. Wir hatten oft und lange darüber diskutiert, und irgendwann habe ich wohl mal gesagt, dass sie es entscheiden soll, schliesslich war es ja ihre Wohnung. Ich konnte ihre Argumente rational komplett nachvollziehen: Es brachte schon immer mal wieder etwas Stress mit sich, Strom, Gas, Telefon, DSL, Reparaturen, Hausverwaltung, kontrollieren ob die Miete auch bezahlt wird (was der Rapper in den letzten beiden Monaten irgendwie vergessen hatte, er war halt so viel unterwegs…)
Andererseits merkte ich bei den Diskussionen, dass ich immer noch verdammt an der Stadt hing, dass es da etwas gab, was mir die Neue nie geben können würde, das war mir inzwischen klar geworden. Also klammerte ich mich an den Strohhalm der alten Studentenbude, beschrieb ihr die Situation, die – ohne dass ich dabei übertreiben musste – in Berlin ja wohl jede Wohnung von jetzt auf gleich vermietbar sein lässt. Und außerdem würde ich mich gerne weiter darum kümmern, wenn mal wieder jemand ein- oder ausziehen müsste. Doch Madame hatte ihre Entscheidung getroffen. Und irgendwie hatte sie ja Recht: War es nicht langsam an der Zeit, die Taue ganz zu kappen?
Das bedeute also, dass wir dem neuen Untermieter schonend beibringen mussten, dass er sich in einem halben Jahr etwas Neues suchen und die ausstehende Miete demnächst mal bezahlen müsste. Da er verständlicherweise sehr gerne in der Wohnung bleiben wollte, setzten wir zusammen mit der Kündigung ein entsprechendes Schreiben an die Hausverwaltung auf. Normalerweise, meinte der Rapper, hätte er mit seiner Geschichte bei solchen Sachen sowieso keine Chance. Andererseits – so versuchten wir ihm etwas Hoffnung zu geben – war unserer Hausverwaltung bisher eigentlich alles ziemlich egal.
Wir hofften auch auf eine Übernahme, da wir so im Sommer mehr Zeit an der Ostsee und weniger Zeit mit Renovieren, Aus- und Aufräumen verbringen müssten. Klar war jedenfalls schon mal, dass wir einige Flohmärkte zu absolvieren hätten, bei dem ganzen Kram, der trotz alledem noch von uns in der Wohnung stand. In der neuen Wohnung in der neuen Stadt waren sowohl Keller als auch Abstellkammer und Dachboden schon komplett vollgestellt, und bis auf die Bücher und ein paar Erbstücke wollten wir wirklich nichts mitnehmen. Eigentlich wäre es auch mal wieder an der Zeit für einen Hausflohmarkt, hatte es schon lange nicht mehr gegeben sowas. Und eine endgültige Abschiedsparty stand dann im Sommer wohl auch noch an.
Also fuhr ich in den folgenden Wochen häufiger nach Berlin, um die ganze Wohnungsauflösungsgeschichte vorzubereiten. Was mir ganz gelegen kam, da ich – nicht nur, aber auch wegen der ganzen Diskussion darüber – unbedingt Ablenkung brauchte. Und ich noch soviel von Berlin mitnehmen wollte, wie ich konnte.
Da nun aber dummerweise die Bahncard gekündigt und spontane Flüge nicht ganz so billig zu haben waren, liess ich mich seit langer Zeit mal wieder auf das Abenteuer Mitfahrgelegenheit ein. Das letzte Mal, ich konnte mich noch gut erinnern, hatte ich die noch bei der Mitfahrzentrale gebucht. In der Manteuffelstrasse, nicht im Internet.
Vollbeladen donnerten meine Schicksalsgenossen und ich in einer losen Kolonne aus drei schrottreifen Kleinbussen unter ständiger Ausnutzung aller Spuren, die die A2 hergab, gen Osten. Im 50-Kilometer-Rhythmus rauchte der Fahrer kunstvoll aus dem Fensterspalt. Doch die Geruchsbelästigung und der Lärm, den das Ganze bei 160Km/h machte, waren unsere geringste Sorge.
Die drängendere war die Todesangst, die einigen ins Gesicht geschrieben stand. Dummerweise war ich fast der letzte, der am Morgen den Transporter bestieg. Deswegen bekam ich den Kopilotenplatz vorne – und vieles mit, was ich besser nicht hätte sehen wollen. Nach mir kam nur noch eine propere alte türkische Mama, die von ihrer Tochter bis zum Einstieg begleitet wurde. Ich bot ihr den freien Platz neben mir an, und sass dann dank meiner Höflichkeit die nächsten viereinhalb Stunden auf dem Notsitz zwischen Gangschaltung, Lüftungsschacht und der Mama. Neben dem Rauchen und dem die komplette Fahrbahn Ausnutzen war der Fahrer auch noch damit beschäftigt, per Headset ständig auf Polnisch Rücksprache mit seinen anderen beiden Kollegen und der Frau von der Zentrale zu halten, die mir am Tag zuvor in akzentfreiem Deutsch Treffpunkt und Zeit mitgeteilt hatte. Diesmal verstand ich allerdings nicht sehr viel von den Gesprächen, aber als wir in der 130er Zone kurz vor Berlin geblitzt und sogleich alle anderen informiert wurden, lernte ich einige neue polnische Schimpfworte.
Der Rapper war natürlich nicht begeistert, doch ich versuchte ihn (und mich) zu überzeugen, dass das mit der Übernahme schon klappen würde. Er versprach, so schnell wie möglich die fehlende Kohle aufzutreiben, aber erst mal müsse er nach Hause: Schon seit zwanzig Jahren hatte er seine Leute dort nicht mehr gesehen, jetzt hatte er die Gelegenheit, günstig hin zu kommen, er hätte da jemanden bei einer Fluglinie kennengelernt.
Bevor ich mich auf den Weg nach Berlin machte, versuchte ich Madame noch mal umzustimmen. Wir hatten bisher keine Bestätigung von der Hausverwaltung bekommen, ich machte mir immer noch leise Hoffnungen. Doch es half alles nichts. Überhaupt: Die Stimmung im ganzen Haus war irgendwie seltsam und es gab wieder einige neue, unbekannte Gesichter. Wenigstens stellte sich die vor kurzem eingezogene Nachbarin bei genauerem Hinsehen als ganz passable Zeitgenossin heraus, mit ihrem kleinen Knall passte sie ganz gut hier rein.
Auch der Kiez, selbst unsere hässliche Ecke davon, wurde mir immer fremder. In der alten Fabrik um die Ecke wurde jetzt Kunst ausgestellt und der Club daneben gehörte inzwischen zu den angesagtesten der Stadt, mit dementsprechendem Publikum. In der Seitenstrasse hatte eine Anwaltskanzlei aufgemacht, vielleicht angelockt von dem Büromöbelladen, der sich dort schon so erstaunlich lange hielt. Kurz darauf bekamen die Anwälte ihre Kantine: Ein kleines Bistro öffnete im Nebenhaus, und das Eckhaus zur Hauptstrasse, wo Charly, der schon lange tot war, seine Kneipe hatte, schien recht aufwendig saniert zu werden.
Andererseits: Zeiten ändern sich nun mal; bei den ganzen Berlin-Diskussionen hatten Madame und ich gerade überrascht festgestellt, dass da mal eine uralte Reifenwerkstattbretterbude stand, wo seit gar nicht so vielen Jahren jetzt der Getränkesupermarkt ist. Die hatten wir fast vergessen, obwohl wir dort die ersten Winterreifen für den Dicken besorgten.
Aber der Tabakladenverkäufer, der seinem Imperium gerade im Nebenraum einen Backshop hinzugefügt hatte, erkannte mich trotzdem noch nach jeder längeren Abwesenheit wieder. Ein paar Sachen blieben also doch, die Hochbahn-Baustelle schien da inzwischen auch dazuzugehören. Und an dem Haus neben der Parkimitation hing immer noch das „Farbfernseher ab 98,-DM“-Schild.
Am Montagmorgen machte ich mich auf den Heimweg, nicht ohne vorher noch ein paar ernsthafte Gespräche zwischen Tür und Angel über den Auszugstermin mit dem Rapper geführt zu haben, beziehungsweise was er noch alles tun und für Unterlagen besorgen müsste, um in der Wohnung zu bleiben. Das Mitfahrgelegenheitsexperiment wurde abgerundet und komplettiert, nachdem ich eine geschlagene Stunde an der hässlichen Gesundbrunnenbaustelle in der Kälte wartete – vergeblich, wie sich herausstellte. So fuhr ich um ein sehr teures Bahnticket ärmer Richtung Westen, das erste mal fast froh, das alles und diese Stadt hinter mir zu lassen.
Abends erzählte mir Madame, dass Post gekommen wäre. Die Hausverwaltung sei nicht mehr zuständig, das Haus verkauft. Schlechte Nachrichten für den Rapper, denn sie blieb bei ihrer Meinung.
Madame hatte also gekündigt. Und wo sie schon mal dabei war, nahm sie sich einige Wochen später als nächstes unsere Beziehung vor. Ich bot ihr an, um Zeit, Raum, Abstand und einen klaren Kopf zu gewinnen, erstmal nach Berlin zu fahren, dort war ja sowieso noch einiges zu erledigen. Jetzt wohl erst recht.
Wir hatten eine Woche Bedenkzeit ausgemacht. Eine Woche, nach fünfzehn Jahren. War es wirklich soweit? Kein „Ist es eigentlich kalt draussen?“ mehr nach dem Aufstehen? Waren wir eines der Paare geworden, die sich eine Zeit lang in den deutschen Berlinale-Forum-Beiträgen tummelten, die wir uns trotz allem immer wieder gerne zusammen anschauten? Die aus der Grossstadt meistens an irgendeinen verdammten See fuhren, merkten, dass sie sich nichts mehr zu sagen hatten, sich also nicht mal aussprechen konnten und einander deshalb den ganzen Film über nur anschwiegen? Wo wir doch mal so gut zusammen schweigen konnten?
Als sie nach einer Stunde von ihrer Freundin aus anrief und meinte, vielleicht wäre mein Vorschlag mit dem Rückzug nach Berlin keine so schlechte Idee, gab ich dem Hund, den ich nur ungern zurückließ, einen Knochen, suchte ein paar Sachen zusammen und einen Zug aus dem Fahrplan. Sie hatte mal um mich gekämpft, jetzt gab sie uns auf.
Komplett neben der Spur fiel ich in den ICE-Sessel und blickte stumpf in die Nacht, die sich über den ostwestfälischen Äckern breit machte. Ich war wie betäubt, so dass es mir herzlich egal war, was der werte Herr Zugbegleiter dauernd erzählte, ich schaltete ab. Meine Mitreisenden allerdings wurden von Durchsage zu Durchsage ungehaltener, so dass ich irgendwann die Ohrstöpsel rausnahm, mich räusperte und fragte, was denn los sei. Normalerweise waren die Spätzüge – dieser sollte um Mitternacht in Berlin ankommen – durch meist angenehm ruhige und zurückhaltende Passagiere gekennzeichnet. Jetzt aber wurde mir aufgeregt erzählt, dass wir nicht nur diese blöde Umleitung wegen der Flut nehmen mussten, sondern auch noch an irgendeiner Weiche stehen und warten. Mich liess das ziemlich kalt, ich schaute nach, in welchen Abständen die Nachtbusse fuhren und schrieb dem Mitbewohner eine Nachricht. Und Madame ungefähr dreissig, wovon ich drei abschickte.
Irgendwo auf der Ausweichstrecke hinter Wolfsburg meinte der Sturm dann, einen Baum auf die Oberleitung schmeissen zu müssen. Der ICE fuhr also im Schritttempo über Nebengleise, vermutlich durch Sachsen und Polen, um schliesslich nach acht Stunden kurz vor vier in Berlin anzukommen. Die Revolution im Zug war vor zwei Stunden in allgemeine Ermattung umgeschlagen und der menschenleere, abweisend triste Berliner Hauptbahnhof passte wunderbar zu meiner Stimmung. Bis mir einfiel, dass das früher hier der Lehrter war, an dem ich immer mit dem Rad vorbei fuhr, wenn ich zu ihr nach Moabit wollte: Nur noch am Knast vorbei, dann würde bald der kleine Tiergarten kommen und die Thusnelda-Allee…und dann wäre ich gleich da. Gewesen.
Um kurz vor Fünf schloss ich die Wohnungstür auf, als im selben Moment jemand von drinnen raus wollte. Ich hatte ihn noch nie gesehen, und er schien aufgrund seiner Aufmachung einen wichtigen Termin zu haben, weisses Hemd, geputzte Schuhe, schnieker Anzug. Wir musterten uns einen Moment lang gegenseitig, aus dem Nebenzimmer war ein Schnarchen zu hören. Ich fragte nach dem Rapper, auf die Tür deutend. Non, meinte er, dans la cuisine.
Der Buddha sah etwas durch den Wind aus, wie er da nur mit Shorts und Bong bekleidet vor dem Laptop saß. Seinen dicken Kopfhörern sei dank hatte er mich nicht kommen gehört. Aber an diesem Abend – bzw. Morgen – war ich der ungeschlagene Meister im Scheisseaussehen. Auf meine mürrische Frage, wer das denn eben gewesen sei, erzählte er, nachdem er sich etwas gesammelt hatte, irgendwas von seinem Cousin, der jetzt, wo er doch in ein paar Stunden losfliege, ab und zu mal vorbeischauen würde. Diesen verdammten Heimatbesuch hatte ich ganz vergessen. Ich erklärte ihm kurz die Situation, von der ich selbst ja eigentlich gar nichts wusste, und kletterte todmüde auf das Bett. Grandioses Timing, alles in allem.
Die nächste Woche war die Hölle: Langeweile besäuft sich, meilenweit.* Ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Und das lag nicht daran, dass der Rapper wie es schien zwei neue Untermieter aufgenommen hatte, während er bei seiner Familie weilte. Denn als ich nach einigen unklaren Tagen dem Cousin wieder über den Weg lief, hatte der eine Begleitung und Einkäufe dabei . Von Verwandschaft konnte auch keine Rede sein: Der Rapper hatte die beiden zwischen O-Platz und Görli aufgesammelt, so weit so gut. Allerdings hatte er ihnen den Schlafplatz für zwei Monate versprochen und darüber hinaus auch dementsprechend abkassiert. Pro Nase ungefähr den Betrag, den wir von ihm bekamen. Oder bekommen sollten, eigentlich.
Natürlich waren die beiden Jungs alles andere als begeistert. Doch nach einer langen, teils ziemlich agressiv (vermutlich wegen neumodischer Drogen) und verzweifelt geführten nächtlichen Diskussion war ihnen klar, dass wir in vier Wochen hier raus mussten. Alle. Was mir auch langsam bewusst wurde, wenn ich mal nicht auf eine wie auch immer geartete Nachricht von Madame wartete oder mir die Birne wegknallte, oder beides. Meist beides. Zum Glück waren noch ein, zwei Nachbarn übrig, die mir die Katastrophe an der Nasenspitze ansahen und mich erstmal auffingen. Bis dann pünktlich nach einer Woche der Anruf kam, der das aussprach, was sowieso klar war.
Outro:
Dry your eyes mate
I know it’s hard to take but her mind has been made up
There’s plenty more fish in the sea.
Dry your eyes mate
I know you want to make her see how much this pain hurts
But you’ve got to walk away now
It’s over.
http://www.youtube.com/watch?v=TpyQi3SEuuY
[Und ich hatte nicht einmal den Hund…]
Ich wurde dankenswerterweise unter diverse Fittiche genommen, verbrachte die Tage mit Sachen räumen und packen, trug unzählige Müllsäcke aus der Wohnung und einige Biere zum Kanal. Zum Glück war Sommer in Berlin, sagte ich mir immer wieder, und nicht November. Viel geholfen hat es nicht. Im Gegensatz zu den Nachbarn, die anboten, mich gerne auch für länger aufzunehmen.
Zwei gleich, ohne langes Gerede. Der Frankfurter zog tatsächlich nach Südamerika, wenigstens für ein halbes Jahr. Er freute sich regelrecht, dass ich in dem Monat, in dem er seine Abschiedstournee bei Freunden und Familie gab, auf die Pflanzen aufpassen konnte. Und er hatte sowieso schon das kleine Zimmer hinten leer geräumt, was er für das halbe Jahr vermieten wollte. Mein Leben und alles, was ich mitnahm, passte also tatsächlich in einen so kleinen Raum, gestapelt bis unter die Altbau-Decke.
Im Haus flogen die Gerüchte geschwaderweise umher. Fest stand, dass ein exotisches Gastronomie-Imperium das Haus gekauft hatte. Angeblich im Paket mit ein paar anderen, sie hatten es sich wohl noch nicht einmal angeschaut. Bei der Erbengemeinschaft waren in den letzten Jahren immer mal wieder Leute weggestorben, bis sich schliesslich diejenigen durchsetzen konnten, die verkaufen wollten.
Dann hieß es, dass der alte Mann von dem verrammelten Laden ganz unten dagewesen wäre. Er war gar nicht tot, wie alle dachten, sondern nur fast. Er lag für ein paar Jahre oder so im Koma und tauchte plötzlich wieder auf, der zähe Kerl! Über die Miethaie konnte er nur lachen: Er hatte sich schliesslich weder vom letzten Krieg, noch von Blockade oder Teilung und schon gar nicht von den Bonnern aus diesem Kiez vertreiben lassen, wie er stolz sagte. Immerhin hatte er schon in den 20ern mit dem späteren Verursacher der Erbengemeinschaft im Sandkasten gebuddelt und von ihm dann ein lebenslanges Nutzungsrecht für die inzwischen wieder sehr attraktiven Gewerbe- und Lagerräume im Erdgeschoss zugesichert bekommen.
Als Madame dann schliesslich mit dem Hund kam, war ich überrascht, wie sehr ich mich doch noch über die beiden freuen konnte. Also: überhaupt. Insgesamt verbrachten wir noch mal eine erstaunlich gute Zeit, auch wenn es darum ging, die Wohnung aufzulösen, die in den letzten 14 Jahren einen Großteil unseres gemeinsamen Lebens bestimmt hatte, das jetzt ja sowieso in Trümmern lag.
Aber das Haus verlassen wollte ich auf gar keinen Fall. Es wäre auch keine gute Idee gewesen, mir in meinem Zustand diesen Wohnungssuchwahnsinn anzutun. Zum Glück – und das war trotz allem in den letzten Wochen nicht das erste – entschied sich die Untermieterin des kleinen Bayern, eine Praktikums- oder Aussteigerstelle bei einer Kommune irgendwo in Niedersachsen anzutreten.
So kam es, dass ich jetzt seit einem guten halben Jahr in der ehemaligen Drogenhölle wohne. Die Spuren sämtlicher Vormieter und ehemaliger Mitbewohner sind hier noch deutlich zu erkennen, was mich gleich heimisch fühlen liess: lateinische Zitate, mit Bleistift an die Wände gemalt, wahrscheinlich von den Dealern („Nulla hora sine linea“); linksradikalaktivistische Spuckis mehrerer Jugendantifa-Generationen; Bayernpropaganda-Postkarten („Gute Menschen kommen aus Bayern“). Ich fügte ein bisschen was hinzu, und habe das auch weiterhin vor. Unsere alte Telefonummer, die mit roter Farbe neben den Flurspiegel gepinselt wurde („First Floor: 615….“) habe ich bewusst noch nicht übergemalert.
Es ist nicht gut, aber es ist besser geworden. Könnte ich erzählen und es fast selber glauben. In unserer alten Wohnung, an der ich relativ schnell ohne Bauchschmerzen vorbeigehen konnte, wohnen längst die Tellerwäscher aus den Restaurants. Mal so ins Blaue geraten. Oder die Verwandtschaft ist einfach nur nachgezogen, oder beides. Mit Teppichboden und Gasetagenheizung.
Selbst der Hund, im Herbst auf Scheidungskindbesuch in der neuen WG, blieb nur zwei, drei mal länger schnuppernd vor der alten roten Türe stehen, um sich dann die weiteren zwei Treppen hochzumühen. Inzwischen kann ich auch zur morgendlichen Lektüre wieder Deutschlandfunk hören, obwohl dort in den Verkehrsmeldungen immer die vertrauten Autobahnnummern zwischen Wuppertal und Aachen vorkommen, die jetzt für mich in einer Welt liegen, zu der ich keine Beziehung mehr habe. Wortwörtlich.
Ansonsten: Ich habe ich mich monatelang abgeschossen und verkrochen. Ab und zu überreden lassen, rauszukommen. Inzwischen vielleicht wieder ein ganz klein wenig Glück & von mir selbst gefunden. Und ja, ich bin froh, wieder hier zu sein: zurück in Berlin.
[Stimmt: Das ist keine lustige Geschichte. Deshalb tut mir der kitschige Soundtrack auch gar nicht leid. Exit:
Stell dir vor, du wärst wieder allein unter Leuten
Sängst traurige Lieder vom Sein und Bedeuten
Vom Schreien und Sich-Häuten
Vom Wollen und Nicht-Kriegen
Von Kriegen und Frieden
Vom Niemals-Zufrieden-Sein]
Richtig viel Text zu lesen gibt es ganz bald, er ist schon in der Warteschleife und ich bin gespannt, ob die (erstmals verwendete) automatische Veröffentlichung klappt. Bis dahin drei Bilder, die mir in den letzten Tagen vor die Augen kamen:
 Ohne Spuk! Schade…aber immerhin ehrlich. Wenn das Schule macht, dann schreiben Globuli-Hersteller vielleicht demnächst noch „ohne Wirkstoffe“ auf ihre Zuckerkügelchen. Obwohl… (Apropos Schule + „Schulmedizin“, über diese Wortwahl könnte ich mich jedes mal aufregen. Wenn mit wissenschaftlichen Methoden Wirksamkeit nachgewiesen wird, heisst es Medizin. Wenn nicht, Hokuspokus. „Schatz, die Waschmaschine ist kaputt, wollen wir erst mal einen Schulklempner rufen oder gleich die alternative Heilklempnerei?“)
Ohne Spuk! Schade…aber immerhin ehrlich. Wenn das Schule macht, dann schreiben Globuli-Hersteller vielleicht demnächst noch „ohne Wirkstoffe“ auf ihre Zuckerkügelchen. Obwohl… (Apropos Schule + „Schulmedizin“, über diese Wortwahl könnte ich mich jedes mal aufregen. Wenn mit wissenschaftlichen Methoden Wirksamkeit nachgewiesen wird, heisst es Medizin. Wenn nicht, Hokuspokus. „Schatz, die Waschmaschine ist kaputt, wollen wir erst mal einen Schulklempner rufen oder gleich die alternative Heilklempnerei?“)
Bevor ich mich weiter aufrege, lasse ich das lieber andere erledigen:
Und ganz zum Schluss noch etwas zum Entspannen und Runterkommen, der Blick vom Dach an einem etwas diesigen, aber schönen Märzsamstag.
Eigentlich wollte ich dem vorherigen Text einfach nur einen Nachtrag in Linkform hinzufügen. Weil er passt und Wichtiges zum Literaturbetrieb sagt. Und dann stoße ich auf den deutschen Wikipedia-Artikel zu „Post Skriptum“ (schreibt man nie aus!):
Das Postskriptum stammt aus der Zeit der Briefe, als man alles von Hand schrieb. Es hatte den Vorteil, dass durch das Vergessen eines wichtigen Teiles nicht alles nochmals geschrieben werden musste, sondern man es einfach anhängen konnte. In der Zeit der E-Mail-Kommunikation wird es jedoch hauptsächlich dafür verwendet, um Dinge anzuhängen, die nichts direkt mit dem eigentlichen Thema zu tun haben.
Der erste Satz allein hat mich für eine halbe Stunde wehmütig-nostalgisch schluchzen lassen, nur unterbrochen von „Mein Gott, ich muss wirklich alt sein!“-Stoßseufzern. Fast.
Andererseits: Wikipedia und Wikipedianer und überhaupt … irgendwo müssen sie sich ja auch im Internet tummeln. Diejenigen, die früher – in der Zeit der Briefe, als man alles von Hand schrieb – in Kaninchenzüchter- und Kleingartenvereinen organisiert waren. Schönes Wochenende!
Als ich vor knapp zwei Wochen mit einem alten Freund bei mehreren Bieren saß, kam das Gespräch irgendwann natürlich auch auf die aktuellpolitische Lage: Die Krim war gerade annektiert worden/ hatte gerade abgestimmt. Wir theoretisierten, wie es denn weitergehen würde, und mir rutschte beim Thema „Was wird aus der Ukraine“ das Wort „Rest-Tschechei“ raus.
Auch in dieser Woche konnte ich nicht vom Kneipenbesuch lassen, und siehe da: Die Ukraine drängte sich wieder auf. Ich berichtete meinem Gegenüber von dem Mord am „Weißen Sascha“, woraufhin ihm spontan ein „Ach, die Nacht der langen Messer?!“ entfleuchte.
Solche flachen historischen Vergleiche sind allerdings nur in vernebelten rauch- und bierdunstschwangeren Lokalitäten zulässig. Natürlich wiederholt sich Geschichte nicht, weder als Farce noch als Tragödie. Aber ein Vergleich lohnt sich allemal, um Grundmuster und -mechanismen zu erkennen, denn davon gibt es, wie der Name schon sagt, nicht allzu viele. Allein die Umstände führen zur Varianz.
So schrieb Friedrich Kellner am 22. Juni ’41, dem Tage des Überfalls auf die Sowjetunion, in seiner hessisch-ländlichen Zuflucht:
Mit was auch unser Vorgehen begründet werden mag, die Wahrheit wird einzig und allein auf dem Gebiete der Wirtschaft zu suchen sein. Rohstoffe sind Trumpf. […] Die Armee sucht Futterplätze, und die Herren von der Industrie wollen billige Rohstoffe.
(Friedrich Kellner: „Vernebelt, verdunkelt sind alle Hirne.“ Tagebücher 1939–1945. Göttingen 2011, S.156)
Man könnte hier also ein Grundmuster ausmachen und einen Vergleich ansetzen. Eine Gleichsetzung, beispielsweise des Freihandelsabkommens und des Assoziierungsabkommens mit folgendem Kellner-Zitat (immer noch zum gleichen Anlass, vom 28. Juni ’41) wäre zwar naheliegend, aber … :
Endlich ist es soweit, daß die Großkapitalisten aller Länder – getreu dem Rufe ihres Führers Hitler – dem verhaßten Regime in Rußland den Garaus machen wollen. (S.163)
Ein weiterer kleiner geschichtswissenschaftlicher Exkurs sei noch gestattet: Aus der Крим ist also (wieder) die Крым geworden. What’s new?
Fast alle europäischen Grenzgebiete sind mehrfach kodiert, fast alle Städte und Orte in diesen Übergangs- und Gemengelagen haben Doppel- und Dreifachnamen. Das ist mehr als ein Hinweis auf politisch korrekte Zitierweise, es ist vielmehr eher die Spur in eine Geschichte, die komplexer ist, als daß sie auf den Nenner eines Namens gebracht werden könnte.
(Karl Schlögel: Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. Frankfurt/M., 2006, S.227.)
In seinem 2003 erstmals erschienem Werk („Dieses Buch glüht von innen.“ Die Zeit. Naja…) behandelt Schlögel unter anderem ausführlich die Rolle von Karten verschiedenster Art. Dass dies auch und gerade heute wieder hochaktuell ist, darauf weist Michael Schmalenstroer zu Recht hin. Nochmal Schlögel:
Im Zeitraffer betrachtet, ist die ganze europäische Geschichte eine ununterbrochene Geschichte der Macht- und Grenzverschiebungen … (S. 145)
Wieso also sollte sich das ändern? Schon vor elf Jahren konstatierte er:
Das neue östliche Europa ist gekennzeichnet von einem krassen Nebeneinander, einer „Gleichzeitgkeit der Ungleichzeitigkeit“, wie sie im Buche steht: das 21. neben dem 18. Jahrhundert. Das sind die Konfliktzonen der Zukunft, in denen sich der Haß auflädt und militant entladen wird, weit mehr als jener clash of civilizations, der von den Unterschieden der Kulturen und Glaubensbekenntnisse ausgehen soll. (S.469)
Klar, für die Arbeit des Swoboda-Politikers und stellvertretenden Vorsitzenden des Ukrainischen Komitees für Meinungsfreheit im Kiewer Parlament, Igor Miroschnitschenko, braucht man nicht bis ins 18. Jahrhundert zurückgehen. Ein ähnliches Verhalten fand und findet man regelmäßig, auch in Europa, nicht nur unter Goebbels oder Stalin. Doch selten gab es so deutliche Bilder davon. Aber genug der Geschichte, dazu hat Tucholsky eigentlich schon alles gesagt (der übrigens auch schon was über Gentrifizierung zu berichten wusste, und zwar aus deren Mutterland).
Und eben: What’s new? Über Hipster haben in den 1950ern schon Eric Hobsbawm, Jack Kerouac und Norman Mailer geschrieben. Gut, es waren andere Hipster, und in Texten über sie steht heute vielleicht weniger rassistisch-esoterischer Quatsch als bei Mailer und der deutschen Rezeption dazu, trotzdem hat dieser Text mehr zu bieten als das plakativ-ironische „What Berliners don’t say“ (was trotzdem für den einen oder anderen kurzen Lacher gut ist): eine Facebook-Seite, deren Top-Beiträge jüngst von dem „The Hundert„-Magazin zusammengetragen wurden, was den Freitag dazu verleitete, die Magazin-Seite abzufotografieren und das Foto dann bei Facebook hochzuladen. (Eigentlich schon wieder viel lustiger als die Zusammenstellung an sich: auf dem bei fb hochgeladenen Freitags-Foto von dem Magazin-Beitrag ist die dort abgedruckte originale fb-Adresse zu lesen). Womit wir mal wieder beim Journalismus wären, dem es ja derzeit an die Kapuze geht.
Die einen beschäftigen sich mit Hoodies oder den Schuhen des Internetministers, die anderen mit der Branchen-Zukunft. Wobei die besseren Artikel der letzteren Kategorie meist nicht hierzulande geschrieben werden. Wie man guten deutschsprachigen Journalismus machen kann, zeigen – wer hat’s erfunden? – die Schweizer. Das ist aber lang, und lange Texte liest doch eh kaum jemand. Hier kehrt man lieber vor fremden Türen: Wenn mal nicht die Blogger dran sind, dann eben die Literaten. Dabei kann schon ein Blogtext zur Aktualität Büchners den Großteil des auf Zeitungspapier gedruckten Feuilletons in den Schatten stellen. Vermute ich mal, ich habe lange keine Zeitungen gelesen, zugegeben.
Wie absurd diese Distinktionsversuche zwischen Journalismus, Blogs und Literatur sind, zeigen auch die großartigen (literarischen) Beiträge auf unzähligen Blogs immer wieder. Natürlich muss Glumm hier an erster Stelle genannt werden, der gerade mit den „Geplant war Ewigkeit„-Fortsetzungen wahrscheinlich nicht nur mich beeindruckt und sprachlos zurücklässt. Er kennt „den Literaturbetrieb“ durchaus auch von der anderen Seite, konnte dort aber eben (noch) nicht landen. Was mehr über „den Literaturbetrieb“ sagt als über Glumm.
Via sunflower22a (die auch längst hätte erwähnt werden müssen, obwohl ich mir über sie noch nicht einig bin – doch wie auch, wenn sie selbst „I am a mystery“ schreibt) bin ich auf einen weiteren tollen Text gestossen: Bemerkenswerterweise spielen auch hier A&P (kein Link, dafür ein Erinnerungsfetzen: Ein alter Jugendfreund spielte mal in einer Punkband, die so hiess, benannt nach einer Supermarkt-Hausmarke) wieder eine Rolle – wenn das Internet diese Seite aushält, kann uns nichts mehr etwas anhaben. Auch tikerscherk darf nicht unerwähnt bleiben, bei der gerade Themenwoche ist, nicht nur kubanische, wenn ich das recht verstehe. Und täglich kommen so viele gute, neue Texte dazu. Bücher natürlich ebenso, auf die ich aber auch vermehrt durch Blog–Rezensionen aufmerksam werde.
Wer hier noch etwas zum Thema „Kreuzberger Wohnverhältnisse“ oder „Geschichten von früher“ erwartet hatte: bittesehr. Das war’s dann aber für heute, irgendwann muss ja auch mal Schluss sein!
[Falls wer fragt: Ich mache das nur, damit ich die Links auch irgendwo habe und die Lesezeichenliste frei für Neues ist. Sonst geht es mir gut. Sagen die Stimmen in meinem Kopf.]
Hatte ich was von Punk gesagt?
16.03.14
Ich musste dringend mal raus. Raus aus dem Netz, raus aus der Wohnung – wieso also nicht auch raus aus dem Kiez, dachte ich mir und verabredete mich im Mauerpark. Am Vortag ging es mir schon ähnlich und ich an den Kanal. Keine Ahnung, ob es die Sonne und die frische Luft draussen oder das Halbdunkel und die muffige Luft drinnen (in der Wohnung und in meinem Kopf) waren, die mich dorthin streben liessen. Eine kleine Kanalrunde: Ein Eis auf der Brücke, vorm Urban lang. Der Schwänefütterer, der sein Lager unter dem Baum und auf dem Betonsockel hat, war da, wie immer. Ebenso die Krankenhausbewohner, die sich in ihren Rollstühlen an die Zigaretten und ihre Angehörigen klammerten.
Es gab noch ein paar andere, die hier langschlenderten, aber insgesamt viel weniger, als ich eigentlich erwartet hätte. Es wurde auch kühl, langsam, es war Anfang März und kurz nach fünf, die Sonnenstrahlen erreichten diese Kanalseite nicht mehr. Ich schlug den Kragen der Jacke hoch und ging weiter, während zwei ältere Damen auf ihren nigelnagelneuen Elektrorädern rätselten, ob das Restaurantschiff jetzt ausgebaut worden ist oder schon immer so gross war.
Die zwei Kugeln Eis, die ersten in diesem Jahr, wenn ich mich recht erinnere, waren aufgeschleckt, Zeit also für das obligatorische Augustiner aus dem Späti, der den Kanal wahrscheinlich bis oben hin füllen könnte mit der Kohle, die er Sommer für Sommer durch die ganzen Touristen hier machte. Wenn er nicht die wahrscheinlich ebenso gestiegene Ladenmiete bezahlen müsste. Vermute ich mal, ich habe ihn nicht gefragt. Auch auf der Admiralbrücke war nicht viel los, nur zwei Musiker, keine Verstärker, die Autos kamen noch problemlos durch.
Auf der anderen Seite des Kanals schien die Sonne noch, ich zog den Reissverschluss der Jacke auf und liess die Frühlingsabendluft rein. Auf dem Weg zu dem Baum, unter dem wir im letzten Sommer so oft sassen, tranken, redeten und rauchten begegnete ich dann doch noch den unvermeidlichen Hipstern: Einer lag quer über den staubigen Pfad, komplett eingerollt in ein grosses Leinentuch, und räkelte sich darin zeitlupenhaft. Drei andere standen drum herum und filmten und fotografierten das Geschehen. Kunst wahrscheinlich, doch dafür hatte ich keine Zeit, nicht für ihre. In meinem Kopf setzten sich schon seit ich das Urban passierte Zeilen zusammen. Also beachtete ich sie nicht weiter und sah zu, dass ich den Baum erreichte, der zum Glück noch frei war: Bier getrunken, Zigarette geraucht, Foto geschossen und Gedicht geschrieben, dann ging es zurück.
Und heute war dann der Prenzlauer Berg dran. Ich musste wirklich den digitalen Stadtplan zu Hilfe nehmen, um die Strassennamen auf der Karte in meinem Kopf zu vervollständigen, so lange war ich schon nicht mehr hier. Und das, obwohl ich mal gar nicht so weit weg wohnte.
Die erste Überraschung für mich war, dass der U-Bahnhof Eberswalder Strasse jetzt zwei Aufgänge hatte. Ich suchte die altbekannte Strecke, Schwedter oder Oderberger mussten es gewesen sein. Klar, der kürzere Weg wäre der gewesen, der die Eberswalder bis direkt vor die Tore des Parks führt, doch ich wollte mir die Ecke anschauen, in der es früher den ersten halbwegs vernünftigen Falafel der Gegend gab, gucken ob die Kneipe noch da war, in der A. manchmal mit ihrem neuen Freundeskreis feierte, damals. Die Oderberger war es, das erkannte ich immerhin noch. Doch inzwischen war in so gut wie jedem Haus unten eine Bar, ein Restaurant oder ein Klamottenladen, so dass ich Mühe hatte, die alte Kneipe auszumachen. Schliesslich entdeckte ich sie doch, sie war immer noch da.
Im Park selbst war glücklicher- und überraschenderweise gar nicht so viel los: Ein paar Sprayer an der Mauer, ein paar Kiffer auf der Bank und ein paar Familien auf dem Bauernhof. Die sahen alle so aus, als ob sie perfekt hier her gehören würden. Dazu wehte eine überaus steife Brise, was uns beiden recht gut gefiel, wir waren damit gross geworden. Man konnte fast meinen, die Luft würde auf einmal salziger schmecken. Nachdem wir die Runde beendet hatten, bekamen wir Hunger und mir wurde von einem Burgerschuppen um die Ecke erzählt. Ich befürchtete schlimmes, war aber trotzdem neugierig. Der Laden war voll, wir mussten uns deshalb nach draussen setzen, die Sonne schien noch eine Viertelstunde. Viel zu kurz, um in dem überfüllten Hipsterladen bedient zu werden. Immerhin kam das Servicepersonal ab und zu mal zu uns raus, allerdings nur, weil drinnen zu viel Lärm war, um mit ihren native-language-skills auf Englisch lautstark kundzutun, dass leider alles schon voll wäre. Der Burger selbst war okay, aber dieses ganze Gewese und die einsetzende Dämmerungskälte nicht wirklich wert.
Dank des hochpreisigen Burgers musste ich auf dem Rückweg noch Geld holen. Vor der Bank stand jemand stark schwankend mit einer Obdachlosenzeitschrift vor der Brust. Die Augen geschlossen, den Mund offen, ein paar Speichelfäden hangelten sich den struppigen Bart hinab. Allerdings kam er gar nicht auf die Idee, die Tür aufzumachen oder Ähnliches, wie es seine Kreuzberger Kollegen immer taten. Auch Geld interessierte ihn gerade nicht: Einzig und allein in der Vertikalen zu bleiben, das war sein höchstes, schier unerreichbares Ziel. Die Zeitung brauchte er wohl nur, um sich daran festzuhalten. Dabei wollte ich ihn nicht weiter stören und betrat das samstagnachmittägliche Bankfoyer. Dort hatten sich die beiden Kumpels des Pförtners ausgebreitet, es war draussen wohl zu windig. Schon gestern abend, als sie hier ihr Lager aufgeschlagen haben mussten. Ein paar leere Kornflaschen wurden durch die Windböe, die ich mit reinbrachte, durch den Raum gerollt. Die beiden Männer kümmerte das nicht weiter, sie lagen im Halbschlaf auf ihren Decken, neben ihnen standen halbleere Plastikflaschen, mit Wasser oder einer anderen klaren Flüssigkeit gefüllt. Einer blinzelte mir kurz zu, bis ihm der Wind die Zigarettenstummel, trockenen Blätter vom letzten Herbst und Plastikfolien entgegentrieb. Dann drehte er sich kopfschüttelnd um.
Komische Gegend, dachte ich, als mir auf dem Weg hoch zur U-Bahn eine Junggesellenabschiedsgang mit den obligatorischen Spassbrillen und identischen T-Shirts entgegenkam.
Fast hätte ich ihn vergessen, den Welttag der Poesie. Nun denn:
22.10.03
Bedenkt man`s recht
sind Bordsteinschwalben
viel weniger obszön
als die versiegelten Asphaltdecken
auf denen sie meist stehn.
[Inzwischen sind aberhunderte solcher Stunden mehr vergangen. Hat sich groß was geändert? Wieso dann also neue Texte schreiben?]
24.03.03
Es ist wieder so weit: Bildungsfernsehen ist angesagt. Nachdem wir inzwischen schon fast wieder vergessen haben, wo Mostar und Tetovo, Kandahar und Mazar-i-Sharif liegen, ist das Thema des aktuellen Geographie-Telekollegs „Um Kasr“ (Umm Kasar, Um Kasre).
„Zum Glück haben wir unseren embedded correspondent im Einsatz. Wolf, wo liegt Um Kasr genau?“ „Susan, aus taktischen Gründen kann ich nichts genaues dazu sagen. Susan!“
„Danke Wolf!“
Ein Krieg in dem es scheint, dass die Waffen intelligenter sind als die Befehlshaber.
Eigentlich ist der Irak ja nichts weiter als eine Ansammlung von Widerstandstaschen.
Die Lage wurde nicht unterschätzt, es leisten ja nur noch die irakischen Spezialeinheiten Gegenwehr, doch davon gibt es genug: Republikanische Garden. Fedeejin. Spezielle Republikanische Garden. Jeder irakische Soldat ist seine eigene Spezielle Republikanische Garde. Von den Parteimitgliedern mal ganz zu schweigen.
Laut SPIEGEL geht gerade die „Generation Golfkrieg“ auf die Straße.
Sechzehnjährige mit ihrem Alter angepassten Transparenten: „Illuminati stoppen!“ „Bombing for peace is like fucking for virginity!“ Schülerdemos! Pisa ist vergeben und vergessen.
Saddam Hussein soll vor Kriegsbeginn an George Bush das Angebot gerichtet haben, man könne den Streit ja auch per Fernsehduell entscheiden, das sei doch in Amerika so üblich. Wenn das kein Medienkrieg ist! Sechs Stunden vor Ablauf des Ultimatums erschien auf einem Nachrichtensender eine Countdown-Uhr, mit dem Titel „Deadline“.
Die Reporter in den Flüchtlingscamps jenseits der irakischen Grenze hätten am liebsten ganze Hubschrauberstaffeln zur Verfügung gestellt, damit sie auch schnell genug ihre Bilder füllen können. Und wer kam? Keine Iraker, sondern Afrikaner! Was wollten die denn hier? Bilder von geflohenen Afrikanern in Zelten können wir jeden Tag bekommen!
D-Day hieß diesmal A-Day. Die Bomben sind laut Rummie so intelligent, dass sie einen Laster (= mobiles Massenvernichtungswaffenlabor, natürlich.) unter einer Brücke treffen können, “without hitting the bridge”. Von Luftkrieg ist die Rede. Hat jemand in der letzten Zeit was von einem irakischen Militärflugzeug gehört?
Nach der Demo gehen wir nach Hause, bezahlen weiter die Rechnungen und freuen uns irgendwie trotzdem, dass endlich Frühling ist.
oder lustig und gelogen?
Schon allein wegen „Bärlauch, Bärlauch, eins, zwei, drei, vier“, „Schau mal da oben, Biofeuerwerk!“ und „Ho-Ho-Holzspielzeug“ gefällt mir das. Aber eigentlich wollte ich nur auf diesen schönen Text von Anne Wizorek hinweisen, die dort den mir bisher unbekannten Reinald-Grebe-Song verlinkte. Da das aber für einen ganzen Blogpost auch irgendwie zu wenig ist, fische ich mal einen halbwegs passenden alten Text aus dem Archiv. Und weil ich mich erst mal wieder verkrümel und es mit der Sonne vorbei sein soll, gibt es sogar noch ein Bild (von 1997 schätzungsweise, ein altes Papierfoto, bestimmt bei einem Schlecker entwickelt; gibts beides nicht mehr) als Bonus: Meine Prenzlauer-Berg-Wohnung, relativ frisch nach dem Einzug. Von wegen:
„Das weiß doch keiner mehr, wie das hier noch vor 20 Jahren
Ausgesehen hat, ausgesehen hat, ausgesehen haaat!“
01.03.03
Am Aktionstag der BVG zu ihrem 100. Geburtstag entschloss ich mich, mal in die Schönhauser Allee zu fahren. So ganz bewusst. Denn genau wie viele andere touristische Sehenswürdigkeiten Berlins hatte ich die Schönhauser Allee unter diesem Gesichtspunkt noch nie bewusst erlebt. Sicher, ich war schon öfter da, mein Zahnarzt liegt ganz in der Nähe, aber wenn Wladimir Kaminer erfolgreich ein Buch über diese Strasse schreibt, muss da doch mehr dran sein, oder?!
Der Geburtstag der BVG wurde in Form von vermeintlicher Kunst sichtbar. Zu ihrem Ehrentag, den sie ein ganzes Jahr lang feierte, wurde die Innenbeleuchtung der U-Bahnen den jeweiligen Farben ihrer Linien auf dem Fahrplan angepasst. Praktisch bedeutete dies, dass die Waggons der U 2 in einem halbseidenen Rot erleuchtet waren. Als ich im Dunkel des Alexanderplatzes einstieg, dachte ich erst, die BVG erfüllte zu ihrem Geburtstag die Wünsche ihrer BZ-lesenden Passagiere und es gibt jetzt neben der Party-Tram und dem Stammtisch-Bus auch die Puff-U-Bahn.
Aber zum Glück fuhr die Bahn ja größtenteils oberirdisch, so dass die Beleuchtungs-Belästigung nicht allzu schlimm war. Und ausserdem: Schließlich hätten die Berliner Stadteisenbahner diese kunstvolle Idee (ausgedacht übrigens von einem Weißsee-Absolventen, wie eine Infotafel in den Abteilen informierte) auch in der U 1 umsetzen können, was zu einer giftgrünen Innenbeleuchtung geführt und garantiert unangenehme Körperreaktionen hervorgerufen hätte.
Ich stieg direkt am Bahnhof Schönhauser Allee aus. Sicher, die Station Eberswalder Strasse hatte auch einiges zu bieten, den ständig laut Bob Marley hörenden und egal bei welchem Wetter mitsingenden Gemüseundkramhändler zum Beispiel. Aber ich wollte mir ja den ganzen Straßenzug anschauen, und der fing nun mal schon weiter oben an, interessant zu werden. Wegen der Arkaden zum Beispiel. Das schreibt ja schon Kaminer. Die Arkaden sind direkt gegenüber des Bahnhofs, aus dem ich gerade raus kam.
Und ich merkte, wie verdammt kalt es doch war, da hatte ich mir eigentlich einen blöden Tag für mein Experiment ausgedacht. Sonne zwar, aber bitterkalt. Es war so kalt, dass sogar die hier ansässigen Bahnhofspunks ihre Haare in warmen Tönen gefärbt hatten.
Und als verweichlichter Kreuzberger setzte ich mich zurück in die Bahn und fuhr nach Hause, irgendwie fand ich es sowieso blöd hier. Deshalb habe ich nie die Dostoprimeschatelnosti-Qualitäten der Schönhauser Allee kennen gelernt, und nie werde ich erfahren, dass es in der Schönhauser Allee so dermassen brummt, dass die einzigen Geschäfte, die hier ihren Laden dicht machen müssen, die Bestattungsinstitute sind.
Vor Jahren besuchte ich mal ein Seminar zum „Problem der Anarchie in der internationalen Politik“. Zugegeben, als ich mir kurz vor Semesterstart meinen Stundenplan zusammenstellte, hatte ich etwas anderes im Kopf als das, worum es dann schliesslich ging. Aber es lag auch am Dozenten, dass meine Wahl auf diese Veranstaltung fiel: Er war mir vorher schon als sehr angenehmer Zeitgenosse und kluger Kopf aufgefallen, damals ging es um Hobbes, wenn ich mich recht erinnere.
Dass ich nicht sofort wusste, was mit „Anarchie in der internationalen Politik“ gemeint war, lag daran, dass ich erstens nur Nebenfach-Politikwissenschaftler und zweitens IB (Internationale Beziehungen) weit davon entfernt war, einer meiner Schwerpunkte in diesem Nebenfach zu sein. Allerdings wurde ich im Laufe des Semesters mehrfach positiv überrascht. Es handelte sich, das muss dazu gesagt werden, um ein Master-Seminar. Ich studierte dagegen noch auf einen vorsintflutlichen Magister-Abschluss hin und musste die zwei, drei letzten benötigten Scheine zusammensammeln.
So furchtbar, schlimm und vollkommen unakademisch diese ganze verkorkste Bologna-Reform auch ist (irgendwann werde ich auch dazu noch was schreiben müssen) – die Masterseminare, die ich damals besuchte, waren mit das Beste, was mir in der Uni-Karriere bis dahin passierte. Hier fanden sich diejenigen zusammen, die wirklich ein ausgesprochenes Interesse, wenn nicht gar Leidenschaft, für das jeweilige Thema hatten – und es waren meist angenehm kleine Seminargruppen von nicht mehr als zwanzig Teilnehmern, im Gegensatz zu den 60 und mehr Studierenden in äquivalenten Magisterstudiumsveranstaltungen (klar, die angehenden Master mussten es ja vorher erst einmal schaffen, sich durch den Selektionsdschungel zu schlagen, da bleibt nicht viel übrig). Sie kamen mir übrigens alle erstaunlich jung und meist ebenso schlau vor, ich sah einige von ihnen mit weit unter Dreissig schon promoviert in irgendwelchen hohen Positionen bei globalen Thinktanks oder in Politik und Medien. Wenige vielleicht auch an Forschungseinrichtungen oder Universitäten, dann wahrscheinlich mit der Habilitation beschäftigt. Aber wirklich nur wenige, denn diesen ambitionierten High Professionals hatte zumindest das deutsche Hochschulwesen keine überzeugenden Karrierechancen zu bieten; Juniorprofessuren, da lachten die sich drüber kaputt, was ja auch die einzige Lösung war, wäre es nicht so traurig.
Jedenfalls sass ich da also als Veteran aus einer längst vergessenen Zeit und führte ein halbes Jahr lang angeregte Diskussionen mit den IB-Experten der kommenden Generation. Überraschend auch, dass fast immer fast alle die durchaus anspruchsvolle Lektüre gelesen hatten: Auch soetwas gab es früher kaum. Das Fazit war recht zwiespältig: Völkerrecht, Schmölkerrecht – das zählte noch weniger als das Papier, auf dem es steht, da waren selbst nationale Verfassungen besser dran. Es ist schon so, dass für die IB eigentlich der Hobbes’sche Urzustand gilt und zwischenstaatliche Verträge dagegen nur so lange, wie beide Partner das wollen und sich vertrauen – ein Leviathan ist nicht wirklich auszumachen (Sorry, UNO, grow some balls). Das Gefangenendilemma lässt grüssen. Andererseits gibt es ja durchaus viele vernetzte Interdependenzen in der modernen, industrialisierten, kapitalistischen Welt. Und das Theorem, dass entwickelte Demokratien keine Kriege untereinander führen, wurde auch noch nicht grundsätzlich widerlegt. (Nicht zu vergessen, wie der Dozent immer wieder betonte, dass kaum noch von Supermächten gesprochen werden kann, wenn überhaupt, dann von Hegemonien. Und dieser ganze Bezug der angloamerikanischen Politikwissenschaft auf das „Westfälische System“ ist auch Schmuh, diese angebliche historische Ordnung Europas wird sowieso gnadenlos überschätzt. Mich würde interessieren, wie er inzwischen seinen alten Text, den ich grad entdeckte, nach 20 Jahren beurteilen würde.)
Heute, in dieser mal wieder historisch einzigartigen Situation, wünschte ich mir manchmal solche Seminare und Diskussionen mit klugen, jungen Menschen, die für ihr Thema brennen. Aber ich bin raus aus der Uni, die Medien ™ schüren Freie-Welt-Propaganda und die Nischenblogs versuchen ein Bild gerade zu rücken, das sich eh keiner anschauen mag. Und natürlich stehen ALLE im Verdacht, von irgendwelchen Geheimdiensten gesteuert zu werden, bewusst oder nicht. Deswegen werde ich nichts zu der aktuellen politischen Lage schreiben, wozu auch?
Trotzdem möchte ich – wenn sonst schon nix Gescheites von mir kommt – auf ein paar lesenwerte Texte hinweisen. Immerhin komme ich trotz des Wetters dazu, heimlich still und leise ein paar Zeilen in den Computer zu schreiben. Zuerst – weil ich es bei der letzten Linksammlung vergaß bzw. schon längst darauf hinweisen wollte: Eine Geschichte, die ich schon mal lobte, gibt es jetzt als kleines Büchlein zu kaufen.
Ähnlich am Herzen liegt mir das Zentrum für politische Schönheit. Manche mögen sich vielleicht noch an den „Schuld“-Film erinnern, jetzt gibt es eine Art Grundlagen-Erklärung des ZPS. Sehr lang, ich bin auch noch nicht ganz durch*, aber Schlingensief thront über allem, das kann kaum schlecht sein. In dessen Genre und Generation gibt es eigentlich nur noch einen, der mich annähernd so begeistert hat: Pollesch, ich hatte ihn schon mal erwähnt, und auch Bersarin tat es gerade wieder. Hier gibt es ein aufschlussreiches Interview mit ihm, der derzeit weit weg in Zürich wirkt: über die Verteidigung der Lüge und des Verrats, und was Petitionsunterschriften mit Derailing zu tun haben.
Wie vielleicht ja schon angeklungen, ist das mit der Politik und dem Schreiben nicht immer einfach. Und schon gar nicht mit dem Schreiben über das Schreiben (und Reden) über die Politik, vor allem, wenn alle einfach nur Literatur erwartet haben. Oder so ähnlich. Deswegen und wegen meiner Menschenscheu habe ich oft versucht, wirkliche politische Zusammenhänge zu meiden. Das ist mir nicht immer geglückt, daher weiss auch ich: die Politik war immer schon ein mieses Geschäft, sobald mehrere Menschen auf einem Haufen waren, damals wie heute. Doch wie gesagt, es klappt nicht immer mit der Enthaltsamkeit. Also nochmal zurück zu einem schon oft genug besprochenem Thema.
Die NSA und die Weltöffentlichkeit wissen dank Snowden ja jetzt um das Merkel-Syndrom. Was aber auch nicht unter den Tisch fallen sollte: Dank einer furiosen Spike-Lee-Rede hat die Gentrifizierung jetzt das Christopher-Columbus-Syndrom an der Backe: We been here, you can’t discover this! Man sollte sich das wirklich alles anhören, lauter Perlen:
And then! [to audience member] Whoa whoa whoa. And then! So you’re talking about the people’s property change? But what about the people who are renting? They can’t afford it anymore! You can’t afford it. People want live in Fort Greene. People wanna live in Clinton Hill. The Lower East Side, they move to Williamsburg, they can’t even afford fuckin’, motherfuckin’ Williamsburg now because of motherfuckin’ hipsters. What do they call Bushwick now? What’s the word? [Audience: East Williamsburg]
That’s another thing: Motherfuckin’… These real estate motherfuckers are changing names! Stuyvestant Heights? 110th to 125th, there’s another name for Harlem. What is it? What? What is it? No, no, not Morningside Heights. There’s a new one. [Audience: SpaHa] What the fuck is that? How you changin’ names?
Aber der Peak scheint langsam erreicht, selbst auf Bloomberg wird jetzt schon die Geschichte von den Israelis in Berlin erzählt, und zwar gar nicht so schlecht. Derweil treibt auch zu Hause in Gusch Dan die Gentrifzierung weiter skurrile Blüten. Doch wie gesagt: Ein Ende ist in Sicht, muss in Sicht sein. Wenn der Tagesspiegel berichtet, dass des Kiezneurotikers und Pantoufles Lieblings-Titten-Comic-Tittencomic-„Online-Magazin“ (fast hätte ich die schlechte Musik vergessen) berichtet, dass Gawker berichtet, dass erst der Rolling Stone und dann auch noch die NY Times berichteten, dass die Gentrifizierung Berlin arg zu schaffen macht und schon allein deshalb mindestens Krakau jetzt viel doller in ist – dann ist es doch wirklich langsam vorbei, oder? Ein kleiner Hoffnungsschimmer also, tausend Fliegen und so weiter. Wer immer noch nicht überzeugt ist: Andrej Holm wurde in den Dorfnachrichten ausführlich interviewt. Nicht von der Grinsekatze, sondern von dem Typen mit dem Kuli. Und davor noch ein Bericht zum Thema von Uli Zelle. Wenn die Gentrifizierung damit nicht in der Mitte angekommen (und also vorbei?) ist, wann denn dann? Vielleicht, wenn auf Spiegel-Online-TV der Bar25-Film im Stream gezeigt wird?
Also kann ich mich beruhigt wieder dem Schreiben widmen. Falls jemand noch einen defitgen Rant braucht, wir sind ja hier schliesslich im Internet, bittesehr. Und wenn das mit dem Schreiben nichts werden sollte, dann wenigstens lesen: Nächste Woche ist Indiebookday.
*Inzwischen habe ich es geschafft. Grundanliegen des ZPS ist, neben dem, was der Name schon sagt, die Sache der Menschenrechte. Sie werben für einen agressiven Humanismus, den sie recht gut charakterisieren, begründen und historisch einordnen. Ehrlich gsagt haben mich ihre Kunstprojekte – ihre Praxis also – bisher mehr begeistert als dieser Grundlagentext – die Theorie – , der war mir an einigen Stellen zu naiv, zu dicht an der Oberfläche. Trotz alledem ein wirklich lesenswertes und handlungsanstiftendes Manifest, was Blickwinkel eröffnen kann, deren bisheriges Fehlen dort zu Recht angeprangert wird.
…ist der Traum aus, möchte man gerade jetzt zynisch meinen. Und dann trifft man bei Soundtrackrecherchen zufällig wieder auf diesen Song. An diesem Ort. Zu dieser Zeit: „Der Traum ist aus“ vom unvergleichlichen Rio, mit lautstarker Publikumsunterstützung, gegeben in der Seelenbinderhalle zu Berlin, Hauptstadt der DDR, 1988. Kommt mir gar nicht als die Ewigkeit her vor, wie die 26 Jahre vielleicht suggerieren.
[Ich fass das alles nicht & bin erst mal wieder weg]
Ich glaube, es war Klaus Baum, der vor Wochen oder Monaten diesen Schnipsel verbreitete. Geändert hat sich Vieles in den Wochen, Monaten und Jahrzehnten – nicht aber der Gehalt dieses Interviewfetzens, dem habe ich eigentlich nichts weiter hinzuzufügen.
In der Geschichtswissenschaft gilt der Krim-Krieg als der erste moderne Krieg. Damit sind eher die Mittel gemeint (Eisenbahn, Waffen, Telegraphie), das Denken hinter der Kriegsführung war weniger modern und geprägt durch Fehlplanungen und -einschätzungen auf allen Seiten. Ob das, was sich derzeit in dieser Region entwickelt (der Auslöser – die Ereignisse auf dem Maidan – ist inzwischen wohl zur Fussnote verkommen; Entscheidungen werden nicht mehr von einer souveränen Ukraine getroffen, sondern in Brüssel, DC oder Moskau), ähnliche weltpolitische Konsequenzen zeitigen wird, müssen Historiker späterer Epochen bewerten. Wenn es denn dann noch welche gibt. Das Potential dazu ist jedenfalls vorhanden, ich traue einigen Akteuren durchaus zu, einen grossen Drang danach zu haben, das Ventil mal wieder richtig aufzudrehen. Sewastopol als nächstes Sarajewo, nichts ist unmöglich. Aber lassen wir das Spökenkieken und beschäftigen uns lieber mit naheliegenderen (oder näherliegenden?) Sachen. Mit Klowänden zum Beispiel.
Der Werbefuzzi von Matt bezeichnete vor acht Jahren Blogs als solche, genauer: als die Klowände des Internets. Ausgerechnet übrigens in Verteidigung der „Du bist Deutschland“-Kampagne, die mit ihrer Sloganwahl – um mal im Bild zu bleiben – ja auch kräftig in die Schüssel gelangt hat.
Ich mag Klowände, da gibt es immer was Interessantes zu lesen, selbst bei denen im Real Life. Pure Ablenkung davon, dass man eigentlich selbst die Wände vollschreiben sollte. Erst einmal „die Anderen“ – auch Journalisten machen Fehler: Manchmal grosse, indem sie die grundlegenden Prinzipien ihrer Branche vernachlässigen. Manchmal kleine, indem sie einfach das Thema verfehlen. Manchmal gedankenlose, die ihnen hätten auffallen müssen, es aber zu unserer Belustigung nicht taten.
Und jetzt „wir“: Unsere Klowände sind oft dazu da, einfach mal den Unmut über den ganzen verdorbenen Mist in der Welt rauszulassen. Doch bei genauem Hinsehen kann man erkennen, dass ebenso häufig Selbstzweifel (statt Kritik an anderen) thematisiert wird, nicht immer so laut, aber dafür um so intensiver und berührender.
Eine kleine Ausrede, die mir gerade hilft: Es gibt auch etwas über das Schreiben zu lesen, noch dazu mit einem treffenden Titel. Die Quintessenz: Wir können uns nicht aussuchen, was sich in unserem Kopf einnistet – oder welche Geschichten darauf warten, von uns erzählt zu werden. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Hinweis auf den richtigen Umgang mit Autoren. Den liefern Katrin Passig (Journalistin? Bloggerin? Autorin? Take your pick…) und Ira Strübel. Eigentlich müsste ich den Artikel in Gänze hier zitieren, aber so greife ich wahllos eine Passage heraus:
Vermeiden Sie auch die Frage, wie die Arbeit am nächsten Buch vorangeht. Selbst wenn der Autor täglich acht Stunden damit zubringt, in eine leere Datei zustarren, und sich den Rest der Zeit betrinkt, wird er auf Ihre Frage nur «achja, ganz gut» antworten. Jetzt sind Sie nicht klüger als zuvor, der Autor aber ist an seinen schweren Beruf erinnert worden und bekommt schlechte Laune. Für den Rest des Gesprächs hadert er damit, keine Schreinerlehre gemacht zu haben.
Wenn es gar nicht mehr geht, mit den Klowänden und dem, was dort so zu lesen ist – auch das kann passieren – wenn es einem also hochkommt: Manchmal gibt es dafür eine Lösung, nur ein paar Schritte weiter. Ich war begeistert, als ich auf einer Hochzeit in Friesland folgende lebenspraktische Installation entdeckte. Jahrelange Erfahrungen mit der Landjugend und ihren Hinterlassenschaften im Mehrzweck-Veranstaltungssaal führten wohl zu diesem sanitären Pragmatismus:
( Dieses Becken befindet sich auf Waschschüssel-Höhe, so umgeht man das unwürdige Knien. Auch schön & praktisch: Die Griffe.)
Niemand scheint so richtig zu wissen, was in der Ukraine gerade passiert, und vor allem, wie die verschiedenen Akteure dort einzuordnen sind. Langsam wird auch hierzulande klar , dass die Nazis Nationalisten Nazis von der Swoboda um einiges mehr zu sagen haben als Klitschko, da kann er noch so sehr rudelweise mit den Mikrofonen deutscher Medien bedrängt werden.
Ganz ehrlich frag ich mich ja manchmal mit leichtem Schaudern, wer wohl bei uns am besten organisiert (bzw. gerüstet) wäre, wenn es zu ähnlichen Szenen kommen würde; rein hypothetisch natürlich.
Jedenfalls fiel mir heute folgender Aufkleber auf, der drei Häuser weiter an der Tür pappt:
Copy&Paste-freundlich steht da: дістала руїна та побори в лікарнях? підтримай майдан!
Nun ist mein Ukrainisch ziemlich schlecht, sprich: es besteht aus rudimentären Schulrussischkenntnissen, aufgefrischt durch Konversationen mit der exilsowjetischen Diaspora. Immerhin komme ich mit Kyrillisch klar, auch wenn die Ukrainer da ein paar lateinische Buchstaben mit reinpacken – sie scheinen wirklich in allen Bereichen zerissen zu sein zwischen Ost und West, wenn mir eine Platitüde erlaubt ist.
Es geht um etwas „in Krankenhäusern“, vermutlich Zerstörung und Erpressung. Der Microsoft-Übersetzer will mir die ganze Zeit was von „gepimpt“ erzählen. Ganz unten steht „Unterstützt Maidan!“.
Falls jemand mehr weiss: Nur her mit den Infos!
Ansonsten verabschiede ich mich erst mal in eine Schreibpause, voraussichtlich. Ich weiss nur noch nicht genau, ob vom oder zum Schreiben.
Bisher sind diese Stöckchen ja immer an mir vorbei gegangen. Aber jetzt wirft mir tikerscherk eins zu. Und ihr kann ich das nicht abschlagen. Nun denn:
1.Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Oder wünschst du es dir? Warum?
Absolut nicht. Also glauben. Wünschen wohl schon manchmal, rein aus Neugier.
2. Was verbindest du mit dem Wort „Heimat“?
Puh. Zuerst Kindheit. Da könnte ich ein Buch drüber schreiben. Wollte ich auch mal, das sollte allerdings „Heimaten“ heissen. Ich hab da nämlich ein paar von, was eigentlich ganz gut ist. Patchwork-Heimaten sozusagen. Kann ich generell empfehlen, wenn man die ei(ge)ne beginnt, zu ernst zu nehmen.
3. Wenn du noch einmal anfangen könntest, welche Entscheidung würdest du rückgängig machen oder anders treffen?
Sehr viele. Die meisten davon aber auch wieder einfach nur aus Neugier. Hätte ich andere Entscheidungen treffen sollen, bereue ich welche? Klar. Ich habe bestimmte Menschen verletzt und mit anderen zu wenig Zeit verbracht. Und hätte mit dem Hund das eine mal viel früher zu dem anderen Arzt gehen sollen.
4.Wie würdest du diesen Satz beenden: Pädophile sollten…
… zur Charité gehen, da gibt es ein Projekt. Und ansonsten von der Gesellschaft als das betrachtet werden, was sie sind: Menschen mit einer abweichenden Sexualität, die ausgelebt anderen Menschen ungeheuer schadet. Ich halte wenig von der medialen Behandlung des Themas, aber ich verstehe durchaus den Mechanismus dahinter. Es braucht „Monster“, auf die gezeigt werden kann. Wäre ja auch nicht spektakulär, und nicht mehr so „fremd“, wenn sachliche Aufklärung verbreitet werden würde. Nicht zu vergessen, dass viel zu oft Machtausübung, Frustration oder andere „Abartigkeiten“ Ursache von Missbrauch und Misshandlungen sind. Ich kann aber gut nachvollziehen, wenn Betroffene oder Menschen aus deren Umfeld auf diese Frage „Eier abschneiden und aufhängen“ antworten. Nur dass „die Medien“ eben keine Betroffenen sind.
5. Und diesen: Sigmar Gabriel sollte..
…die Fresse halten.
6. Und zuletzt: Alice Schwarzer sollte…
…auch die Fresse halten.
7. Wenn du an einen Toten denkst, welche seiner Wünsche erscheinen dir wichtiger: die Erfüllten oder die Unerfüllten (angelehnt an Max Frisch)
Hm. Was ist wichtig? (angelehnt an Selig…) Ausserdem: Auch erfüllte waren mal unerfüllt. Werden also Wünsche durch ihre Erfüllung wichtiger oder unwichtiger… Ich glaube, das kommt wirklich ganz auf den Wunsch an. Erfüllte Wünsche können dich glücklich sterben lassen, unerfüllte am Leben halten, eventuell unglücklich. Schwierig.
8. Stimmt der Satz: Jeder ist seines Glückes Schmied?
Absolut nicht. Umgekehrt wird ein Schuh draus: Die Einflüsse, die wir nicht in der Hand haben, sind viel wirkmächtiger. Das passt uns nur nicht, weshalb wir uns selbst die verrücktesten Sachen vormachen. Oder unser Gehirn.
9. Was bedeutet für dich Gerechtigkeit?
Eine Utopie, die nie erreicht werden kann, ohne die es aber nicht geht. Wenn jeder wirklich nach seiner Facon glücklich werden kann.
10. Wie beurteilst du die Rolle der Kirche in unserer Gesellschaft? Und wie die der Gewerkschaften?
Ich wünschte, wir bräuchten sie nicht, beide. „Die Kirche“ geht mir gewaltig auf den Senkel, da bin ich radikaler Laizist. Helfen sie Armen und Bedüftigen? Klar. Dafür sollte es aber keine Kirche brauchen. (Sowohl die Menschen als auch die Mittel sind ja da). Und es wiegt ausserdem nicht den Riesenhaufen Mist auf, den sie machen.
Bei den Gewerkschaften sieht das ähnlich aus: Ihr Heiligstes ist das Lohnarbeitsverhältnis. Und solange sie um dieses Kalb rumtanzen, stehe ich weiter am Rande. Sicher waren sie historisch wichtig, sicher gibt es kluge Köpfe in ihren Reihen, sicher bieten sie für einige davon eine gewisse Nische mit Artenschutz. Und trotz häufigen Einknickens wären wir ohne sie schlechter dran – trotzdem, ich hatte das grade schon bei Charlie geschrieben: Sie sind nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Systems bzw. Problems.
11. Wenn du ein Buch wärest, was für ein Buch wärest du dann?
Ein staubiges, zerfleddertes, das in der Ecke eines verlassenen Treppenflures liegt. Mit sieben Siegeln.
[Muss ich das jetzt weiterschmeissen oder darf ich das untätig behalten? Wo ist überhaupt das Stöckchen-Regelbuch versteckt? Wieso heisst das Stöckchen? Weil das Blog von log kommt? Hat unser Maat schief geladen? Fragen über Fragen…]
[Wenn ich wollte, was könnte ich mich weiter aufregen. Aber das sollte ja hier nicht passieren. Stattdessen wieder ein alter Text, aus einer Zeit, als noch Autos durchs Brandenburger Tor fahren durften. Doch, doch, das stimmt, das gab es mal. Und auch alles andere in diesem Text ist genau so passiert. Ischwöre.]
Else
Manchmal, wenn gerade keine kulturelle Großveranstaltung in der Stadt ist, habe ich vor Langeweile ganz verrückte Ideen. So ähnlich wie nachts bei Rot über die Ampel gehen. Wenn kein Auto kommt. Wenn eins kommen würde, das wäre mir schon wieder zu crazy, wie man heute so sagt.
Einmal bin ich über den Kudamm geschlendert, also eher Kantstrasse, aber dit is ja allet Kudamm da, wa, und bin in den Beate-Uhse-Laden gegangen. Damit auch ein paar verklemmte Touris mal reinschauen, haben die noch ein Erotik-Museum da mit drin, aber das interessierte mich weniger. Die Touris, so ganz nebenbei, sehen das glaube ich ähnlich.
Ich bin schnurstracks auf die Gummipuppen drauf zu, und nach einer halben Stunde verlegen umherschauen habe ich mir dann endlich eine genommen und bin zur Kasse gerannt, habe bezahlt und nix wie raus.
Dann bin ich ganz schnell nach Hause. Ausgepackt und aufgeblasen und da war sie in ihrer vollen Pracht. Doch sie war noch nicht komplett, es fehlte noch etwas.
Vor zwei Wochen hatte ich einen Kumpel zu Besuch. Also eher einen flüchtigen Bekannten, der wie der Name schon sagt… Jedenfalls, der war Sprayer, und das hatten in der Nacht auch noch Leute mitbekommen, die es besser nicht wissen sollten. Er hat seinen Rucksack bei mir gelassen, weil er Angst hatte, dass sie irgendwo auf ihn warten und dann in seinen Rucksack schauen.
Ich kramte in dem Rucksack rum und richtig, nebst allen anderen Farben des Regenbogens war auch eine Dose Gold-Spray dabei. Ich nahm also die Else, so nannte ich sie schon liebevoll, und sprühte sie von oben bis unten ein, bis sie richtig glänzte. Am schlimmsten waren die zwei Stunden danach, die ich warten musste, bis Else trocken war. Dann packte ich sie ins Auto. Ich fuhr ein wenig durch die Gegend, und auf der Straße des 17. Juni parkte ich irgendwann. Nachts verirren sich wirklich nur ganz bestimmte Leute in den Tiergarten, das muss man mal sagen.
Ich stieg aus, nahm die Else aus dem Kofferraum und dann noch das extralange Seil, das ich vorsorglich mit eingesteckt hatte. Jetzt gab es kein zurück mehr. Es waren nur circa 500 Meter zur Siegessäule, kein Problem. Und, als Berliner müsste man das ja wissen, um auf die Siegessäule zu klettern, braucht man gar kein Seil, das geht auch anders, da gibt es eine Treppe. Die kletterte ich dann auch hoch, mit der Else in der einen und dem Seil in der anderen Hand. Als ich ganz oben war, nahm ich eine Tube Pattex, die ich glücklicherweise noch dabei hatte, und klebte meine Else an die Stelle, an der vorher dieser komische Engel stand. Den hatte ich vorher abgeschraubt und unter den Arm geklemmt. Auf dem Weg nach unten erzählte mir der Engel, dass er gar kein Engel ist und auch Else heißt, was ich enorm lustig fand.
Sobald ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte, beeilte ich mich, ganz schnell wieder ins Auto zu kommen. Schließlich könnte ja jemand denken, dass diese goldene Engelsfigur unter meinem Arm geklaut ist. Ich packte sie in den Kofferraum und fuhr los, so knapp `nen Kilometer, bis ich wieder anhielt. Raus aus dem Auto, Else Zwei aus dem Kofferraum geholt und rauf auf`s Brandenburger Tor. Dort stellte ich sie hinten auf den Wagen der Quadriga, was die Else total toll fand, von wegen ganz andere Perspektive mal und so. Die Siegesgöttin, die dort sonst steht, habe ich auf einen Kaffee eingeladen, was sie bereitwillig annahm. Unter anderem auch wegen der Perspektive.
Als die Sonne dann irgendwann aufging, und die Siegesgöttin immer noch auf meinem Sofa schlief, bekam ich ein schlechtes Gewissen. Ob uns jemand zusammen gesehen hatte? Und selbst wenn nicht, das fällt doch bestimmt auf!
Doch nichts war, nach zwei Tagen hatte immer noch keiner was gemerkt, und die Siegesgöttin nervte mich langsam mit ihrer „Keiner-mag-mich-niemand-vermisst-mich“-Tour. Klar, irgendwie hatte sie ja recht, von wegen Wahrzeichen, es kümmerte die Stadt einen Dreck, was da oben auf dem Brandenburger Tor war. Aber mir wurde es zuviel. Ich fuhr nachts wieder zum Pariser Platz und brachte alles an selbigen, also seinen Platz. Vorher allerdings habe ich noch ein Foto geschossen, wie all die Berlin-Touristen tagsüber. Was die wohl denken, wenn sie ihre Bilder entwickeln, und das da oben auf dem Brandenburger Tor irgendwie anders aussieht als in den Reiseführern? Da werden sie bei ihren Diashows zu Hause mit enormen Glaubwürdigkeitsproblemen zu kämpfen haben.
Die Else Zwei freute sich übrigens auch. Sie fand es zwar ganz nett, aber es gefiel ihr besser, wenn die ganzen Autos und Busse um sie herum fuhren, statt unter ihr durch. Also wieder rauf auf die Siegessäule. Ich hatte nur noch ein Problem: meine Else. Ich musste sie schließlich wieder mitnehmen. Doch wo hin mit ihr? Zu Hause im Schrank verstecken und dann vergessen und wenn man dann irgendwann mal eine Frau zu Besuch hat und die den Schrank aufmacht…. Nee, nee.
Ich fuhr also wieder zum Kudamm (Kantstrasse, ihr wisst schon). Dort stieg ich in das Beate-Uhse-Haus ein und brachte die Else zurück. Gut, ich habe sie nicht unbedingt in das gleiche Regal gepackt, da war sie auch viel zu gross für, war ja immerhin aufgeblasen und durch den Goldlack relativ starr. Deswegen habe ich sie in das Erotik-Museum gestellt, da geht ja eh keiner hin.
Die nächsten Tage war ich schon ein wenig frustriert. All meine waghalsigen Aktionen waren für die Katz. Höchstens ein paar Japaner, die etwas davon mitbekommen haben, auf ihren Kleinbildkameras. Doch auch ich hatte ja ein paar Beweisbilder. Die entwickelte ich dann ganz fix (war immerhin bei FotoFix) und überlegte, was ich damit machen würde. Wenn man ein Bild an die wirklich ganz große Glocke hängen will, wo geht man da hin? Richtig, zur Bild-Zeitung, die heisst ja nicht umsonst so. Dort allerdings wurde ich rüde abgewiesen, beschimpft und als dilettantischer Fälscher bezeichnet. Wenn ich mal ein richtig spektakuläres Foto sehen wolle, dann sollte ich mir doch morgen das Blättchen kaufen und lernen, sagte man mir auf dem Weg nach draußen. Das war hart.
Nichtsdestotrotz kaufte ich mir am nächsten Morgen besagte Zeitung. Groß auf dem Titelblatt ein Jugendfoto des amtierenden Bundesumweltministers, vermeintlich ausgerüstet mit einem Schlagstock und einem Bolzenschneider. Naja, wenn das wichtiger ist als das Wohl der Berliner Denkmäler…
Auf der dritten Seite war übrigens etwas zu lesen über eine jüngst stattgefundene Ausstellungseröffnung im Erotik-Museum, auf der die Skulptur einer goldenen Gummipuppe für 80.000 Euro verkauft wurde.
PS. Wer glaubt, dass unter der Telekom-Werbeplane noch immer das Brandenburger Tor steckt, der täuscht sich gewaltig. Ihr wisst ja, ich war da. Aber dazu später mehr…
(2002)
[Aktuell – tages-Sau-durchs-Dorf-treiben-aktuell – ist dieser Text nicht mehr, ich begann ihn am Samstag. Überlegte hin und her. Und drücke jetzt eben doch auf „Publish“.]
Nächstes Jahr Letzte Woche in Jerusalem, da war ja ganz schön was los, als Martin Schulz, Präsident des EU-Parlaments, in der Knesset seine Rede hielt. Zufall oder nicht, auch Abseits der Aufregung um die Schulz-Rede geriet Israel in der letzten Woche (noch mehr als sonst) auf meinen Schirm (und das Fernweh packte mich wieder). Einiges von dem, was mir dabei über den Weg lief, lohnt sich durchaus, um das teilweise schiefe öffentliche Bild des Landes und seiner Bewohner gerade zu rücken. Also: Yalla Balagan! (Ein arabisches und ein russisches polnisches jiddisches persisches Wort ergeben eine Hebräische Redewendung, die so viel heisst wie „Auf ins Chaos“ – das ist Israel in a nutshell.)
Es fing damit an, dass ich Anfang der Woche die WRINT-Israel-Folgen nachhörte (inzwischen selbst die alte Folge #44 ). Holger Klein, das fiel mir vorher schon auf, stellt Israel in seinem Verhältnis zur Bundesrepublik ja gern auf die gleiche Stufe wie Bayern. Und nun hatte er also jemanden ans Telefon bekommen, der ihm ein bisschen was über Land und Leute erzählen wollte. Da dieses Interview einige Fragen offen liess und einigen Widerspruch hervorrief (das ging mir ähnlich) – führte er einfach danach noch eins. In Kombination kann man beide Gespräche zusammen ganz gut als Einstieg gebrauchen.
Aus der Distanz (und das muss gar nicht immer nur eine räumliche sein) lässt sich recht einfach ein Urteil fällen. Doch Israel ist uns näher und vertrauter, als wir glauben (und als einigen lieb sein mag). Ich mag Tel Aviv unter anderem so sehr, weil es – wie in den Interviews auch beschrieben – ein Berlin mit Strand und mildem Winter (also, ja, dieser Winter…schon klar…) ist. Doch die Parallelen gehen viel weiter und tiefer. Der Levinsky Park liegt zum Beispiel direkt neben dem Oranienplatz. Hier wie da versammeln sich die, die es teils unter schwersten Entbehrungen in den Westen, die freie Welt, das gelobte Land geschafft haben. Hier wie da sind sie, was die Mehrheitsmeinung bzw. die herrschende Meinung betrifft, nicht wirklich willkommen, im Idealfall werden sie geduldet und ignoriert. Allerdings schlägt der Mob gerne mal zu bzw. zündelt, wenn er gelassen wird. Ist in Tel Aviv passiert, hätte aber auch hier passieren können, wieder. Der junge Hamburger (?) Künstler Michael Felix Kijac hat ein interessantes Projekt zur „Dark Side of Tel Aviv“ ins Leben gerufen, auf dessen Seiten es auch weitere Informationen und Facetten zum Thema gibt.
Die nächste Parallele lässt sich – mal wieder – im Bereich Gentrifizierung ziehen. Hier liegen Kreuzkölln, Williamsburg und Neve Tzedek (was übrigens, eine weitere charakteristische (?) Gemeinsamkeit mit O-Platz und O-Strasse, nur ein paar Schritte vom alten Busbahnhof am Levinsky Park entfernt ist) ganz dicht beieinander. Die Mietquote ist in Deutschland ja traditionell hoch, was im internationalen Vergleich generell untypisch ist. Da macht Israel keine Ausnahme, und da es vergleichsweise wenige Wohnungen auf dem Mietmarkt gibt, steigen deren Preise, in den letzten paar Jahren rasant (die der Eigentumswohnungen natürlich ebenso). Junge Erwachsene, selbst aus der akademischen Elite, können sich so auch mit zwei oder drei Jobs keine eigenen vier Wände leisten. Was besonders absurd ist für ein Land, das der Familienpolitik existenzielle Bedeutung zugesteht.
Unter anderem dieses Dilemma führte 2011 zu den Protesten und Zeltlagern auf dem Rothschild-Boulevard. Die Resonanz war ungleich grösser als die der Occupy-Bewegung hierzulande, die Kinder der Mittelschicht, die das Land trägt – wirtschaftlich und durch die allgemeine Wehrpflicht auch militärisch, nicht zu vergessen – waren und sind aber auch (noch) stärker unter Druck als das deutsche Klein- und Mittelbürgertum. Ein weiterer Grund für die grössere Aufmerksamkeit, die der israelischen Protestbewegung zukam, lag sicherlich darin, dass sie mit Daphni Leef ein Gesicht hatte.
Im Endeffekt hat es aber nichts genützt, die Probleme sind noch da, die Zelte nicht mehr. Und Leef steht inzwischen vor Gericht. So verwundert es nicht, dass der Frankfurter Stadtsoziologe Sebastian Schipper im +972Mag-Interview auf einiges Interesse stiess, als er das Modell des Mietshäuser Syndikats vorstellte. Einstweilen wird es dabei bleiben, dass viele junge Israelis, nachdem sie ihr Leben für ihren Staat beim Wehrdienst riskieren mussten, diesem Staat den Rücken kehren: Wegen der Politik, wegen der Kriege, wegen der teuren Wohnungen und sonstigen Lebenshaltungskosten. Immer mehr kommen nach Berlin, push- und pull-Effekt wirken hier gleichzeitig. Die deutsche Presse feiert das natürlich, sieht nur die Attraktivität Berlins, ohne weitere Fragen zu stellen, größtenteils.
Und nun also die Aufregung um die Aufregung über die Rede des EU-Parlamentspräsidenten. Dazu will ich nur auf zwei Sachen verweisen, beide Male handelt es sich wieder um +972-Links, die Haaretz hat leider seit einiger Zeit eine Paywall. Also: In diesem Artikel ist recht pointiert beschrieben, auf welches Problem Schulz mit seiner Rede – Teilen seiner Rede, besser gesagt – stiess: The problem for the Israeli government and its supporters abroad is that reality in the West Bank is biased, so the political war is now aimed at calling things out for what they are. Bei all den unguten Gefühlen, die diese Situation heraufbeschwört, können sich die linken Israelis immerhin noch halbwegs gelungen über ihre rechten Counterparts lustig machen.
Eigentlich waren die folgenden Bilder nur für einen bestimmten Zweck (und eine bestimmte Person) gedacht. Dann dachte ich: Wenn ich sie sowieso schon hochgeladen habe, wieso dann nicht für alle? Also, es folgen ein paar Berlin-Bilder aus einer anderen Zeit, ich hatte sie hier schon mal erwähnt. Die Qualität mag bescheiden sein, sie wurden vor über zehn Jahren (nicht von mir) dilettantisch digitalisiert:
…wollte ich. Sollten sich doch andere weiter aufregen über den absurden Charaktermaskenball, der auf dem politischen Parkett ausgetanzt wird. Als dieser Entschluss noch nicht ganz so fest stand, beschäftigte ich mich intensiv, bis an die Grenze, wo einem der Verstand abhanden zu kommen droht, mit einem der vielen Geheimdienstskandale. In diesem Fall war es der mit dem NSU. Natürlich stolperte ich da auch ab und zu über Sebastian Edathy. Da mein Recherchemodus durch einen starken Hang zum Ausufern gekennzeichnet ist, stiess ich relativ schnell auf diese Sache mit der Journalistin. Aus ihrer Sicht – würde man die Vorgeschichte nicht kennen, könnte man sich Susanne Haerpfer bei manchen ihrer Blogbeiträge gut mit Aluhut vorstellen – hat ihre Causa Edathy zumindest indirekt ihre Existenz als gern nachgefragte Journalistin zerstört. Und schon hatte ich einen neuen Faden in der Hand, er führte zu einem verworrenen Knäuel, in dem sich die Schicksale diverser unbequemer Journalisten wiederfanden. Wäre ein lohnenswertes neues Thema, dachte ich, legen wir mal auf Halde.
Dieser Wiedervorlagestapel rief sich in Erinnerung, als irgendwann im letzten Jahr zum tausendundersten Mal über Journalisten und ihre Rolle in der Gesellschaft diskutiert wurde. Sie wären ja schliesslich die letzten Verteidiger der Demokratie, während die anderen drei Säulen kräftig bröckelten. Quatsch, natürlich. Der professionelle Journalismus ist genauso von der kapitalistischen Landnahme betroffen wie alle anderen Bereiche in Kultur oder Wissenschaft. Am Ende geht es um die Kohle – die, die der Journalist am Ende des Monats in der Tasche hat, und die, die der Verlag als Gewinn in der Bilanz verzeichnen kann. Doch das ist ein anderes, unendliches Thema. Eigentlich geht es darum, dass (auch jenseits der rein ökonomischen Verwertungslogik) der Berichterstattung Grenzen gesetzt sind, bzw. werden. Wer aus dem Rahmen fällt, muss sehen wo er bleibt. Zensur findet statt.
Thomas Moser zum Beispiel: Er war (und ist es immer noch, keine Sorge) eine der wenigen kritischen Stimmen zum NSU-Komplex, die wenigstens ganz leise, in der Nische der Kontext-Wochenzeitung, zu hören waren. Er recherchierte tief im Baden-Württembergischen Dickicht aus Verfassungsschützern und KKK, speziell der Kiesewetter-Mord hatte es ihm angetan. Neben Wolf Wetzel und Andreas Förster (und vielleicht noch Jens Eumann) ist er einer der selten zu findenden Journalisten gewesen, die Zweifel anmeldeten, die nicht sofort vom „Terror-Trio“ sprachen, die unbequeme Fragen stellten, die einfach das machten, was Journalisten machen sollten: Fakten checken, recherchieren, nicht einfach die Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft abtippen.
Und dann flog Herr Moser bei Kontext raus. Im Vorfeld wurde von der Zeitung bestätigt, dass es Versuche der Einflussnahme von offizieller Seite gegeben hätte. Aber dass dem freien Journalisten Moser jetzt die Texte nicht mehr abgenommen werden, hätte damit natürlich nichts zu tun. (Ich glaube übrigens auch, dass Moser sich in manchen Dingen verrannt hat, oder seine Agenda ist mir noch nicht ganz ersichtlich, trotz alledem sind seine „Verschwörungstheorien“ nicht weniger plausibel als die offiziellen der Bundesanwaltschaft.) Jetzt ist Moser nur noch Blogger (das hier ist wahrscheinlich seins), abgesehen von einem Artikel bei den „Blättern“ gab es von ihm nichts mehr in den „richtigen“ Medien.
Oder Gaby Weber. Die in Buenos Aires arbeitende Journalistin wird zwar – zum Glück – immer mal wieder von Fefe gepusht (unter anderem mit dieser tollen Alternativlos-Folge), ihre Rechercheergebnisse passen allerdings nicht ins öffentlich-rechtliche TV-Programm, sie wird als Verschwörungstheoretikerin diffamiert. Dass ihr Film über die Verstrickungen von Mercedes Benz mit der argentinischen Militärdiktatur, der bei labournet in Gänze zu sehen ist, beim WDR einfach weichgespült von Dritten nacherzählt wird, während er in mehreren südamerikanischen Sendern zur Prime Time zu sehen war und sogar im argentinischen Parlament gezeigt und behandelt wurde, hat natürlich auch nichts mit Zensur zu tun.
Nur exemplarisch sei hier auch noch auf das Beispiel Hubert Denk hingewiesen, da in diesem Fall ausnahmsweise von „der Presse“ berichtet wurde, welchen Zwängen freie Journalisten ausgesetzt sind: Auch Anwaltskosten können die Ausübung der Pressefreiheit einschränken. Da braucht es gar keine Horrorvorstellung vom tiefen Staat:
„Ein Verfassungsschutz, der mit Nazis, die die Demokratie gewaltsam beseitigen wollen und Menschen zu ermorden bereit sind, zusammen arbeitet und zugleich kritische Journalisten überwacht. Das ist die Horrorvorstellung, die offenbar deutsche Realität ist.“
Lohnen sich also die vereinzelten Aufschreie überhaupt noch? Was blieb zum Beispiel von diesem Memorandum? Was soll man dazu sagen, bzw. was darf man überhaupt noch fragen? Wenn Anne Roth, Partnerin von Andrej Holm und damit aktenkundig in Terrorismusnähe gerückt, unbequeme Fragen stellt, diesmal wieder zum NSU, und darauf diesen wohlmeinenden Kommentar bekommt:
Liebe Anne,
ich möchte Dich bitten, Dich nicht weiter mit diesem Thema zu befassen.
Der hier beschriebene Fall eines verbrannten Zeugen gehört zur Kategorie “bedauerlicher Unfall / plötzlicher Suizid”. Damit werden Probleme unbürokratisch aus der Welt geschafft. Das ist kein Kinderspielplatz. Jeder, der tiefer bohrt, gerät automatisch ins Visier.
Du solltest die Kreise der deutschen und insbesondere der US-Nachrichtendienste nicht stören. Denke an Deine Zukunft und die Deiner Familie. Du bist ohnehin schon ein “target of high interest”.
PS: Das hier ist ernstgemeint.
Bitterernst, keine Frage. Und es fügt sich alles so wunderbar ein in den Totalitarismus der Postdemokratie. Man kann es kaum treffender formulieren als – mal wieder, immer wieder – Georg Seeßlen:
Das Geheimnis der Verwandlung von Demokratie in Postdemokratie liegt darin, dass viele Menschen davon profitieren.
Die Verwandlung ist so weit fortgeschritten, dass jemand, der sich ihr entgegensetzt, bereits seine soziale Existenz riskieren muss.
Sein Fazit ist wenig aufmunternd:
An die Stelle der rebellischen Aufklärung ist eine ironische Abklärung getreten. Man arrangiert sich mit Verhältnissen, deren Schwächen man erkennt, und deren Widersprüche schon als Lebendigkeit missverstanden werden. Man sagt „gemach“, und grinst „Früher war alles besser“, und links und rechts lauern „Verschwörungstheorie“ und „Kulturpessimismus“. Welcher kritische Geist getraut sich noch die verbliebenen Plätze der freien Rede mit den Worten zu betreten: „Die Zeit drängt“. Wir leben nicht in der versprochenen besten aller Welten sondern in ihrem Gegenteil. Es haben sich Kräfte verschworen gegen die Freiheit, die Menschlichkeit und die Veränderung der Verhältnisse. Und es gibt Gründe, nicht sehr optimistisch die Kultur zu betrachten, die sich diese Kräfte noch leisten.
Wir müssen uns wohl, pathetisch gesprochen, die kritische Vernunft als eingekerkerte vorstellen. Wir müssen Briefe aus dem Gefängnis schreiben.
Und sonst so? Wo ich mich eh schon aufrege: Die Gentrifizierung geht natürlich ungehemmt weiter, mit handfesten Auseinandersetzungen unter und gegen die Zugezogenen. Die letzten drei Samstage, an denen ich wie fast immer in einer Kaschemme nahe des Görlis einkehrte, empfing mich an ebendiesem Bahnhof jeweils eine veritable Schlägerei. Es wird härter. Die Probleme bleiben, verstärken sich; betroffen sind wir alle. Und dazu kommen die üblichen Verrückten in dieser (immer noch tollen) Stadt. Trotzdem wäre es mal wieder an der Zeit – gerade bei dem Angebot – sich ausführlicher und tiefer mit dem Thema zu befassen. Aber erstmal ist genug aufgeregt, manchmal sollte man den Rat alter, weiser Männer annehmen:

(via http://wonko.soup.io)
PS. bzw. Update: Da ist man mal ein paar Stunden draussen, um das Mütchen zu kühlen und die Sonne zu grüssen etc., und schon verpasst man, dass auch andere, hier speziell fefe, sich heute schön in Rage geredet haben. Ich hegte ja schon immer den Verdacht, dass es reicht, ein paar Tage fefe zu lesen, und man verliert jeglichen Glauben. Es reichen die Posts von einem Tag, wie sich heute herausstellte.
Hätte ich heute morgen nicht so unter Zeitdruck & im Affekt geschrieben, wäre mir bei meiner Aufzählung Jens Weinreich bestimmt nicht durch die Lappen gegangen; sicher ein im mehrfachen Sinne unbequemer Geist, trotzdem hatte seine Kündigung beim DLF ein Geschmäckle. Oder die kürzlich veröffentlichte Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen, über die sich just heute (also heute veröffentlicht) Daniel mit Markus Beckedahl von dem linksextremistischen [(c) Focus] Blog netzpolitik.org unterhielt.
Jetzt ist hier aber erst mal Schluss mit Politik. Hoffentlich. Feierabend. Wochenende.
Nachdem hier wieder etwas Ruhe eingekehrt ist und ich erst mal weiter Gedanken & Links für die nächsten Texte sammeln muss, gibt es heute nur etwas aus der Mottenkiste alter Notizbücher. Der Kommentar von Johannes hat mich drauf gebracht: „da hattest du doch auch mal was zu geschrieben“ meinte ich, mich zu erinnern – und richtig (beim Stöbern stiess ich dann auch noch auf die Zugabe: Das muss auch mal wieder raus aus der Schublade und an die frische Luft, dachte ich mir, als ich es entdeckte):
05.08.03
Und früher
war sowieso alles besser.
Die Autobahnen.
Die Bahn.
Und früher
konnten die Leute noch lesen.
Romane.
Mein Kampf.
Und früher
gab`s noch kein Fernsehen.
Nur Riefenstahl im Kino.
Und Neger auf dem Jahrmarkt.
…Später
Im Jahr 2043
wird der Bundeskanzler,
so wie zwei Drittel seiner Altersgruppe,
(auf dem Schulterblatt, im Nacken, überm Arsch)
ein trendy Tribal Tatoo haben.
Und seine Frau zu Hause findet,
dass das Bauchnabelpiercing
spätestens nach dem dritten Kind
ausgeleiert aussieht.
13.05.04
falls sie dir mal wieder erzählen
dass du alles schaffen kannst
wenn du nur willst
und hart genug arbeitest
falls mal wieder jemand
vor deiner nase drei einfamilienhäuser
durch die gegend fährt
ohne sich zu schämen
falls sie denen, die nur glotzen können
mal wieder hämisch ihre villen
ferraris und yachten
unter die nase reiben
und ansonsten gesagt wird
dass prinzipiell jede arbeit
zumutbar ist
dann wird es zeit
dass du dir einen gewerbeschein holst
als selbstständiger amokläufer
oder sonstiger psychopath.
…habe ich vorhin entschieden, als ich die kalte Asche von Vorgestern runtergebracht habe. Barfuss! Da das aber wohl noch ein Weilchen dauert, trotz allem Optimismus, und weil der Kiezneurotiker mich mal wieder aus meiner dunklen Ecke zerren musste (huch!), revanchiere ich mich mit ein paar Links zum Vorfrühlingswochenende.
Mit dem Barfusslaufen muss man allerdings vorsichtig sein. Eine Anekdote am Rande, ich versuche mich kurz zu fassen: Die Premiere letztes Jahr fand am Rhein statt, Hundeauslauf. Ich liess die Schuhe im Auto, samt Socken. Was ich nicht bedachte war, dass wir Hochwasser hatten. Ja, eat this Berlin, da kannst du wirklich nicht mithalten, sorry. Aber bald hat Berlin ja die Ostsee, ich freu mich schon. Jedenfalls konnte ich nicht wie gedacht schön über den Ufersand laufen, sondern musste den Radweg auf dem Deich nehmen, den asphaltierten. Der schweineheiss war. Als Alternativen standen mir der schmale, verschotterte Randstreifen oder das gemähte, stoppelige Feld zur Auswahl. Das war nicht schön und endete nach der Hälfte der üblichen Strecke mit Brandblasen an den Fusssohlen. Aber alles längst nicht so schlimm wie das, was Alexander Kühne wegen seines unpassenden Schuhwerks passierte. Oje, Charité. Was läuft da eigentlich so alles falsch mit unserem Gesundheitssystem? Und warum zur Hölle brauchen wir dafür hunderte Krankenkassen mit hunderten Vorständen und Verwaltungen? Doch ich schweife ab.
WordPress erzählte mir grad vor ein paar Tagen, dass wir unser Fünfjähriges hätten. Das war mir gar nicht bewusst, dass das schon im letzten Jahrzehnt angefangen hatte. Bersarin feiert mit seinem Blog auch die halbe Dekade und schreibt einen entsprechend gebührenden Text dazu, Kotze über Klassikern inklusive. Mehr Bloggen für Minderheiten!
Wo wir grad bei Randgruppen sind: Zum Hip Hop hab ich ein gespaltenes Verhältnis, manches liebe ich, manches finde ich lächerlich und schlecht. Vielleicht später mal mehr dazu. Ein wenig lächerlich war auch die „Chabos wissen wer der Babo ist“ – Nummer des CSU-Kandidaten, hat wohl jeder mitbekommen inzwischen. Ich empfehle dieses Interview als Hintergrundlektüre. Und dieses Plakat als Beweis, dass es nicht nur bei der CSU Jugendsprache-Trittbrettfahrer gibt. Meine letzte musikalische Neuentdeckung auf dem Gebiet verdanke ich übrigens so einer Radioeins-Altmänner-Musikkritikerrunde, was ist bloss aus mir geworden. ..Vor allem, weil der Spiegel schon lange vorher über Zugezogen Maskulin und Grim104 berichtete. Egal, immerhin hab ich keine Ahnung mehr, was im Spiegel steht. Schon allein der Titel: “ Crystal Meth in Brandenburg“ – da braucht es keine weiteren Worte . Sind auch sonst noch ein paar Perlen von den beiden bei Youtube zu finden, wenn man’s mag.
Politik? Lieber nicht. Europa brennt, kaum wer interessiert sich, warum. Hauptsache, alle Formulare sind ausgefüllt und alles geht seinen amtlichen Gang. Dann schon eher was Versöhnliches zum Wochenende, ganz im Sinne des sentimentalen Hundes…
[Teil 1 hier; aller guten Dinge sind drei, das Finale lässt noch auf sich warten]
Midtro:
Für das Wahre, Schöne, Gute
will jeder gerne bluten
und fühlen,
was es zu fühlen gibt…
An dem Abend bei Charly in der Kneipe erfuhren wir auch, was es mit dem alten Mann auf sich hatte, der so gut wie jeden Morgen pünktlich um neun mit seinem Uralt-Kadett ankam und in dem kleinen Kabuff im Erdgeschoss verschwand. Er hatte dort mal einen Laden und wohnte bis nach dem Krieg auch in dem Haus. Er war locker über 80 und wurde mit der Zeit auch immer wackeliger auf den ohnehin schon durch Krücken verstärkten Beinen. Ab und zu kamen wir ins Gespräch und eines Tages brachte er diesen Riesenstapel Fotos und Postkarten mit – unser Kiez zwar, aber so kannten wir ihn nicht, dafür waren wir viel zu jung: Wasserwege, die längst zugeschüttet sind, Gasometer, die nicht mehr existieren und Kirchen, die zerbombt wurden. Irgendwann kam er dann allerdings nicht mehr so regelmässig, und dann gar nicht mehr.
Mit Kleingewerbe sah es auch sonst eher schlecht aus in unserem Block. Ein paar Häuser weiter gab es mal einen schlechten Pizza-Lieferservice, der schnell wieder zumachte. Einige Monate später eröffnete ein Videospielverleih in denselben Räumen, der sich erstaunlich lange hielt und von den ortsansässigen Jugendlichen begeistert frequentiert wurde, bis er einem Bäcker weichen musste. Dieser wiederum kam uns sehr entgegen: Wir konnten endlich mal ausprobieren, wie es aussehen würde, wenn der Hund wie im Klischee die Brötchentüte nach Hause trägt, es waren ja nur ein paar Meter. Dann wurde aber der Schwamm unter dem kompletten Häuserblock entdeckt, und eben auch im Gemäuer des Bäckerkellers, und das ging natürlich gar nicht. Dafür trat der Puff, der fünf Häuser weiter in der anderen Richtung lag und über den schon lange gemunkelt wurde, den offensiven Weg nach vorne an und hängte neben dem verstohlen blinkenden Herz im Fenster auch eine Leuchtreklame über die Tür. Die Geschäfte scheinen gut zu laufen, nur der Kronleuchterladen, den es auch noch gibt, hält sich genauso lange.
So zogen die Jahre auch in unserer immer weniger neuen Kreuzberger Heimat ins Land und neue und alte Nachbarn ein und aus. Nach den Polen war es unser direkter Nachbar, der nach Connewitz zog, was eine zeitlang sehr angesagt war unter Berlinern, die Flucht aus der grossen, hässlichen Stadt nach Sachsen. Kurz darauf verschwanden dann wie schon erwähnt die Dealer aus dem Dritten. Dafür kam ein sehr angenehmer Münchener dazu, der später mit seinem kleinen Bruder dort eine WG aufmachte. Madame und ich holten die Hundegrosseltern aus der O-Strasse ins Haus, später zog noch ein weiteres befreundetes Pärchen in die Wohnung der Musiker-WG.
Wir studierten mehr oder weniger vor uns hin, machten mehr oder weniger gute Nebenjobs und genossen so gut es ging unsere besten Jahre. Der Hund war viel zu schnell erwachsen geworden und irgendwann fanden wir sogar – nach ein paar handvoll Versuchen – für den mindestens jährlichen Dänemark-Hundeurlaub im stürmischen Februar den idealen Ort im Nirgendwo inmitten der Dünen. Natürlich hatten wir den Fiesta inzwischen standesgemäß durch einen schönen alten eckigen Volvo ersetzt. Schon allein wegen dem Hund, ohne den bräuchte man in Berlin sowieso kein Auto (und keine Urlaube in Dänemark). „Oh, die Dame hat extra Lippenstift für mich aufgelegt!“ spottete der Tierarzt süffisant, als wir ihn im ersten Kohleofenwinter besuchten, weil der Hund unbedingt die heisse, gusseiserne Ofentür beschnuppern musste.
Die Kreise, in denen wir uns bewegten, wurden immer kleiner, der Kiez und auch Berlin sind irgendwann durcherkundet, was eher daran liegt, dass man genügend angenehme Orte gefunden hat, als dass es nichts Neues mehr geben würde. Jedenfalls lagen die Koordinaten unseres gedanklichen Stadtplans inzwischen zum größten Teil in Kreuzberg, aber auch die althergebrachten in Mitte und Prenzlauer Berg wurden noch regelmässig besucht. Ansonsten kamen auf dem Berlin-Plan in unserem Kopf nur noch sporadisch neue dazu: Der Kickermeister aus dem Bandito machte eine neue Kneipe drei Strassenecken weiter auf. Zwei andere Leute zogen noch drei Ecken weiter ihr „Wie verprass ich mein Erbe“-Experiment noch eine Nummer grösser auf. Der Eimer hatte dafür längst zu. Grunewald – wegen dem Hund und dem jährlichen Kistenrennen der Potsepunks. Durch Madames Job natürlich alles, was irgendwie mit dem wunderbaren alten Kino in der Nähe vom Zoo zu tun hatte, und das war eine Menge: Premierenfeiern hier und da, obskure Festivals und Privatvorführungen diverser cineastischer Raritäten, nicht zu vergessen der hundertste Geburtstag des Chefs, der noch jeden Tag ins Büro kam, und zum Leidwesen seiner Angestellten auch regelmässig ans Telefon ging.
Stattdessen fuhren wir in der Weltgeschichte rum, sobald sich die Möglichkeit dazu bot: Kuba wie gesagt war die erste gemeinsame Reise, Dänemark jedes Jahr nach der Berlinale, mindestens. Der Band, in der Madame Schlagzeug spielte, ging die Gitarristin in Richtung Südafrika abhanden, was uns ein paar schöne Zeiten in diesem tollen Land bescherte. Der ehemalige Mitbewohner aus der O-Strasse hatte sich und seinen berechtigten Ärger gefangen und arbeitete inzwischen in Amsterdam, was uns als Stadt ebenso begeisterte wie Tel Aviv. Kurz gesagt: Es war eine tolle Zeit, aber es war klar, dass es nicht ewig so weitergehen konnte.
Doch bevor es sich richtig änderte, wurde es erst noch mal richtig besser: Madam steckte mitten im Examensstress, als ich mich entschied, vielleicht doch zurück an die Uni zu gehen und die letzten Scheine zu machen, die Umstände boten diesen Schritt geradezu an. Das Problem war allerdings, dass wir recht schnell bemerkten, dass ein gemeinsam genutztes Arbeitszimmer keinem von uns gut tat, und uns zusammen erst recht nicht. Eigentlich – trotz all der Jahre und all der Veränderungen – mochten wir dieses Haus und diese Wohnung immer noch sehr.
Sicher, viele Leute waren ein- und ausgezogen in der Zeit, und zugegeben: es hat sich nicht unbedingt zum Besseren gewandt. Irgendwann hörten die Hofpartys auf, irgendwann zogen neue Nachbarn ein, die selbst wir „die Jugendlichen“ nannten. Von den ursprünglichen Bewohnern – denen, die da waren als wir hier einzogen – waren nicht mehr viele übrig, und vor allem wenige, die zu richtigen Freunden geworden sind. Darüber hinaus, wenn man ehrlich ist: Nach zehn Berliner Wintern, einige davon mit sibirischen Ausmaßen, reicht es auch mal mit der Kohlenheizung. Wobei es gar nicht die Öfen oder das Heizen oder das Kohlen-aus-dem-Keller-schleppen war – das Nervigste war die Asche, die überall rumfliegt. Die Kombination aus der flauschigen und unglaublich dichten Husky-Unterwolle des rekordverdächtig haarenden Hundes und der feinen Asche killte ungefähr einen Staubsauger pro Jahr. Und ausserdem wurde in der letzten Zeit ständig die Strasse aufgerissen und mindestens zur Hälfte gesperrt, oder ein geplatztes Wasserrohr aus dem vorletzten Jahrhundert erledigte diesen Job, oder die BVG erneuerte die Hochbahnschienen. Irgendwas war immer.
Erstaunlicherweise gab es – wir sind irgendwo in der zweiten Hälfte der sogenannten 00er Jahre – selbst zu dieser Zeit Wohnungen, die unseren Vorstellungen von Grösse, Lage und Bezahlbarkeit entsprachen, sogar in der Nähe, denn den Kiez wollten wir nicht unbedingt verlassen. Allerdings schafften wir es nicht, auch nur einen einzigen Besichtigungstermin zu absolvieren, vielleicht hätten wir ansonsten damals schon die Vorläufer der inzwischen berühmt-berüchtigten Wohnungscastings hautnah erleben können.
Der Grund dafür war recht simpel: Wir blieben doch im Haus. Überraschenderweise zog die WG aus dem Musikerumfeld, die sich nebenan eingerichtet hatte, nachdem der Nachbar gen Sachsen aufbrach, in die ehemalige Drogenhölle. Der Münchner war dabei, der Frankfurter, der manchmal nachts auf dem Balkon Kontrabass spielte auch, insgesamt also alles nette Leute. So nett, dass sie uns fragten, ob wir nicht die Wohnung haben wollten – sie hatten von unseren Plänen gehört und sie nicht gerade goutiert. Nun hatte ihre Wohnung aber auch nur drei Zimmer und eine etwas größere Abstellkammer, ausserdem war der Grundriss eigentlich ziemlich ungünstig. Es war schlauchig, das Bad war auch nicht so dolle, bis auf die Wanne, die hätten wir schon ganz gerne wieder mal genossen. Von der Küche ganz zu schweigen, die war im Grunde nicht vorhanden. Okay – zwei Arbeitszimmer wären drin gewesen, aber dafür auf unsere inzwischen optimal eingelebte und viel besser geschnittenere Wohnung verzichten?
Andererseits: Mit dem Budget, das wir für eine neue Wohnung eingeplant hatten, konnten wir uns auch beide Wohnungen zusammen leisten, wir würden damit sogar entscheidend unter der vorher festgelegten Schmerzgrenze liegen. Nachdem uns diese Idee kam, mussten wir nicht mal eine Nacht drüber schlafen – konnten wir vor lauter Begeisterung auch gar nicht – um eine Entscheidung zu treffen. Kurzerhand stellte mich die WG bei der Hausverwaltung als Nachmieter vor und wir begannen, im Kopf schon mal die neuen Räume aufzuteilen: Zwei Bäder können nie schaden, wir waren längst in der Beziehungsphase, in der man das sofort einsieht. Aus dem grossen langen Balkonzimmer würde die Bibliothek werden, mit den Flügeltüren zu meinem neuen Arbeitszimmer. Dahinter dann das zweite Wohnzimmer mit Kicker, und ganz hinten das Gästezimmer. Und als Krönung zwei Balkone! So standen meine Graspflanzen Madames Tomaten nicht mehr im Weg. Am nächsten Morgen klopften wir die Wand ab, um eine geeignete Stelle für den Durchbruch zu finden.
Allerdings leisteten wir uns diesen Luxus keine drei Jahre. Immerhin gab es so noch zwei legendäre Partys, eine zum Einzug und eine, als wir die zweite Wohnung wieder aufgaben und den Durchbruch wieder zumachten. Madame war mit dem Studium fertig und fing an, sich einen Referendariatsplatz zu suchen, was aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in Berlin passieren würde. Und ich war mal wieder in einer veritablen Krise. Wie befürchtet ging es für sie ins tiefste Westdeutschland, während der Hund und ich zusahen, wie wir alleine in Kreuzberg und vor allem auch mit der Pendelei klarkamen. Es war keine Frage, dass der Hund erst einmal bei mir blieb, schon allein, weil ich viel mehr Zeit hatte, und die Ein-Zimmer-Einliegerwohnung irgendwo auf dem Acker kurz vor Holland wäre für die Hundedame auf Dauer auch nicht so toll gewesen. Obwohl ihr die frisch mit Mist und Gülle gedüngten Felder ausserordentlich gut gefielen.
So richteten der Hund und ich uns neu in Berlin ein, aber trotzdem wurde ich den Eindruck nicht los, dass etwas fehlte, dass etwas weg war, dass das Leben in der halben, ganzen Wohnung ab und zu mal einen Phantomschmerz-Stich verteilte, wie es nach einer Amputation nun mal oft so ist. Und das lag nicht nur daran, dass uns ein paar Zimmer abhanden gekommen waren. Wir schlugen die Zeit in Kneipen und den wenig übrig gebliebenen Hausprojekten tot, gingen stundenlang am Kanal und fast täglich im Grunewald spazieren, aber eigentlich warteten wir nur darauf, dass Madame uns besuchen kam. Da dies immer seltener passierte, liess ich den Hund immer öfter übers Wochenende bei den Hundegroßeltern, die inzwischen längst in den Wedding gezogen waren, und fuhr mit der Bahn gen Westen. Berlin war selten so uninteressant für mich wie in dieser Zeit, obwohl ich tun und lassen konnte, was ich wollte. Überhaupt etwas zu tun war aber in dieser Zeit das Schwierigste für mich, zum Glück war der Hund da, der seinen geregelten Tagesablauf einforderte, und ihren braunen Kindchenschema-Augen konnte ich selbst im dunkelsten Tal keinen Wunsch abschlagen. Als ich dann anlässlich irgendeines Jubiläums an die Uni geladen wurde, um von der guten alten Zeit zu erzählen, merkte ich, dass eine Veränderung jetzt vielleicht nicht das schlechteste wäre. Obwohl es mich natürlich freute, die ganzen anderen Veteranen mal wieder zu sehen.
Es wäre uns trotzdem nie in den Sinn gekommen, damals, die Berliner Wohnung aufzugeben. Aber sie hiess eben inzwischen auch nur noch „die Berliner Wohnung“. Nachdem Madame die Qualen des Referendariats hinter sich gelassen hatte und sogar übernommen wurde, machten wir uns wieder mal auf Wohnungssuche – oder besser gesagt: Mal wieder sie alleine, obwohl wir wenig später gemeinsam einziehen würden. Da Madame in Berlin Jahre auf eine Stelle hätte warten müssen, die dann auch noch viel miesere Konditionen gehabt hätte – dit is Balin – war klar, dass unsere Zukunft woanders stattfinden würde. Ich war zu dieser Zeit sowieso mal wieder viel flexibler als mir lieb war, und so suchten wir uns eine passende Grossstadt – das musste schon sein, das brauchten wir beide – in der Gegend aus, die Auswahl war hier zum Glück recht gross. Ausserdem konnten wir so aus Jux Briefköpfe mit zwei wichtig klingenden Adressen anlegen, genau wie diese ganzen wichtigtuerischen Jungliteraten der Jahrtausendwende, die wir halb verachteten und halb bewunderten.
In der Gitsch räumten wir zwei Zimmer komplett leer und packten alles, was übrig blieb, in das dritte, das ehemalige Schlafzimmer mit dem Podest, was nach hinten raus ging. Dazu holten wir noch ein paar Bohlen und Bretter von Holz-Possling und bauten ein Hochbett – ausreichend für ein paar (hoffentlich regelmässige) Stippvisiten in der alten Heimat, dachten wir. Ausserdem hatte ich noch einige Termine im nächsten Jahr in der Stadt zu absolvieren – aber unser neues, gemeinsames Zuhause war jetzt definitiv woanders. Es stimmte schon, tief im Westen, wo die Sonne schon lange nicht mehr verstaubt (und ausserdem um einiges später versinkt und es im Winter sehr viel milder ist), ist es viel besser, als man glaubt. Madame hatte grosse Freude daran, das Nest zu bauen: Es war alles perfekt aufeinander abgestimmt und kam ganz ohne Ikea aus. Selbst der Hund gewöhnte sich, trotz ihres Alters, erstaunlich gut an die vielen Treppen – dafür wartete oben ein schöner flauschiger Teppich, so was gab es in der Kreuzberger Studentenbude natürlich nicht.
Bei der machte sich wiederum der gute Schnitt bezahlt: Wir hatten zwei separate Zimmer, die wir untervermieten konnten, noch dazu mit guten Kachelöfen (in den meisten anderen Wohnungen im Haus waren die inzwischen mit preisgünstigen, blöden Allesbrennern ersetzt) und einer komplett eingerichteten Küche samt Geschirrspüler und Waschmaschine, natürlich ganz zu schweigen von dem trotz allem immer noch angenehmen Haus. Weil Madame in der Ferne den Neustart organisierte, übernahm ich die Hin- und Herfahrerei und das Casting. Dummerweise hatten wir die Entscheidung recht spontan getroffen und keiner unserer Berliner Bekannten hatte jemanden zur Hand, der gerade eine Wohnung suchte. Jedenfalls nicht so eine, wir waren schliesslich alle älter geworden und die Leute arbeiteten inzwischen zum Teil im Bundestag oder ähnliches. Da will man nicht mehr mit dem Ofen heizen, den hat man höchstens noch als nostalgische Reminiszenz in der Ecke stehen. Das ging uns ja nicht anders. Aber ich hatte ja keine Ahnung, auf was ich mich da eingelassen hatte.
Sicher, auch wir hatten inzwischen im Freundes- und Bekanntenkreis hier und da mal eine Geschichte mitbekommen, die von absurden Wohnungsbesichtigungen handelte. Wo der Geruch der zuvor Verstorbenen buchstäblich noch in der Luft lag, während sich dutzende Leute durch die Bude drängelten: So lange die Lage stimmte, konnte man sich so was scheinbar erlauben. Aber das waren doch irgendwie so Lagerfeuer-Schauergeschichten aus Mitte. Dachten wir. Schliesslich hatte Madame gerade erst eine mehr als passable Wohnung auf einem der teuersten Pflaster Westdeutschlands gefunden. Teuer, das muss man zugeben, in Berlin bekommst du dafür doppelt so viele Quadratmeter. Dachten wir.
Am Mittwoch setzte ich die Anzeige auf, ich sass mit dem Laptop auf dem Balkon, in der Ferne blinkte der Rheinturm in der Abendsonne und ich überlegte noch, ob es wirklich reicht, nur auf einem einzigen Portal zu inserieren, und vor allem, ob der Besichtigungstermin am Wochenende nicht zu knapp gewählt war. Die nächsten Tage verbrachte ich dann damit, stündlich mein Postfach zu leeren und unzählige Mails zu beantworten, die meisten davon auf Englisch, aber nicht wenige waren auch nur in Spanisch geschrieben. Am Samstag durfte ich an die 50 hellauf begeisterte Interessenten durch die Wohnung lotsen und jedes Mal den gleichen Text aufsagen, obwohl ich die Anzeige schon nach einem Tag wieder aus dem Netz genommen hatte.
Die Auswahl war also recht gross, und am Ende ist es dann doch die sprichwörtliche Schwäbin geworden, man mag es kaum glauben. Ihr Argument war – neben ihrer sympathischen Art an sich – allerdings auch schlagend, bei uns jedenfalls: Sie suchte schon seit Monaten, allein der Hund, dieser wirklich freche (sprich nicht erzogene) Australian Shepherd, den sie im Schlepptau hatte, machte es ihr recht schwer. Da wollten wir nicht im Weg stehen, Madame hatte ja auch einige Schwierigkeiten gehabt, unsere alte Hundedame in der neuen Heimat mit ins Boot zu holen. Die Sache wurde mit einem formellen Untermietvertrag offiziell gemacht, alle waren überglücklich und am Montag war ich wieder zurück am Rhein.
Das nächste halbe Jahr verbrachten wir damit, uns einzuleben und die neue Stadt – ach was sag ich – die neue Welt kennen zu lernen. Ein Ballungsraum ballte sich an den nächsten, von Ort zu Ort veränderte sich der Menschenschlag und die Grenzen der Nationalstaaten, die hier teilweise mitten durch die Dörfer verliefen, nahm man wirklich nur beiläufig wahr. Wir begannen, uns wohl zu fühlen und einzufügen. Gut, Karneval ging für uns Norddeutsche gar nicht, und das war ein grosses Hindernis bei der Assimilation. Aber ansonsten klappte es meistens ganz gut.
Doch ab und zu gab es einen empfindlichen Stich, vor allem, da ich in den ersten Monaten noch wirklich oft nach Berlin fuhr, zumal mittlerweile die komplette Familie hier wohnte, über die ganze Stadt verstreut. Was für eine Ironie: Endlich waren wieder mal alle zusammen, da ziehe ich so weit weg, wie es in diesem Land nur geht. Richtig schmerzlich bewusst wurde uns die Entfremdung von der alten Heimat, als wir einmal mit Auto und Hund herkamen für eine paar freie Tage – Pfingsten – und uns zuerst noch wunderten, dass wir keinen Parkplatz fanden und die Zufahrtsstrassen gerade abgesperrt wurden. Ist ja wie zum Karneval der Kulturen, dachten wir. Und genau so war es dann auch, das hatten wir nur absolut nicht mehr auf dem Schirm, die Verknüpfung Pfingsten-Karneval der Kulturen existierte schon nicht mehr.
Nach nicht einmal sechs Monaten wurde unserer schwäbischen Untermieterin dann langsam bewusst, dass sie das Berliner Nachtleben, was sie in vollen Zügen auskostete, am Ende viel zu vieler Nächte meist im Trinkteufel, ihre Verantwortungen als Hundebesitzerin und ihren Hammeraltenpflegejob nicht unter einen Hut bekommen würde und leider wieder zurück ins beschaulich-ländliche Baden-Württemberg gehen müsste. Was wir komplett einsahen. Da war es uns – gerade nach den Erfahrungen des letzten Castings – auch egal, dass wir eigentlich eine Kündigungsfrist von drei Monaten und eine Mindestmietdauer von einem halben Jahr ausgemacht hatten. Also spielten wir das Spielchen einfach noch mal durch, die Schwäbin hatte auch drei Interessenten an der Hand und so wurden wieder dutzende Leute durch die Wohnung bugsiert. Madame deutete an – es war ja ihre Wohnung, immer noch – dass sie im Hinblick auf die Auswahl der neuen Untermieter hoffte, dass wir uns jetzt nicht alle halbe Jahre einen Kopf um die Kreuzberger Wohnung machen müssten. Denn um ehrlich zu sein, wenn wir wieder nach Berlin zurück gehen würden, was immer noch vage im Raum stand, dann bei aller Liebe wohl nicht zurück in diese Wohnung. Sagte sie.
Von den beiden Münchenern wohnte keiner mehr wirklich im Haus, aber sie hatten es so gemacht wie wir und noch ein Zimmer in der Hinterhand behalten. Der Frankfurter wohnte inzwischen im Vierten zusammen mit einer Kanadierin und erzählte davon, dass er nach Uruguay auswandern wollte. Wir hatten eine neue Nachbarin, die wir nicht kannten und die tagelang scheinbar selbst ihre Wände verputzte, so hörte es sich an. Der Bauarbeiter wohnte immer noch über uns und lebte inzwischen ein befreites, offen schwules Leben samt Rockerkumpels. In der Wohnung der Hundegrosseltern wohnte die nächste Musiker-WG, allerdings aus einer Generation, für die Nirvana das ist, was für uns Janis Joplin und Bob Marley waren: Hätte man gerne noch selbst erlebt. Dafür kehrten die mittlerweile halbwegs berühmt-erfolgreichen Musiker aus dem vierten ab und zu wieder zurück, oder wenigstens ein paar angenehme, altbekannte Gesichter aus ihrem Umfeld. Die hatten die Wohnung also auch noch gehalten. Die Neuigkeiten aus dem Hinterhaus waren gemischt: Einiges blieb ganz beim Alten, der Juraprof mit dem alten Benz war leider gestorben und die Antifa war mit dem Studieren fertig und schwanger. Das war der Stand der Dinge, als ich mich nach einem neuen Untermieter umsah.
Auch Berlin hatte sich verändert. Das lag nicht nur daran, dass ich jetzt quasi von aussen kam und mir der Dreck und die Hundescheisse wirklich auffielen. Denn auf der anderen Seite sah es so aus, dass die halbmeterdicken Plakatschichten in den Hauseingängen in der O-Strasse inzwischen noblen Granitschildern gewichen sind, auf denen „Plakate ankleben verboten“ eingemeisselt war. Bei uns in der Strasse hatte neben dem Puff eine recht populäre und stark frequentierte Ferienwohnung aufgemacht. Und das, was da auf der Admiralsbrücke und im Görli, in den ganzen kleinen Seitenstrassen jenseits des Kanals passierte, damit hatten wir nichts mehr zu tun. Vor Jahren kannten wir die Leute hier noch und feierten zusammen mit dem Musikschrauber-Haschplattenverkäufer-Nachbarn die Eröffnung seines T-Shirt-Ladens (seine neue Berufung!), den er sich mit einem buddhistischen Kumpel teilte, der dort Räucherstäbchen, Bambuskerzen und Batikklamotten vertickte. Ihre Ladeneröffnung hatten sie günstig auf das Graefestrassenfest gelegt, so fanden sie vom ersten Tag an eine treue Kundschaft. Der Laden ist dann später in den Osten gezogen, irgendwo am Eingang vom Mauerpark lief er noch eine ganze Weile ganz gut.
Wir machten uns einen Spass daraus, die Gegend neu zu erkunden, so als ob wir auch Touristen wären, vom Kanal über die kanadische Pizzeria in der keiner Deutsch spricht bis hoch zum frisch eröffneten Tempelhofer Feld. Hätte ich noch ernsthaft studiert, wäre das eine lohnende Feldstudie wert gewesen. Dazu kamen im Stadtbild merklich mehr offensichtlich arme Menschen, übrigens selbst an den noblen Ufern des Rheins in unserer neuen Heimat. Flaschensammler. In Berlin konzentrierte sich das alles wie unter einem Brennglas. Auch wenn einige althergebrachte Ecken nicht mehr existierten: Die Abkürzung entlang der S-Bahn-Bögen, die Madame vom Zoo zu ihrem Kino immer nahm und die von den ansässigen Junkies zur Verrichtung aller möglichen Geschäfte genutzt wurde, die gab es längst nicht mehr. Dafür hatten wir jetzt ein Flüchtlingscamp vorm Brandenburger Tor und eins auf dem O-Platz.
Ich lass einfach mal übers Wochenende nur ein Bild hier, da ich die nächsten Tage woanders als im Internet sein werde. Leider aber auch nicht da, wo das Foto aufgenommen wurde. Das war in der durchgentrifiziertesten Gegend Tel Avivs, zugleich dessen Keimzelle, sozusagen. Ein Musterbeispiel, wie aus Urban Decay in wenigen Jahren Immobiliengold geworden ist. Aber der älteste Kiosk des Kiezes, an dem dieses Piece zu finden ist, steht halt immer noch, und zwar mit den Spuren der Geschichte, im Gegensatz zum schick renovierten, angeblich ältesten Kiosk der Stadt am Rothschild Boulevard. So, jetzt hab ich schon wieder mehr geschrieben, als ich wollte. Deswegen noch schnell der Kiosk in Gänze und dann ist Schluss.
Thomas de Maiziere hat gesagt, wir sollen nicht soviel ins Internet stellen. Ha! (In memoriam Mrs. K) Sowieso ein entlarvendes Interview: „Es ist eine staatliche Aufgabe, Angriffe auf das Internet – von wem auch immer – besser zu schützen als bisher.“
Als ich im letzten Sommer wieder zurück nach Berlin kam, entdeckte ich das erste mal die Gegend um den Chamissoplatz. Dieser liegt von mir aus gesehen jenseits der Bergmannstrasse und gehörte daher nicht mehr wirklich zu „meinem“ Kiez, der ist in dieser Richtung eigentlich bei der Marheinekehalle zu Ende. Klar fahr ich auch mal zum Tempelhofer Feld oder zum Kreuzberg – aber die kleinen Nebenstrassen auf dem Weg dorthin hab ich meist links (bzw. rechts) liegen gelassen. Ich konnte mich nur daran erinnern, dass es dort damals schon relativ schick aussah, Ökobürgertum, welches man eben auch in der Markthalle oder der Bergmannstrasse traf. Mein ehemaliger Chef zog von Schöneberg hier her.
Nun lud mich also ein alter Freund ein, ihn bei einem Konzert im Wasserturm zu besuchen. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich fragte „Wieso spielt ihr denn im Prenzlauer Berg?“ – Ich wusste wirklich nichts von einem Wasserturm in Kreuzberg. Mir wurde erklärt, dass es sich um ein Jugendzentrum handelt, und jener alte Freund hatte dort vor langer Zeit, in seiner Jugend eben, die ersten musikalischen Gehversuche unternommen. Die Veranstaltung jetzt wäre so eine Art Klassentreffen, viele von denen, die hier vor Jahrzehnten begannen, würden sich treffen und Konzerte geben. Grund genug für mich, mir das mal näher anzuschauen.
Da ich zu früh war, drehte ich ein paar Extrarunden, auch um etwas Essbares vor dem erwartbaren Alkoholkonsum in petto bzw. in ventro zu haben. So kam ich auch zweimal an folgendem Haus vorbei, und da das Motiv so verlockend und die Zeit noch da war, versuchte ich mit meinem altertümlichen Mobiltelefon ein paar Fotos zu machen:
Man beachte die Korrespondenz zwischen den aufgemalten Sprüchen und dem aufgehängtem Banner. Im Hauseingang gab es dann noch ein paar weiterführende Informationen:
Bisher hab ich den Astronauten nicht getroffen, sonst hätte ich ihn gefragt. Die Konzerte waren dann insgesamt so lala, was auch an der Akustik des mit Kreuzrippengewölbe versehenen Saales lag. Dafür waren die Gespräche drumherum umso besser: Einer der Sänger erzählte mir von seiner Schauspielerkarriere und seinen Drehs mit Bruno S. und Rummelsnuff. Mit letzterem konnte ich nun gar nichts anfangen, wer bitte? Er beschrieb ihn mir ausführlich: aus dem Osten, eher so Elektro-Volksmusik, Bodybuilder. Ich meinte, dass das sehr nach Stumpens kleinem Bruder klingt. Mit Knorkator konnte der Sänger nun wieder nichts anfangen, was mich etwas ungläubig zurückliess. (In der Zwischenzeit haben sowohl Rummelsnuff als auch die meiste Band der Welt neue Werke auf den Markt geworfen und sind mir daher öfter im Radio über den Weg gelaufen.)
Ein paar Wochen später war ich auf einer Party ein Stockwerk über mir. Dort fiel mir ein Typ auf, der wiederum der kleine Bruder von Rummelsnuff hätte sein können. War er aber nicht. Dafür hatte er eine Kutte an, auf der ein großer „Sons of Kreuzberg“-Aufnäher pappte. Das fand ich lustig, da in der Stammkneipe meiner zwischenzeitlichen Heimat ebenfalls das „Sons of Anarchy“-Logo -abgewandelt mit Fussball-Lokalkolorit – getragen wurde. Bei der Kreuzberger Variante ging es allerdings nicht nur um ein lustiges Bekleidungsstück, sondern um einen Film. Was er und meine (nunmehr ehemaligen) Nachbarn, die die Musik zum Film machen wollen, da so erzählten, klang recht spannend. Das Crowdfunding scheint aber erst mal nicht geklappt zu haben, schade.
In der Weihnachtszeit, als noch kein Winter war, stand ich dann mit offenem Mund staunend auf dem U-Bahnhof vor folgendem Plakat. Das Foto ist deutlich verwackelt, dewegen in der Vorschau nur klein und mit Transkription drunter:
Der Berliner Theaterclub präsentiert Axel Zwingenberger. Und wie! „Die heißeste Musik, die für das Klavier je erfunden (!) wurde.“ Daniel Düsentrieb lässt grüssen. Und weiter: „Rollende Bässe, die Dynamik eines fauchendes Eisenbahnzuges [sind die dynamischer als die stillen, oder die brüllenden, oder die schnurrenden?], Sehnsuchtsvolle Bluesklänge, die ferne Erinnerungen heraufbeschwören. Das Publikum ist in den Bann gezogen, ein faszinierender, brillanter Abend mit Witz und Perfektion!“
Diese um kein Adjektiv verlegene PR-Sprache und das Plakat an sich liessen in mir – es war schliesslich auch noch Weihnachten – ein wohliges „dit is Balin“-Gefühl aufkommen, ich weiss auch nicht genau, warum. Es hätte mich aber nicht gewundert, wenn auf einmal Uli Zelle und Harald Juhnke Arm in Arm die Treppe rauf gekommen wären.
Das neue Berlin, und zwar der gute Part davon, begegnete mir, als ich vor Kurzem auf der Suche nach einem neuen Vorderrad (das alte wurde mir – wer hätte sowas vermutet – auf dem Tommihaushinterhof geklaut) durch die Dresdener Strasse lief. Dort befindet sich nämlich eine Station des „Witchhunt“-Projekts von Various & Gould, und zwar schon seit letztem November, das war mir völlig durch die Lappen gegangen bis dahin:
Als kleine Entschädigung, dass mir dieses Street-Art-Projekt mehr als einen Monat verborgen blieb (kleine Erinnerung, auch an mich selbst, damit das nicht wieder vorkommt: Unbedingt noch zu den Graphic Days gehen!), ging ich just an dem Tag hier vorbei, an dem die Freilassung von Nadeschda Tolokonnikowa (ich muss bei dem Namen immer irgendwie an die Tokoloshes von Madam&Eve denken…total off topic, schon klar) bekannt gegeben wurde. Stimmt zum Glück nicht mehr ganz, dachte ich bei mir, als ich den letzten Satz der Infotafel unter dem Bild las:
Da mag ich eigentlich gar nichts weiter sagen, schon gar nicht zu Julia Engelmann. Muss ich aber. Pünktlich zwanzig Jahre nach seinem Auftauchen hierzulande macht der Begriff SlamPoetry also mal wieder eine größere Runde. Ich hatte ja schon am Rande darauf hingewiesen, dass dieses Thema mir eigentlich am Herzen liegt, aber es von Anfang an eine enttäuschte Liebe war, sozusagen. Ich hielt es da mit den Altrockern des SB, die natürlich auch nicht viel besser und ja überhaupt eigentlich Schuld dran waren. Wie Hadayatullah Hübsch vor zehn Jahren – auf dem ersten Slam-Poetry-Peak – schon sagte: „Früher gab es das Sechs-Tage-Rennen, da führten die Kerle ihre Frauen aus, tranken Bier und haben Bockwurst gegessen, und nebenbei sind ein paar Leute Rad gefahren, was kaum beachtet wurde. So ist Slam Poetry heute.“ Man kann es machen wie Nadia und Charlott von der Mädchenmannschaft, wie der Doktor oder wie Volker Strübing. Der hat nicht nur die beste Überschrift zum Thema, sondern auch das beste Resumee:
„Ich hoffe, die ganze Sache legt sich bald wieder. Und weder Julia noch der Poetry Slam an sich tragen irgendwelche Blessuren davon.
Eine Konsequenz der ganzen Sache wird sicher sein, dass man, wenn man sagt, man trete manchmal bei Slams auf, nicht mehr gefragt wird, was das sei („Irgenddwas mit Rap, oder?“). Stattdessen werden die Leute wissend nicken und sagen: „Ah ja, du machst sowas wie Julia Engelmann!“
PS: Herrje, ich hatte ja keinen blassen Schimmer (und Johnny Haeusler gefällt mir so gut wie lange nicht mehr). Nadia hat auch noch einen sehr guten Text nachgeschoben. Damit ist das Thema hoffentlich erledigt. Warum zur Abwechslung nicht mal in den nächsten Tagen eine schöne, klassische Rezension zu „Arbeit und Struktur“ lesen, oder etwas darüber, wie der Dings die Bums an den Haaren gezogen hat? Ich bin dann erst mal wieder weg…
Speicherkarte des Mobiltelefons aufgeräumt. Einiges wiederentdeckt, unter anderem dieses:
Sie machen Liebe oder Bloedsinn oder sie spielen Schach
13.07.10
Du kannst dich natuerlich aufregen
Ueber die ganzen Touris, Studenten und
Billigbiergeschaeftemacher.
Kannst von Gentrifizierung reden und
Deine Ruhe haben wollen,
Schliesslich ist das `ne Bruecke und kein Club,
und deine Kinder wollen schlafen.
Andererseits kannst du es auch geniessen,
Ein paar Meter weiter, zugegeben, vorm Urban:
Die laue Brise, die vielen Sprachen,
die Gerueche und die verschwindende Sonne.
Und dabei gedanklich den alten van Dannen-Schlager mitsummen:
Wenn im Urbanhafen
Die Schwaene schlafen….
Und ganz ehrlich:
Es gibt schlimmeres,
Zum Beispiel Macbookidioten
In Prenzlauerbergcafes.
[Ich hab den Text dann doch aufgeteilt…an Teil 2 wird noch gefeilt].
Intro: Und Berlin war wie New York…
Es war irgendwann im August 1997, kurz vor Ferragosto, als mich im heissen Süditalien die Nachricht erreichte: Berlin! Jetzt!
Der Zivildienst war gerade beendet, der Studienplatz an der Humboldt-Uni zugesagt und mit der damaligen Freundin, die nach dem Abi schon zwei Semester Kunst hinter sich hatte, fuhren wir nun endlich durch Italien: Die klassische nicht ganz so grosse Grand Tour deutscher Abiturienten, schon irgendwie. Dafür hatten wir so Sachen wie Ferragosto gelernt, ganze drei Tage in den Vatikanischen Museen verbracht und uns wie in Arkadien gefühlt. Es war toll und der kleine blaue Fiesta namens Ozzy hielt trotz mautvermeidenden Apenninenserpentinen tapfer durch. Und jetzt schien das mit der Wohnung im Prenzlauer Berg also auch geklappt zu haben! Wir hatten drei Tage, um von dem Fährableger statt nach Griechenland wieder zurück nach Hause zu fahren. Was ab jetzt Berlin hiess.
Vor dem Mauerfall war Berlin für mich – ausser Hauptstadt der DDR natürlich – ein Ausflugsziel, um mit der von dort stammenden Verwandtschaft in den Tierpark zu fahren, einzukaufen, noch entferntere Verwandte zu besuchen und die große, weite Welt zu bestaunen. Später, als wir mal wieder umzogen, diesmal richtig weit und nicht nur ins nächste Dorf oder unter der Woche ins Studentenwohnheim, wurde Berlin Durchfahrtsort auf der Strecke zum Familienstammsitz. Oft fuhren wir dran vorbei, aber wenn die Eltern gute Laune und Zeit hatten, ging es auf der langen Fahrt längs durch die Republik auch mal nachts quer durch die glitzernde, blinkende grosse Stadt. So viele Lichter auf einmal gab es sonst nirgendwo in der ganzen Republik zu sehen. Ich sprang vor lauter Begeisterung auf der Rückbank des alten Skoda hin und her. Noch eine Weile später, immer noch Kind, war Berlin für ein paar Sommer lang der Ort, von dem mich die Iljuschins in den grossen Ferien zu den Eltern brachten.
Da war es nur naheliegend, nicht nur geographisch, dass das erste Westgeld natürlich auch in Westberlin abgeholt und ausgegeben wurde: Doppelkassettenrekorder. Später dann soviel skurrile Klamotten, wie wir uns im Basement kaufen konnten: Kilopreise! Der Zufall wollte es, dass wir kurz darauf ein paar Berliner kennenlernten, wegen denen wir in den nächsten Jahren auch immer wieder so oft wir konnten zurück kamen. Sie waren gerade dabei, eine Band zu gründen, die ebenfalls Basement im Namen trug. Ausserdem schaffte es der grosse Bruder des besten Freundes, der uns all die verbotenen und spannenden Sachen, Substanzen und Gedanken nähergebracht hatte, nach Weissensee. So waren wir fast jedes Wochenende in der Oberstufe hier, und wenn nicht, dann in Hamburg, was ungefähr gleich weit weg, aber nicht ganz so aufregend war. Dafür aber norddeutsch, was uns wiederum vom Gemüt und der Sprache eher lag.
Trotzdem keine Frage, dass es für’s Studium die HU sein sollte – also Berlin. Was hatten wir inzwischen hier in den letzten Jahren schon alles erlebt, ausprobiert und kennengelernt! Die wilden 90er, manchmal sogar mit elektronischer Musik, da kam man kaum drum rum zu dieser Zeit. Und wie toll würde das erst werden, wenn man hier ganz und gar wohnte! Die Konzerte, die Partys, die illegalen Wochentagsbars irgendwo im Hinterhof, im Keller oder in einer leeren Wohnung. Das Bandito! Die Köpi! Der Eimer! Das Acud! Die Fehre! Der Schokoladen! Das Tacheles!
Wo wir lebten gab es dagegen – trotz Fachhochschule und laut DDR-Statistik festgestellten 77.000 Einwohnern – ganze zwei halbwegs passable Kneipen. Zum Tanzen fuhr man in die nächstgelegene Uni-Stadt (also Rostock oder Greifswald), weil: Man wollte ja keine Chartmusik hören, sondern mindestens Indie. Es wurde also höchste Zeit für die Metropole: Kindheit in Lausitzer Heidewäldern, Jugend an der Küste, und nun endlich Berlin – das war nur logisch.
Der grosse Bruder wohnte in der Senefelder, so wurde dieser Kiez unser Basislager. Grenze zu Mitte, Klo auf der halben Treppe, ein Zimmer mit Hochbett und Ofenheizung. Deshalb wollte ich auch unbedingt die Wohnung in der Christburger haben, wegen der wir die 2200 Kilometer von Brindisi in die alte Heimat und die 300 Kilometer von dort zurück nach Berlin gern in einer Drei-Tage-Monstertour abrissen: Mir war die Gegend sehr vertraut, ich fühlte mich hier schon heimisch, bevor ich es überhaupt war. Zwei Zimmer Altbau, Wannenbad, Gamat-Aussenwandheizkörper. Die Vormieter aus Moskau sagten, sie hätten eine Greencard gewonnen und wollten weiter gen Westen ziehen. Ich liess mich mit 1.500 Mark Abstand für ein paar Möbel und anderen Kram über den Tisch ziehen, aber es war immerhin die erste eigene Wohnung und dank der Zivi-Abfindung samt rund-um-die-Uhr-ISB-Zuschlag konnte ich das problemlos verschmerzen. Also machten wir uns ans Renovieren. Beim Stuckabpinseln und Malern wurden dann die Modalitäten für die zukünftige Fernbeziehung festgelegt: Sie wollte von Anfang an nicht in Berlin studieren – zu gross, zu viel los und nicht zuletzt kein passender Studiengang.
Dann der Semesterstart: Ausgestattet mit jahrelanger Berlin-Besucher-Erfahrung, einer wunderbar dilettantisch hergerichteten Erstsemesterwohnung im Prenzlauer Berg und unbändiger Vorfreude stürzte ich mich von den Einführungsveranstaltungen direkt in das Zentrum des Aufstands. Was mich bis heute versaut hat.
Schon bevor mit dem Streik alles Übel seinen Lauf nahm, fand sich recht schnell ein kleines Grüppchen zusammen, dank der verschiedenen Magisterteilstudiengänge bunt gemischt. Einige hatten Wohnungen oder WGs in Mitte, andere im Prenzlauer Berg, nur wenige in Kreuzberg, weil sie schon länger in Berlin wohnten. Selbst Avantgardisten aus Friedrichshain waren dabei, und es gab schon damals nur verschwindend wenige Urberliner. Anfangs waren die Freundeskreise noch in Bewegung – gerade auch durch die ganze Streik-Geschichte – aber bestimmte Kerne bildeten sich doch recht schnell und blieben sehr lange bestehen. Wir eroberten Berlin auf so vielfältige Art und Weise:
All das Wissen, was die Uni zu bieten hatte, selbst und gerade in den autonomen Seminaren des Streiksemesters. All die Kultur an jeder vergammelten Strassenenecke, an denen damals noch der alte Ostberliner Putz abbröckelte (Lesebühnen! Schlingensief!). Die Menschenmassen überall, mal als Beobachtungsobjekt, mal als ein Etwas, dem man selbst angehörte. Interessante neue Menschen und Begegnungen allerorten. Und auf einmal ist man mitten im Geschehen und meint – euphorisch wie man ist – einen Hauch von Anarchie und Revolution zu spüren, der sich hartnäckig an einem festsetzt. Tagsüber dem Politgeschäft nachgehen und nachts dann die Tour runter vom Prenzlauer Berg, über die Sredzki-, Ryke- und Kollwitzstrasse bis zur Zionskirchstrasse oder Senefelder Richtung Mitte, und in jedem dritten Hinterhof tat sich eine neue Welt auf. Zum Schluss landete man immer irgendwie beim Imbiss International.
Die Wohnung in der Christburger hielt nicht lange, aber immerhin länger als die Fernbeziehung. Die war im Frühling vorbei: Die Verlockungen waren zu gross, die Strecke zu weit und das neue Leben zu fordernd. Wie ich später herausfand, wurde auch schon im Herbst bei einer der ersten Vollversammlungen ein interessierter und folgenreicher Blick auf mich geworfen. Irgendwann im neuen Jahr, nach der verhängnisvollen Silvesternacht, in der ein Stuhl in der Heckklappe des Fiesta landete und dessen langsamen Untergang einläutete, kam dann die Nachricht von der WIP: Meine Wohnung wird – zusammen mit tausenden anderen – von der kommunalen Genossenschaft verkauft. Sanierung und so weiter wahrscheinlich, man sollte sich mal unterhalten. Nach gerade mal einem knappen halben Jahr Mietdauer.
Würde ich irgendeinen roten Heller auf Herkunft legen (was ich natürlich mache), dann hätte ich bestimmt längst Zigeunerblut zwischen den ganzen Kommunisten, Sorben, Juden und Franken in der Ahnentafel ausgemacht. Schon bevor ich die erste eigene Wohnung in Berlin bezog, bin ich gut ein Dutzend Mal umgezogen. Einerseits lag das an dem unsteten Lebenswandel der Mutter, doch auch die dörferfressenden Braunkohlebagger trugen dazu bei, genau wie die Sportkaderförderung der DDR, die ich kurzzeitig am eigenen Leib erfahren durfte, und der Auslandsaufenthalt der Eltern. Deshalb war der anstehende Umzug eigentlich kein Problem für mich. Über politische Theorien zum Thema Verdrängung machte ich mir damals noch keine grossen Gedanken, wenn dann nur am Rande und ohne das, was um mich rum passierte, konkret in diese Überlegungen einzubeziehen. Ich war jung, und Jugend braucht Veränderungen, auch räumliche. Ärgerlich war lediglich die Arbeit, die wir liebe- und mühevoll in Bad und Küche, Stuck, Dielen und Türen gesteckt hatten. Als Trostpflaster gab es immerhin 2.500 Mark, womit das nächste halbe Jahr Miete und Leben gesichert war.
Inzwischen – das nahm noch in der Christburger seinen Anfang – war ich mit besagter Blicke werfenden Frau zusammen gekommen, ohne viel eigenes Zutun. Sie, ein radfahrverrückter halbniederländischer Friese und ich bildeten die eingeschworene norddeutsche Aussenstelle, später kamen noch ein Schweriner und ein Bremer dazu.
Dieses Mal war ich auf Kuba – der erste grosse gemeinsame Urlaub – als uns die Nachricht erreichte, dass der Friese eine sehr schöne, sehr grosse, sehr preiswerte und etwas ungünstig geschnittene Wohnung in der O-(ranien)Strasse aufgetan hatte. Zwar direkt über einer Kneipe, aber was soll’s, wir waren Studenten, es gab ein paar interessante gewerblich genutzte Hinterhöfe samt ständig präsentem Haus-Hof-Meister mit Schnauzer und eben: Kreuzberg!
Madame wohnte damals noch in Moabit, Beusselkiez. Ihre Berliner Verwandtschaft, die irgendwo tief im Westen neben Grönemeyer residierte, hatte das organisiert. Zu dieser Zeit war diese Gegend ein grauer Fleck auf allen Stadtplänen, die man als frischer Student so im Kopf hatte – abgesehen von den Nazis der gleichnamigen Kameradschaft, von denen hatte man sehr wohl schon was gehört. Es war nicht ganz so billig wie im Prenzlauer Berg, dafür irgendwann in den 80ern saniert, halbwegs zentral zu allen drei Unis gelegen und mit vernünftiger Heizung.
Wenn ich mir (was ich oft tat) spätnachts von der Uni, aus der Christburger oder irgendeiner Kneipe in der Nachbarschaft auf wackeligen Rädern den Weg Richtung Westen bahnte und der Morgen irgendwo zwischen Tiergarten und kleinem Tiergarten zu dämmern begann, dann konnte ich mir, trunken und liebestrunken, nicht vorstellen, glücklicher zu sein. (Manchmal stieg ich vom Rad – manchmal fiel ich – und legte mich einfach auf den taunassen Rasen zwischen die vorsichtig aus ihren Löchern lugenden Kaninchen, blickte in den Himmel, war überrascht, dass die Siegessäule an einer ganz anderen Ecke im Blickfeld auftauchte als gedacht und genoss den Moment, die Gegenwart, das Leben und den ganzen Rest.) Bis sie mir die Tür öffnete.
Und nun also Kreuzberg. Der Weg nach Moabit war ähnlich weit, der zur Uni sogar kürzer und überhaupt: Es war fantastisch. Als ich in die Christburger einzog, ging in der gesamten Strasse nur das Haus direkt gegenüber als saniert durch. Als ich nach einigen Jahren dort wieder vorbei schaute, gab es noch ganze zwei unsanierte Häuser. In Kreuzberg dagegen schien die Zeit mehr oder weniger stillzustehen seit den 80ern. Sicher, es war viel passiert – und es würde noch viel mehr passieren! – aber als wir hier ankamen, schien es sich nur sehr, sehr langsam zu verändern. Ausgehen, falls man das denn so nennen kann, fand jedenfalls noch lange überwiegend eher in Mitte, Friedrichshain oder Prenzlauer Berg statt.
Allerdings hatte auch Madame langsam, aber sicher Gefallen an dem Bezirk gefunden; jenseits der Legenden und des stetigen Studentenzuflusses war es hier auch einfach sehr schön: Bunt, grün, zentral, Kanal. Und immer mehr Bekannte, die in der Gegend wohnten. Ein paar Häuser die O-Strasse rauf zum Beispiel zwei, die bald zu unseren engen Freunden zählen sollten, erstaunlicher- und erfreulicherweise beides geborene Westberliner und keine Studenten. Dafür aber in der Punk- und Skinkultur grossgeworden und dort noch tief verwurzelt. Wieder so viele neue Erfahrungen und Einblicke! Und ein Hund: Wie sich das für ordentliche Potse-Punks gehörte, hatten die beiden einen Hund. Besser gesagt eine Hündin, eine wunderbare. Und die sollte geplanterweise die Berliner Hundebevölkerung um weitere anarchistische Racker bereichern. Was ich wieder viel zu spät registrierte war, dass Madame auch hier schon längst was ins Auge gefasst hatte.
Lass uns doch einfach mal ganz unverbindlich die Welpen angucken gehen, meinte sie. Es bedurfte aber ehrlich gesagt auch keiner grossen Worte, mich davon zu überzeugen, diesem kleinen, braunen, erst ein paar Tage alten Fellknäuel zukünftig ein zu Hause zu bieten. Das sollte Madames neue Kreuzberger Wohnung werden: Knapp ein halbes Jahr nach unserer WG-Gründung, wieder war es Sommer, begab sie sich auf Wohnungssuche in 36 und 61, was damals noch gemütlich war, wenn man die heutigen Zustände betrachtet. Keine 15 Minuten entfernt fand gerade die letzte Loveparade des Jahrtausends statt und wir machten uns auf zur ersten Wohnungsbesichtigung, gleich um die Ecke lag der geographische Mittelpunkt Berlins. Zu dieser Zeit gingen wir noch davon aus, dass ich erst mal in der O-Strassen-WG bleiben würde, trotzdem suchten wir, gerade auch wegen der niedrigen Preise, grosszügig. So rutschte die eigentlich für eine Person zu grosse 3-Raum-Wohnung in die Auswahl: Vorderhaus, Ofenheizung, Balkon mit Blick auf die Hochbahn.
Die Vormieter, eine Kleinfamilie, wollten wegen des demnächst anstehenden Schulbeginns ihres Kindes dann doch in eine eher ruhigere Gegend ziehen. Sie hatten immerhin ordentlich selbst Hand angelegt: Küche und Bad sahen ganz passabel aus, erstere recht gross, letzteres in der üblichen Altbau-Schlauchform, aber zumindest gekachelt und mit vernünftiger Duschkabine. Die Öfen störten nicht weiter, kannten wir ja von vielen Bekannten – eigentlich waren wir damals eher die Aussenseiter: Studenten, die nicht mit Kohlen heizten. Dadurch, dass ich aber auch früher schon längere Zeit in der Wohnung des grossen Bruders in der Senefelder zubrachte, war ich mit Kohleöfenbefeuerung recht vertraut und versprach, dass ich ihr das gerne beibringen würde.
Als wir bei der Besichtigung dann schliesslich auf dem schönen grossen Balkon standen (von dem wir bei dieser Gelegenheit erfuhren, dass er eigentlich Loggia heisst), sahen wir direkt unter uns ein paar recht punkig daherkommende Nachbarn das Haus verlassen. Sie bekamen trotz des Strassenlärms mit, wie die Mitbewerber und wir uns über die Brüstung gebeugt laut unterhielten, und schauten zu uns nach oben, wobei sie freundlich grüssten, indem sie mit den Äxten winkten, die sie in den Händen hielten: „Willkommen, neue Nachbarn, wir gehen jetzt zur Loveparade!“ Das gefiel uns.
Nachdem die Besichtigung vorbei war, gingen wir Richtung U-Bahn, unten am Kanal lang. Sie sagte, sie müsse sich erst mal auf eine der Bänke setzen und durchatmen, zur Ruhe kommen. Sofort hätte sie sich in die Wohnung verknallt, sie müsste sie unbedingt haben. Das wunderte mich dann doch ein wenig: Sicher, wir waren in den gleichen Kreisen unterwegs, und sie war mir in manchen Belangen, nicht nur mit ihrer Bongsammlung, weit voraus. Trotzdem steckte ihre wohlbehütete westdeutsche Obere-Mittelschicht-Herkunft tief in ihr drin, wozu sie auch stand und was unsere Beziehung ab und an recht interessant machte. Deshalb überraschte es mich, dass ihr weder die über die letzten Jahre gesammelten und im Hausflur angeklebten Revolutionäre-Erste-Mai-Aufrufe noch die sonstigen, teilweise durchaus sehr ansprechenden Kunstwerke an den Hauswänden etwas ausmachten, ganz zu Schweigen von der Ofenheizung, der Sperrmüllsammlung im Hinterhof oder der aufgerissenen, notdürftig mit einer Hühnerleiterkonstruktion ersetzten Treppe im Vorderhaus. Das Haus hatte nämlich Schwamm, wie wir später erfuhren. Ach was, das Haus – der gesamte Block! Doch ganz im Gegenteil, es gefiel ihr sehr, gerade auch weil es von aussen daherkam wie eins der damals noch existierenden besetzten Häuser. Ich hatte noch viel über sie zu lernen, das begriff ich langsam.
Gut einen Monat später war es soweit. Madame hatte gegen die für damalige Verhältnisse riesige Anzahl von sieben Mitbewerbern den Zuschlag bekommen. Am Tag der Sonnenfinsternis war der Umzug, beides gute Anlässe für die Party danach. Auf den obligatorischen „Es könnte etwas lauter werden, ihr könnt gerne vorbei kommen“-Zettel hin fand sich – bis auf wenige Ausnahmen – die gesamte neue Nachbarschaft ein. Die nächste gute Überraschung, die das Haus barg, auch wenn sie uns zuerst ein wenig überforderte. Partys sollte es in den nächsten Jahren hier noch unzählige geben: Komplette Hauspartys, das jährliche Hoffest mit Livebands im Sommer, Silvester auf dem Dach, Grillpartys ebenda, und natürlich die obligatorischen Privatfeiern in den Wohnungen, geplante zu Geburtstagen oder ähnlichem wie auch spontane, weil plötzlich so viel Besuch auf einmal da war oder die ganzen guten Clubs und Kneipen schon geschlossen oder zu weit weg waren.
Wir fühlten uns alle drei sehr wohl in der neuen Wohnung: der rasant wachsende kleine Hund, Madame und auch ich. So war es kein Wunder, dass die gemeinsame WG mit dem Friesen für mich nach und nach nur noch die Funktion einer Abstellkammer hatte. Das war auf die eine Art unschön, da unsere gemeinsame Zeit wohl vorbei war. Andererseits hatten Madame und ich in der Gitsch gut zusammen gefunden und auch so viele neue Leute kennen zu lernen – da lagen alte Kontakte durchaus mal eine Weile brach.
Der Balkon wurde bepflanzt, die Wände gestrichen und die Zimmer eingerichtet. Wir waren begeistert von dem professionell gezimmerten Podest im Schlafzimmer und genervt von den kindersicheren Steckdosen. Als Überraschungsgeschenk zur Einweihung besorgte ich zusammen mit dem Schweriner nach durchzechter Nacht noch eine spezielle Hängematte: Er wohnte noch im Prenzlauer Berg und dort sprossen auf nahezu jedem freien Stück Land Kinderspielplätze aus dem Boden, die oft mit sehr grossen und stabilen Kletternetzen ausgestattet waren. Eins davon hing dann – nachdem ich lange die dicken Holzbalken in der Decke gesucht habe – mitten in unserem Kreuzberger Wohnzimmer. Als nächstes galt es, die Nachbarschaft zu erkunden, ehrlich gesagt konnten wir nach der Party kaum einen Namen oder ein Gesicht zuordnen, es war einfach ein zu grosses Gewusel.
Der Nachbar direkt nebenan war mit allerlei Technik ausgestattet: Zum Musikschrauben, wie er es nannte. Sein Hauptberuf bestand aber darin, Haschplatten mit dem Zug in die westdeutsche Provinz zu schaffen. Manchmal, wenn er zu faul war, schickte er sie auch einfach per Post. Dank dieser Tätigkeit konnte er sich auch das ganze Equipment leisten, ein Apple-Fanboy der ersten Stunde. Wir lernten uns näher kennen und schätzen, als ich kurz nach Madames Einzug in seinem Studio – die guten alten Zeiten – von den auf VHS-Bändern gesammelten Simpsons-Episoden alle Itchy-und-Scratchy-Parts rausschneiden wollte.
Bevor wir uns an die Arbeit machten, musste er erst einmal auf Betriebstemperatur kommen: Die Rechner wurden hochgefahren und die schlichte, doch trotzdem imposante Glasbong gestopft. Aus falschem Stolz heraus lehnte ich sie nicht ab und nahm auch einen tiefen Zug. Madame berichtete mir später, dass sie etwas überrascht war, mich mitten am Tag im Tiefschlaf auf der Couch zu finden, auf die ich mich wohl noch irgendwie hinüber gestohlen hatte. Die beiden lachten sich über mich kaputt, als der Nachbar nach ein paar Stunden mit dem fertigen Zusammenschnitt bei ihr an der Tür klingelte. Immerhin hatte ich jetzt eine vorzügliche Haschquelle.
Direkt über uns wohnte der einzig normal scheinende Typ, er war circa zehn bis fünfzehn Jahre älter als wir und arbeitete seinem Äußeren nach auf dem Bau. Man bekam ihn selten zu Gesicht, die Tagesrhythmen waren doch sehr verschieden. Die Wohnung neben ihm stand leer. Im dritten Stock lebte eine Architektin, die eine Gasetagenheizung und häufig sehr lauten Sex hatte. In der anderen Wohnung auf dieser Etage befand sich die Drogenhölle.
Ich war nicht oft dort, letztendlich aber doch zu oft. Von hier bezog der Nachbar seine Platten, und meine paar Krümel bekam ich wohl fast zum Einkaufspreis von ihm. Die aus dem Dritten wollten mit solchem Kleinkram nichts zu schaffen haben, ihre Dimensionen waren, schon alleine wegen ihres Kokskonsums, ganz andere. Ab und zu verirrte man sich dann aber doch mal in die Ticker-WG: Wenn es mal etwas Besonderes und Seltenes zu verkosten gab, wenn eine Party gegeben wurde oder wenn man dem Notarzt mit dem Ersatzschlüssel die Tür öffnen musste, weil man einen panischen Anruf von oben bekommen hatte („Ich kann meine Beine nicht mehr bewegen, da muss irgendein Scheiss drin gewesen sein…!“).
Meist waren es allerdings die Gäste, die Grauzone, die um diese Wohnung herumwaberte, die dringend ärztlicher oder psychologischer Hilfe bedurften. Mickey Mouse zum Beispiel. So stellte sie sich debil grinsend vor, als sie mal versehentlich bei uns, zwei Treppen zu tief, klingelte. Und so stand sie in der Tür, bis wir sie auf die Idee brachten, mal weiter zu suchen, wo sie hier doch falsch war. Ein paar Wochen später flog nachts um drei die komplette Kücheneinrichtung aus dem Fenster der Drogenhölle in den Innenhof. Erst der Inhalt des Kühlschranks, dann der Kühlschrank. Erst das Besteck, dann die Besteckschubladen und der klapprige Schrank. So ging das eine halbe Stunde: Wenn die zierliche, apathische Mickey Mouse Ärger mit ihrem Freund, einem der drei Höllenbewohner, hatte, wurde sie auf einmal sehr kräftig und agil.
Zusammen genommen waren das allesamt recht traurige und fahle Gestalten dort oben, sowohl die Kundschaft als auch die Bewohner. Trotzdem wuchsen sie uns mit der Zeit ans Herz, denn es waren eigentlich recht nette Zeitgenossen, keine Gangster-Dealer, eher welche von der Hippie-Fraktion. Deshalb war es auf eine Art auch schade, dass sie irgendwann ganz in ihre umgebauten alten Mercedesbusse und mit diesen dann gen Marokko zogen. Als sie ein paar Jahre später wieder auftauchten, zeigte ihre gesunde Gesichtsfarbe allerdings, dass das eine gute Entscheidung war.
Ganz oben, im Vierten, über der Drogenhölle, wohnten die – im Gegensatz zu unserem direkten Nachbarn – richtigen Musiker. Wie das in der Branche so üblich ist, gingen auch hier viele Leute ein und aus: Groupies, Freunde, Fans und Kollegen. Aus dieser Masse schälte sich dann ein Kern von vier, fünf Leuten, die, als die Drogenhölle frei wurde, auch in das Haus zogen. Die WG im Vierten bestand aber eigentlich nur aus zwei Typen: Das verpeilte Genie mit dem markanten Lachen und der Keyboard- und Synthiebastler. Wir kamen gut miteinander aus und hofften für die damals mehr oder weniger erfolglos, aber enthusiastisch aufspielenden Freaks, dass sie irgendwann den Erfolg haben würden, den sie dann Jahre später auch hatten. Mindestens. Neben ihnen wohnte eine weitere alleinstehende Frau, Künstlerin, die das halbe Jahr über in Goa oder auf Gomera oder sonst wo verbrachte. Sie war gut befreundet mit der Architektin aus dem Dritten, zu deren Schreiorgien sie auch gerne dazu stiess.
Abgesehen von uns im Vorderhaus gab es noch zwei Hinterhäuser – für uns hiessen sie Nummer eins und Nummer zwei, im Berliner Vermieterdeutsch aber wohl Quergebäude und Gartenhaus. Wie auch immer. Die allgemeine Pauschalisierung lautete: in Nummer eins wohnt die aktuelle Revolutionärsgeneration, in Nummer zwei die, die sich aufgrund der anstrengenden Kämpfe der 80er Jahre bereits in den Vorruhestand begeben hatte. Letztere bekam man auch seltener zu Gesicht – aus den Augen, aus dem Sinn – aber doch mindestens einmal im Jahr zum von ihnen ins Leben gerufenen und immer noch organisiertem Hoffest.
In Nummer eins hatte, wie bereits angedeutet, der örtliche Antifavorstand in einer heruntergekommenen WG mit unüberschaubarem Mitgliederbestand seine Zelte aufgeschlagen. Wenn man die Leute aus Nummer zwei sehen wollte, ging man zum alljährlichen Hoffest. Bei denen aus Nummer eins brauchte man nur die Pressekonferenzen nach den 1.Mai- oder sonstigen obligatorischen Kreuzberger Demos anschauen und schon sah man sie auf dem Podium, da half auch kein Dreieckstuch vorm Gesicht, selbst mit der Sonnenbrille und dem Basecap waren die Nachbarn gut zu erkennen. Vor allem, da sie das Haus auch fast immer derart gekleidet verliessen.
Unter den Antifas wohnte die Säuferin, und zum Erstaunen aller lebt sie (dort) noch immer. Auch in ihrer Wohnung gab es ein reges Kommen und Gehen, zwangsläufig wechselte man ein paar Worte, wenn man sich im Hof beim Müll- oder Asche-Runtertragen begegnete. So lernten wir also auch die lokale Alkoholiker-Gang kennen, die sich meist vorne am U-Bahn-Kiosk draussen auf den Bänken traf und dort ihrem Tagesgeschäft nachging. Sie soffen so lange es ging unter freiem Himmel und immer in einer großen Gruppe.
Irgendwann wurde offensichtlich, dass der Typ, der gleichzeitig in zwei Richtungen schaute, und das fast immer mit einem irren Blick, wohl mehr mit der Säuferin teilte als nur den Klaren. Dummerweise gehörte auch bei diesen Alkoholikern Gewalt zum Habitus, die Säuferin schwankte jetzt öfters mit einem blauen Auge durch den Hof. Wir schauten uns das eine Weile mit an, befragten sie in ihren seltenen lichten Momenten und als es einmal im Flur kräftig krachte – er schlug wohl erst sie, und dann vor lauter Wut die Glasscheibe der Hoftür aus dem Rahmen – sprinteten wir runter und machten ihm klar, dass er mit dieser Attitüde hier nichts mehr zu suchen hat.
Anschliessend nahmen wir sie erst mal mit nach oben, setzten einen Kaffee auf und unterhielten uns eine Weile mit ihr. Dabei stellte sich heraus, was sie uns mehrfach wortreich bestätigte: Ihr ist sowieso nicht mehr zu helfen. Sie war vor Jahren zum Kunstgeschichtsstudium nach Berlin gekommen und eben leider in falscher Gesellschaft gelandet. Bei ihr war es halt der Teufel Alkohol, von dem sie nicht loskam, ebenso wenig wie von den falschen Typen. Ihre Saufkumpane begaben sich auch gerne mal in die Wattewelt, die Schore einem so vorgaukelt. Therapien hatte sie einige erfolgreich abgebrochen. Nach zwei Stunden aufwärmen und Kaffeetrinken liess sie sich immerhin darauf ein, uns wirklich Bescheid zu geben, wenn es brenzlig werden würde. Erschüttert und irgendwie hilflos mit der Einsicht in die Ausweglosigkeit des Säuferdaseins liessen wir sie wieder gehen.
Last but not least gab es dann noch den sympathisch durchgeknallten Polen und seine Freundin, die in Nummer eins unter dem Dach wohnten: Er war einer von den Axtträgern, die uns schon bei der ersten Wohnungsbesichtigung positiv auffielen, und sie waren vom Äußeren her vielleicht Punks – die polnischen Punks waren damals in Berlin eine nicht zu unterschätzende Gruppe – aber musikalisch eher in der Elektroecke unterwegs. Das betrieben sie auch aktiv irgendwo im RAW-Tempel-Umfeld im Friedrichshain. In unserem Haus bauten sie sich irgendwann die ehemaligen Kugellager-Lagerräume aus und versuchten, mit einem Verein die Kids aus der Nachbarschaft von der Strasse und vor die Drumcomputer zu bekommen. Meistens war deren Terminkalender aber schon mit Drogen nehmen und verkaufen, Leute in der U-Bahn abziehen und im Familienunternehmen aushelfen ausgebucht.
Eines der denkwürdigsten Ereignisse in der Hausgeschichte hat aber unmittelbar mit der Wohnung der Polenpunks zu tun:
Eines Tages wachte er mal wieder nach einer langen Partynacht auf, vielleicht war sein Hund schuld – den hatte ich ja noch gar nicht erwähnt, ein sehr netter Schäferhundmischling namens Albert, soweit ich mich erinnere, der für unseren Nachwuchs gern mal den grossen Bruder spielte. Jedenfalls tropfte etwas auf seinen Arm. Nun war das Haus wie gesagt ziemlich runtergekommen und genau in der Ecke direkt unter dem Dach ergoss sich bei kräftigem Regen sowieso immer veritabler Wasserfall in den Innenhof. Es hätte also auch einfach Regenwasser sein können. War es aber nicht. Das merkte er spätestens, als die Stelle, auf die die Tropfen gefallen waren, sich rot verfärbte und heftig anfing zu jucken. Er rief sofort Hausverwaltung, Arzt und schliesslich auch die Feuerwehr an.
Als ich an diesem Tag nach Hause wollte, war an der Strassenecke erst mal Schluss. Ich muss mit der U7 gekommen sein, sonst wäre es mir schon vorher aufgefallen: die U1 fuhr nämlich schon längst nicht mehr. Erst als ich dem Polizisten hinter dem Flatterband meinen Ausweis zeigte und schon allein wegen dem Hund, der alleine in der Wohnung war, unbedingt darauf bestand, noch mal ins Haus zu gehen, sagte der nur kurz „Na gut, aber schnell“ und schien wirklich besorgt dabei. Ich durfte den Spruch noch an drei weiteren Sperren aufsagen, bevor ich schliesslich vor unserer Tür stand. Dort war mit Kreide ein weisses Kreuz draufgemalt, dazu noch das Wort „Hund“ mit Ausrufezeichen.
Ich packte den Hund und ein paar willkürlich für wichtig erachtete Unterlagen und ging in die Eckkneipe, die es damals noch gab. Vorher gab ich noch Madame bescheid, die auch arbeiten war und bei der es wie immer (Kino!) spät werden würde. Wie sich herausstellte, war die komplette Hausgemeinschaft erst mal für einen Schnaps auf den Schreck bei Charly gelandet, selbst der Bauarbeiter. Der erzählte uns an diesem Abend, der noch sehr lang werden sollte, einige interessante alte Geschichten aus dem Haus – er war hier in den 80ern eingezogen, es war seine erste Wohnung.
Zu dieser Zeit gab es gerade in dieser speziellen Ecke von Kreuzberg wohl ein paar komische Nazi-Gestalten. Und wie es der Zufall so wollte, legten die ihr Waffenlager auf unserem Dachboden an: Granaten, Schwarzpulver aus Weltkriegsmunition, Batteriesäure oder ähnliches, was dem polnischen Punk schliesslich auf die Arme tropfte.
Irgendwann durfte die U-Bahn dann wieder fahren, das Sprengstoffräumkommando machte seinen Job und kurz nach Mitternacht konnten wir endlich nach Hause. Die Wohnung der Polen wurde notdürftig saniert, die Hausverwaltung machte nie mehr als sie musste, aber sie nervte halt auch nicht: Das Glück einer seit Jahrzehnten zerstrittenen Erbengemeinschaft. Die beiden Polen suchten sich was im Friedrichshain und standen bei der alljährlichen Gemüseschlacht auf der Warschauer Brücke jetzt eben auf der anderen Seite. Die Friedrichshainer konnten die Verstärkung gut gebrauchen.
Weihnachten ist nun also auch endlich vorbei. Es war ganz okay, aber das Jahr war an sich halt ziemlich beschissen und ich wäre eigentlich lieber allein geblieben und hätte den ganzen Kram am liebsten vergessen.
Eine Sache hat mich dann aber doch wieder ein wenig fröhlich und versöhnlich gestimmt: Als ich an den Feiertagen aus der Mitte Berlins zum ausgefransten Ostrand fuhr, dahin, wo es nicht nur Dorf heisst, sondern auch so aussieht und man mitten auf der Strasse gehen muss, weil es keine Bürgersteige gibt und die Leute trotzdem der Meinung sind, dass sie in Berlin leben würden, ja – die sogar glauben, dass das dort sogar eher Berlin ist als dieser ganze Kreuzköllnscheiss, von dem man immer hört, womit sie wahrscheinlich sogar ein wenig recht haben; jedenfalls: ich habe in den letzten zwei Tagen während der Bahnfahrten also endlich „Tschick“ gelesen, wollte ich schon eine ganze Weile tun, die Liste ist aber lang. Und das hat mich sehr gut unterhalten und eben etwas fröhlich gestimmt. Es passte auch super zu der Strecke der Fahrt, und dem Publikum, welches so an den Weihnachtstagen zwischen Kotti und jottwede im Osten an der Tram 62 verkehrt, eine ganz andere Art Roadmovie. Einerseits.
Andererseits kam mir der Gedanke, dieses Buch doch endlich mal zu lesen, natürlich zuletzt anlässlich von Herrndorfs Tod in den Kopf. Zu dieser Zeit ging es mir auch grad nicht ganz so dolle, und ich fuhr ziemlich oft mit dem Rad am Hohenzollernkanal lang, Plötzensee, ist generell eine schöne Strecke, über den Friedhof, am Lehrter vorbei… Naja, als ich dann erstens hörte, dass er gestorben sei (so hiess es anfangs nur: gestorben, keine Erläuterungen) und zweitens Katrin Passigs Artikel oder Tweet oder was es auch immer war las, dachte ich „Kann ich sehr gut verstehen. Sehr gut.“ Aber auch: Verdammter Mist, es gibt so wenige von den Guten. Dabei hatte ich bis dahin nur sein Blog gelesen. Jetzt kann ich sagen, dass ich damit recht hatte. Jetzt geht es mir auch nicht mehr ganz so mies. Ganz ohne zu Grübeln kann ich den Weg immer noch nicht fahren.
Aber von vorne: Eigentlich gibt es nur einen Grund für dieses Blog hier. Wie gesagt, ich schrieb vorher woanders und hauptsächlich politisch, machte das dann aber zu. Ironie des Jahres: Damit könnte ich mich fast zum Trendsetter erklären. Stimmt aber nicht, lange vor mir machten der politblogger und andere zu, b like berlin sogar auf ewig, doch das ist eine andere Geschichte. Sollte man aber mal erwähnen, wenn jetzt nur wegen flatter und Mrs.Mop und und und die Klagelieder angestimmt werden. Kennt noch jemand Jacob Jung? [Ich schweife ab, ich weiss, aber das hat System, das bleibt auch so.]
Also: Ich machte das alte Blog eher aus persönlichen Gründen dicht, neben der generellen Resignation, was die Wirksamkeit und den Sinn aufrührerischer Politartikel betrifft. Mehrere Sachen begannen sich mehr oder weniger dramatisch zu ändern, da passte das gut ins Konzept, und mir war sowieso wieder mehr nach Literatur. [Als ob man das auseinander halten könnte] Wobei, das Lustige daran ist: Vor über zehn Jahren, als ich schon an der gleichen Stelle stand, beschäftigte ich mich sehr mit unter dem Label Social Beat werkelnden Textarbeitern. Auch eine ganz andere Geschichte, an die sich wohl kaum noch wer erinnert, was schade ist, da eigentlich hochaktuell. Dort verabschiedete sich Tom de Toys nach gut zwei Jahren mit einer Analyse, die durchaus auf die Bloggerei angewendet bzw. abgewandelt werden kann:
„Als die A.L.O. (AußerLiterarische Opposition) im Berliner Sommer `93 während des 1.SB(Social Beat)-Festivals ausgerufen wurde, dachte Deutschlands literarischer Underground an eine undogmatische Bewegung mit vielen Schreibstilen und Präsentationsweisen. Doch schon bald zeugten gegenseitige Distanzierungen von unkollegialen Arbeitsmechanismen, die dem etablierten Literaturbetrieb ähneln: Geld, Macht, Neid und Prestige spielten, seit die Medien sich interessierten, plötzlich eine größere Rolle als verbindende Gesellschaftswut und Glücksvisionen. Nach zahlreichen Zeitungsartikeln, TV-Berichten, Festivals und programmatischen Publikationen lässt sich die Szene nun grob in drei Lager sortieren: ein fast sektirerischer (sic!) Hard-core-Kern orientiert sich mit seiner sogenannten „Pimmelprosa“ an amerikanischen Beat-Autoren, eine dadasophisch angehauchte Clique schwört mit ihren Gedichten auf den aktionistischen Performance-Charakter von LITERATUR GEGEN LANGEWEILE und dazwischen treiben jene Schreiberlinge und Zeitschriftenmacher, denen das Marketing-Konzept wichtiger scheint als der Inhalt.“ Presse-Erklärung des Instituts für Ganz & Garnix. September/Oktober 1995
Ein anderer grosser Hype der Netzgemeinde ™, von dem man nicht mehr allzu viel hört, waren die Postprivatisten der Spackerei feat. Jens Best gegen den Rest der Welt aka Google street view. Die taugen heute lediglich noch als Witzeprojektionsflächen für Holgi Klein oder Malte Welding. Und genau damit sind wir zurück beim Thema: Wenn ich jetzt also wieder ein Blog starte und das schreibe, was ich wollte und was raus muss, was aber eben dummerweise auch persönlich ist – will ich das wirklich, weiss ich, in welche Untiefen ich mich da begebe, wo sollte die Schere im Kopf am Besten ansetzen [ganz zu schweigen von dem NSA-Skandal, aber das ist ja wieder Politik und von daher am Thema vorbei und abgesehen davon sowieso total absurd]?
Doch es hilft nichts, wie gesagt: Es gibt einen Grund für dieses Blog, und ausserdem muss der Name ja noch erklärt werden. Wie ich also zurück in die harte Berliner Wirklichkeit geschleudert wurde, und wie das natürlich auch was Politisches hat – Stichwort Gentrifizierung:
Das Wort, was Andrej Holm in die Schlagzeilen, unter Terrorismusverdacht und in Untesuchungshaft gebracht hat. Als das passierte, war ich gerade in einer längeren Pause, was die studentischen Aktivitäten anbetraf. Ich wusste um das Konzept und hatte durchaus ein, zwei Veranstaltungen bei Häußermann gehabt. Aber das war es dann auch fast, wäre da nicht Polleschs „Stadt als Beute“ gewesen, was mich ehrlich gesagt sowohl auf der Bühne als auch zwei, drei Jahre später auf der Leinwand begeisterte. Als ich wieder zurück ging an die Uni, kam Andrej Holm gerade aus dem Knast, ich packte ihn in meine Blogroll (wie konnte ich das hier nur vergessen-) und fing an, mich wieder mehr mit Recht auf Stadt und Urban Studies, wie es jetzt hiess, zu beschäftigen. Allerdings nicht an dem Institut von Holm, sondern bei den Ethnologen. Wenn man so will, war das Thema längst in der brutalen Popkultur–Realität angekommen. Und eben auch in meiner, jetzt ganz greifbar.
Da ich ja nun keine Politbloggerei mehr betreiben wollte, was bleibt mir dann übrig? Ich kann darauf hinweisen, dass andere das besser und wirksamer machen als ich es je könnte. Ich kann meine Berlin-Geschichte aufschreiben. Ich muss. Es gibt ganz viele andere, die schönsten davon bei tikerscherk (die natürlich auch längst in die Blogroll gehört und – ganz ehrlich – für mich neben Andreas Glumm die Entdeckung des Jahres ist und mir die dunkle Jahreszeit ähnlich aufhellte wie Tschick), aber selbst Don Alphonso hat letztens eine sehr gute erzählt.
Sowieso – an jeder Ecke stolpert man inzwischen über Berichte aus Berlin, und immer spielt das G-Wort eine Rolle. Besserverdiener, die verzweifelt um Rat bitten, wie sie nicht zu bösen Gentrifizierern werden. Was schwierig werden könnte, liest man sich aktuelle Berichte von Wohnungssuchenden aus ähnlichen Milieus durch. Und dann gibt es noch diese Expat-Exilantenszene hier, die sich auf Englisch darüber aufregen, wie furchtbar das alles ist mit den ganzen Touristen. Die drehen da sogar krude Filme drüber. Und in Hamburg sieht es nicht besser aus. Inzwischen gibt es sogar – kein Scheiss – eine Gentrifizierungsoper. Auch am schönen Kollwitzplatz kann Kunst gegen Gentrifizierung bestaunt werden.
Also: Es folgt eine Geschichte, die viel länger geworden ist, als ich dachte. Aber wegen ihr hab ich dieses Blog überhaupt aufgemacht – was also jetzt & im nächsten Jahr passiert, nachdem der Text nun (bald) hier steht, kann ich noch gar nicht sagen, ich bin aber gespannt. Irgendwie hatte ich jedenfalls das Gefühl, dass sie mal aufgeschrieben werden musste, manchmal ist das so:
„Mein Gehirn nahm ungeheuer Fahrt auf, und ich würde schätzungsweise fünfhundert Seiten brauchen, um aufzuschreiben, was mir in den nächsten fünf Minuten alles durch den Kopf ging. Es war wahrscheinlich auch nicht sehr spannend, es ist nur spannend, wenn man gerade drinsteckt in so einer Situation.“ Tschick
Lesen.
Lesen.
Lesen.
Und schreiben, ab und zu auch mal schreiben, viel zu wenig, natürlich. Aber wie denn auch, wenn da so viel zu lesen ist! Ich arbeitete in den letzten Tagen die übers Jahr gesammelten bookmarks ab, überrascht davon, wie viele es dann am Ende doch waren. Und es landeten ohne Übertreibung 20 neue Seiten im Feedreader, na toll. Aber eben: toll sind sie, die meisten dieser Seiten und Texte. Deswegen jetzt hier das grosse Ausmisten zum Jahresende. Die Blogroll bedurfte schon längst der Überarbeitung bzw. Ergänzung, ein paar klitzekleine Erläuterungen dazu gibt es im nächsten Beitrag (wenn alles klappt, kommen noch zwei Texte in diesem Jahr – und dann?)
Dazugekommen sind: Die schon längst überfällige tikerscherk, Andrej Holms Gentrification Blog, den ich einfach vergessen hatte in die Blogroll zu packen, ebenso übersehen beim Einrichten der Blogroll: Andreas Glumms Zweitpräsenz, der Nachtwächter mit seinen oft kurzen und doch so treffenden Gedanken, Amanda Palmer mit ihren meist eher langen Gedanken, die Sammlung von reportagen.fm und waahr samt Archiv – weil es einfach gute Texte sind. Genau wie die folgenden:
Der Sonntagabend-Tatort (auch wenn es ein Polizeiruf ist): ein Ritual aus längst vergangenen Zeiten, man tut es, auch wenn man vorher schon weiss, dass es eigentlich nichts bringt. Genauso wie das Wählen in der Postdemokratie.
Nun begehe ich dieses Ritual, zugegeben nicht ganz so regelmässig wie früher, meist still und ohne Klage, jedenfalls nicht hier, also in der Öffentlichkeit. Das tun Andere besser. Seit einiger Zeit gehört zu meinem persönlichen Ritual auch dazu, mindestens eine dieser Klagen, namentlich die Dell’sche Kritik beim Freitag, nachzulesen. Geschmackssache und polarisierend, aber gerade das ist das Interessante daran, und das putzige Abarbeiten seiner Kritiker an Text, Stil und Person, die ihm jede Woche auf`s Neue die gleichen Sachen vorwerfen.
Warum also nun eine Wortmeldung zu diesem Thema? Um es im Dell-Duktus zu formulieren: This time it`s something personal, denn vordergründig ging es um Wölfe in der Lausitz.
Da ich ja hier vorhatte, persönlicher zu werden, fang ich doch gleich mal damit an: Dieser Landstrich ist eine meiner Heimaten, um es mal so ausdrücken. Nicht nur geographisch, sondern auch und vor allem ideell. Und da der Heimatdichter dieser Gegend sein Hauptwerk nur ein Dorf weiter spielen liess (das Leben tat es, nicht er, so würde er es wohl sagen), war mir der „Tiger von Sabrodt“ natürlich ein Begriff:
Der alte Müller kommt aus dem Ursorbischen und ist von der anderen Kreisseite nach Bossdom zugezogen. Er kommt aus Sabrodt. Das strohgedeckte Müllerhaus und die Windmühle hat er gekauft. Den Dofnamen Sabrodt kennt im Kreise Grodk jedes Kind. Dort lebte einstmals ein Tiger, der Geflügel und Zickel riß und einmal sogar ein Fohlen aufgebrochen haben soll. Einige Leute hatten ihn huschen, aber niemals richtig gesehen. Man sah nur den Schaden, den er stiftete. Dem Tiger selbst begegnete man am häufigsten in Artikeln, die im Spremberger Anzeiger über ihn geschrieben wurden.
Man setzte eine Treibjagd an; es war schon ein kleiner Krieg. Gendarmen, Förster und Militär marschierten auf. Der alte Müller nahm als Treiber an diesem Krieg teil. Er hätte eigentlich eine Kriegsauszeichnung bekommen müssen, weil er zu denen gehörte, die den Tiger aufbrachten und vor die Flinten der Soldaten trieben.
Und als der Tiger endlich tot dalag, sah man, daß es ein Wolf war, ein aus Polen zugewanderter Wolf. In allen Zeitungen, bis nach Berlin hin, machte man sich über den Tiger von Sabrodt lustig. Wir im Kreise Grodk blieben ernst, stopften den falschen Tiger aus und stellten ihn ins Schloß-Museum. Dort sah ich ihn. Was aus ihm wurde, weiß ich nicht, vielleicht trugen ihn die Motten fort, vielleicht der letzte große Krieg, vielleicht steht er noch heute dort. Ich muß einmal hinfahren und nachsehen. (Der Laden, Bd. I, S.353)
Er steht immer noch dort, glaubt man Wikipedia. Und Sabrodt heisst wieder Sabrodt und nicht mehr „Wolfsfurt“, wie von den Nazis befohlen – im Gegensatz zu vielen dutzend anderen wendischen Orten, die ihre Nazi-Namen behielten.
Was war nun also mit dem Polizeiruf, „Wolfsland“ genannt und mit Fabian Hinrichs erwartungsvoll besetzt? Nicht viel, um ehrlich zu sein. Denn es ging eigentlich gar nicht um die Wölfe, sondern wie so oft, um die finstere Vergangenheit in Dunkeldeutschland:
Der Andi hat mit dreizehn die Fluchtpläne der Familie seines Banknachbarn Stefan verraten und ist deshalb trotz Viererschnitt auf die EOS gekommen. Deswegen hat ihn der Stefan dann Jahrzehnte später, wo er wegen seiner Wölfe zufällig vor Ort war, mit einem Ast erschlagen. Der Stefan tat übrigens so, als ob er damals gar nicht viel wusste von den Plänen seiner Eltern, im Gegensatz zu Andi. Dafür kann der Stefan jetzt eine ausgewachsene und erschossene Wolfsfehe kilometerweit durch den märkischen Heidesand tragen, und zwar über die Arme gelegt vor der Brust, um sie dann vorwurfsvoll vor dem Herrensitz der adligen Dame niederzuwerfen (Manch ein Besitzer mittelgroßer Hunde mag ob dieser Kraft ungläubig staunen). Diese ist natürlich aus dem Westen zurückgekommen und brachte alles wieder unter ihre Knute, so scheint es. Und sie hasst Wölfe. Nicht, weil die Tiere ihr Geschäft mit dem Jagdtourismus kaputt machen, sondern weil die Wölfe die Überreste ihres Bruders, der 14jährig im Volkssturm fiel, vertilgten. Die bösen Russen haben ihn, slawisch unzivilisiert wie sie waren, einfach liegengelassen, womöglich nur verletzt.
Da hat sich jemand eine ganz schöne Schauergeschichte ausgedacht. Ich weiss nicht, was ich unglaubwürdiger finden soll: Dass anno 45 Wölfe östlich der Oder die Schlachtfelder heimsuchten, wo doch schon der Tiger von Sabrodt so eine seltene Erscheinung war, dass die Leute eben eher mit einem aus Zoo oder Zirkus ausgebrochenen Tiger rechneten als mit einem wilden Wolf (vor dieser Episode war der letzte freilebende Wolf hundert Jahre zuvor erlegt worden, also um 1804) – oder dass ein 13jähriger mit Viererschnitt einen Platz an der EOS bekommt, weil er eine Republikflucht verhindert.
Sei es drum, es ist Fiktion und Krimi und Sonntagabendunterhaltung, schon klar. Doch es werden bestimmte Bilder, Klischees und Vorstellungen verstärkt bzw. geprägt durch die Institution Tatort. Nicht umsonst behandelt man hier immer wieder Themen wie die Auslandseinsätze der Bundeswehr oder Geheimdienstmauscheleien – und manchmal gelingt das sogar früher und besser als in der „seriösen“ Tages- und Wochenpresse. Doch schon allein, dass der „Polizeiruf 110“ innerhalb des Sonntagabendkrimis (der eigentlich „letzter freier Abend vor dem nächsten ordentlichen Werktag-Krimi“ heissen müsste, falls sich wer fragt, warum zu Ostern oder Weihnachten gern mal montags gesendet wird) ungefähr genausoviel eignenes (ostdeutsches) Profil hat wie Bündnis 90 bei den Grünen, spricht Bände.
Die deutsch-deutschen Befindlichkeiten neu zu beleuchten, hätte man also sowieso nicht erwarten dürfen. Schade ist es allerdings um das Thema „Wolfsansiedlungen in Deutschland“, wenn zu den unstrittig schönen Bildern des Films eben auch die gehören, in denen der Wolf des Nachts durch den durchaus bewohnten Ort, namentlich die Hauptstrasse spaziert. Man müsste mal die Experten fragen, was sie davon hielten. Und sie viel mehr unterstützen. Denn mir sind die Wölfe in Deutschland lieber als die meisten Menschen. Fabian Hinrichs – Waldner (nomen est omen, oha) – hat zumindest einen schönen Satz drei schöne Sätze in den Mund gelegt bekommen(frei aus der Erinnerung zitiert): Man sagt ja, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Aber das stimmt nicht, das können sie vergessen. Wölfe machen sowas nicht.
Mir fehlen gerade die Worte. Sie sind da, sie gehen durch meinen Kopf, ständig, aber sie wollen zur Zeit einfach nicht raus. Das ist nicht unüblich bei mir, zumal in dieser Jahreszeit: writers block plus Winterdepression, was davon jetzt was verursacht, ist so verworren wie diese ganze wirre Welt. But nevermind. Apropos:
(via alter boy ignored prayer)
Die Gedanken zu den Worten sind da, zuhauf: Wenn ich erst mal anfangen würde, über Journalisten, über „Journalisten“ und dieses ganze absurde Theater zu fabulieren, was sich da draussen abspielt, so leicht fände ich kein Ende. Später vielleicht. Dieses Jahr noch, bestimmt, der eine Text. Obwohl ich schon wieder zweifle, auf zwei Dritteln der Strecke: Zu persönlich? Will ich das, will ich damit an die Öffentlichkeit, wenn auch an die kleine hier?
Einstweilen nur das hier, zur Verdeutlichung, wie es einem die Sprache verschlagen kann: Bayern – sprich die CSU – wird nun doch keine historisch-kritische „Mein Kampf“-Ausgabe erarbeiten: Das Buch sei volksverhetzend. Wenn Verlage das Buch in Zukunft veröffentlichen wollten, werde die Staatsregierung Strafanzeige stellen.
Nun, Hauptsache sie haben die Maut für Ausländer durchgesetzt. Mehr will der CSU-Wähler nicht, schon gar nicht mit diesem österreichisch-böhmischen Gefreiten behelligt werden. Verbieten, ganz einfach verbieten und Strafanzeige stellen.
(Kategorie Koinzidenz)
Eben höre ich auf DLF:
„Bundespräsident Gauck besucht zur Stunde syrische Flüchtlinge im niedersächsischen Grenzdurchgangslager Friedland. In Gesprächen will er sich über die Lebenssituation der Menschen aus dem Bürgerkriegsland informieren.“
Keine fünf Minuten vorher las ich beim ndr (via che):
„Und auch der deutsche Geheimdienst hat hier ein Büro. Genauer, die „Hauptstelle für Befragungswesen“ (HBW), eine Einrichtung, die eng mit dem Bundesnachrichtendienst zusammenarbeitet und direkt dem Kanzleramt unterstellt ist. In Keller von Haus 16 befragt die HBW Flüchtlinge und Asylbewerber aus Afghanistan, Syrien oder Somalia – und teilt die Informationen dann mit den Geheimdiensten der USA und Großbritanniens. Die lassen die Informationen in die Planungen militärischer Operationen einfließen.“
Nun, Gauck wird seine Gespräche wahrscheinlich nicht im Keller von Haus 16 führen, zu schlechtes Licht für die Kameras. Und über die Gespräche der anderen dort wird unser Bundespräsident wohl kein Wort verlieren.
Nur soviel zum Tod von Hildebrandt: Die eine Nachricht wird Stunde für Stunde im Staatsrundfunk gesendet, die andere auf einem Regionalsender um kurz vor elf versendet. Menschen werden durch die Städte, Dörfer und Medien gejagt, weil sie nicht „hier her passen“. Ich fürchte, es bräuchte dutzende Hildebrandts, die allesamt noch dutzende Jahren lebten und schafften, um die Dummheit und Ignoranz hierzulande auf ein erträgliches Maß zu senken. Stattdessen wird bei der Tagesschau-Meldung oder folgenden Spezial-Sendungen zu seinem Ableben kurz geseufzt – „wieder einer von den guten, so schade“ – und weiter gemacht.
Da ich immer noch an dem längeren Text bastele (die Spannung steigt…), schwelge ich in letzter Zeit vermehrt in Erinnerungen. Das mag auch an dem Tag für Tag voranschreitenden Alter liegen, und natürlich am Berlin-November.
Meine Samstags-Aktivitäten taten ihr Übriges dazu: Erst war ich, aus familiären Gründen, im Kabarett. Der ewige Sidekick von Didi lud um 16 Uhr zur Rentnervorstellung, tief im Westen. Die Wilmersdorfer Witwen waren begeistert. Zu Recht. Auch wenn sie wohl nicht genau wussten, wovon die Rede war, als sich über Podcasts und Google instant lustig gemacht wurde.
Den Abend und die Nacht verbrachte ich dann im Wedding, sowas kommt eher selten vor. Der Grund dafür war eine sehr feine Hausparty: Eines der wenigen Relikte aus der alten Westberliner Hausbesetzerzeit feierte, wie jedes Jahr, den Beginn der Instandbesetzung – 30 Jahre ist das jetzt her. Die Hausgemeinschaft sorgte für eine sehr angenehme Atmosphäre, die Wohnungstüren standen weit auf, die Dekoration war angemessen, die Leute waren nett. Es war alles da, was mensch brauchte, um sich wohlzufühlen: Ein Kicker-Raum, einer mit Videospielen, in einer Wohnung gab es laute Stromgitarrenmusikonzerte, in anderen wurde meist gute Musik aufgelegt und natürlich gab es auch – selbst um 4.30 Uhr – leckeres Vokü-Essen. Eben – wie früher. Zum Glück gibt’s sowas noch in dieser Stadt.
Eigentlich wollte ich aber nur auf ein anderes Früher hinweisen: Heute vor 20 Jahren nahmen Nirvana in New York ihr unplugged-Album auf. Wat bin ich alt. Das kann ich jetzt auch als Entschuldigung dafür nehmen, dass es für mich wohl nichts mehr geben wird, was den dreien (zugegeben, hauptsächlich Kurt) je das Wasser reichen könnte. Auf reddit gibt es ein paar Anekdoten von jemanden, der live dabei war. Und sie scheinen genügend geübt zu haben, um „the man who sold the world“ zu spielen. Zum Glück, denn wie ein Kommentar zu dem Video unten schreibt:
Zwei Jahre, einen Monat und einen Tag ist es her.
Und viel mehr Leute, als auf diesem Bild zu sehen sind, waren auch nicht da (Immerhin, natürlich war der obilgatorische Ströbele mit dem obligatorischen Fahrrad anwesend, auch wenn er auf dem Bild nicht so einfach zu finden ist). Sollte man dieser Sache hinterhertrauern? Sollte man auf eine Wiederbelebung hoffen? Keine Ahnung, ich hab’s aufgegeben, längst. Und doch auch nicht, irgendwie.
Meine WG-Vorgängerin – oder wer auch immer es war – hängte an die Toilettenrollenhalterung einen Aphorismenband von Lichtenberg. Passend zu dem Bild (deswegen überhaupt das Posting hier) las ich darin heute morgen:
Die eine Hälfte unserer Landsleute ist mit in den großen kritischen Aufstand und in das Rezensieren omnium contra omnes so verwickelt, daß sie nicht hört, und die andere liegt in einem empfindlichen Schlummer und hört und sieht nicht, was um sie vorgeht…
Erstaunlich, wie lange es das Internet mit seinen Filterblasen schon gibt…
26.10.2013
Genaugenommen war das Berliner Nachtleben schuld. Wäre ich gestern nicht so versackt, dann hätte ich heute mit dem Hund rausfahren können und wäre gar nicht am Kanal lang gegangen. Obwohl mir dann einiges entgangen wäre.
Zuerst einmal war das Wetter natürlich wunderbar: Der Herbst wird sowieso viel zu wenig gewürdigt, das war in früheren Zeiten durchaus schon mal anders. Wenn die Sonne noch mild scheint und die Blätter aber schon rostigbunt in Haufen am Boden liegen, dann ist das mindestens genauso toll wie wenn im Frühling die ersten Blumen blühen und es überall spriesst und grünt. Nur, dass sich der Hund mit seiner Fellfärbung in den Laubhaufen viel besser tarnen kann, von dem Spass des kopfüber in sie Hineinspringens ganz zu schweigen. Und auch der Radfahrer wäre mir entgangen.
Ich kreuzte gerade die Prinzenstrasse, stand oben auf der Brücke und genoss den Ausblick: In der Ferne war die Heilig-Kreuz-Kirche in ein atemberaubendes Abendrot getauft, dass es nur zu dieser Jahreszeit und mit viel Glück gibt, und unter ihr schimmerte der Kanal. Der Winter lag bereits in der Luft, ich war vor nicht mal einer Stunde aufgebrochen und jetzt dämmerte es schon.
Als ich meine Schritte Richtung Uferweg lenkte, den Abhang hinab, sah ich ihn von weitem das erste mal: Ein grossgewachsener, hagerer, knochiger alter Mann, der kerzengrade auf seinem schlichten alten Herrenrad sass, ab und an seinen Hut festhielt, damit dieser nicht wegflog, ansonsten aber gemächlich und zufrieden in die Pedalen trat. Auch ich war relativ langsam unterwegs, da der Hund jeden einzelnen Laubhaufen genauestens inspizieren musste.
Je näher wir uns jedoch kamen, desto schneller wurde der Radfahrer. Und desto kleiner und wilder.
Ungefähr bei der Mitte der Steigung kreuzten sich unsere Wege, inzwischen schien der Radfahrer weit jünger als ich, er wirkte frisch und aufgedreht und sass auf einmal auf einem BMX-Rad. Sein Hut war längst verschwunden und ihm klebten ein paar verschwitzte Strähnen des langen vollen Haares in der Stirn. Er trat kräftig in die Pedalen und würdigte mich keines Blickes, seine Aufmerksamkeit lag vollkommen auf der Bewältigung des Anstiegs. Ich blieb stehen, um nach dem Hund zu schauen, wobei ich dank der Tarnfarbe einige Mühe hatte, ihn zu finden.
Sobald der Hund wieder halbwegs an meiner Seite war, liess ich meine Augen dann wieder nach dem wundersamen Radfahrer schweifen. Er war schon fast oben an der Brücke angekommen, inzwischen im Vorschulalter und auf einem Puky-Rad mit Stützrädern fahrend. Dabei umkreiste er lachend eine Gruppe finster dreinblickender Nachwuchsgangster und rief: „Auch ihr werdet es irgendwann verstehen: Wir müssen uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen!“ Dabei läutete er wie wild mit seiner Tigerentenklingel und fuhr nach zwei weiteren Schleifen um die Gruppe wieder in wilder Fahrt bergab. Als er an mir vorbeirauschte, sah er auf seinem Rennrad fast ein wenig wie der junge Jan Ullrich aus.
Natürlich setzte ich meinen Weg unbeirrt fort, in Kreuzberg siehst du so was jeden Tag. Ausserdem hatte ich der alten Pennerin, die weiter vorne wie jedes Jahr ihr Winterlager mit Einkaufswagen und Zeltplanen aufgestellt hatte, versprochen, auf dem Rückweg ein Sterni und einen Kurzen mitzubringen. Und ich halte meine Versprechen. Als wir mit kalten Fingerknöcheln dann das Feierabendbier zusammen tranken und der Hund mit einem Dönerrest aus dem blattlosen Gebüsch kam, erzählte sie mir, dass der Radfahrer dieses Spektakel jeden Abend veranstaltet: „Ick weeß bloss nich, wat der mit diese Sissy Voss hat, der Spinner. Is aber och ejal. Punkt zwölf wird der eh von die Ratten uffjefressen, kannste die Uhr nach stellen.“
Muss man sich die Avantgarde, die Vorhut, die, die voranschreiten und neue Gedankenwege als erste betreten, nicht als unglücklich, verzweifelt und resigniert vorstellen? (Eine kleine Camus-Referenz in diesen Tagen, da kommt man nicht drum rum.)
Die Revolutionäre in der DDR, die teils seit Jahren vielleicht nicht Leib und Leben, aber doch ihre Freiheit riskierten (für die sie stritten, weil sie ihnen viel zu kümmerlich war), wurden innerhalb von Wochen übertönt von denen, die nur schnell Geld wollten, um schnelles Geld zu machen.
Die Pioniere und Visionäre des Netzes, die teils seit Jahren und Jahrzenten die utopischen Potentiale dieses Mediums erkunden und vorantreiben, werden immer wieder in die anarchistische Schmuddelecke gestellt, damit im Netz – wie schon immer bei der Landnahme des Kapitalismus und seiner vorherigen Inkarnationen – für ein paar Glasperlen zukunftsträchtige Märkte etabliert werden können.
Die Foucault-und Derrida-Jünger der 80er und 90er Jahre, die sich ja selbst auch vielen Anfeindungen ausgesetzt sahen, müssen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen (heute heisst das wohl: Sich die Hand ins Gesicht drücken aka Fazialpalmierung), wenn sie sehen, mit welcher Begeisterung die Bachelorstudenten von heute ihre Subjektivierung vorantreiben und die Entgrenzung von dem, was sie Arbeit nennen, als moderne Errungenschaft preisen, dabei hat sich die Ausbeutung einfach nur neu in Schale geschmissen.
Diejenigen, die seit Jahren die Abschaffung von Geheimdiensten bzw. die Beschneidung ihrer Allmacht fordern müssten sich hysterisch lachend vom Merkel-Handygate abwenden. Wenn man Zeit nicht als linear betrachtet und sich ein wenig auf die Erkenntnisse der Astrophysik einlässt; wenn gleichförmige Ereignisse unterschiedlicher Epochen in dieser alternativen Zeitleiste wirklich parallel passieren; wenn Zukunft und Vergangenheit sich wechselseitig bedingen oder gleichzeitig passieren, zukünftiges Handeln gar Entscheidungen in der Vergangenheit beeinflussen: Wie weit weg sind wir von Moskau 1937 („Wyschinski ist ein großer Erzähler und Regisseur von Kriminalfällen. Ihm steht die grenzenlose Phantasie eines Verschwörungstheoretikers zur Verfügung, aber auch der ganze Apparat des NKWD, dessen Verhör- und Folterspezialisten in der Lage sind, Geschichten, Lebensläufe, Ereignisse, Verknüpfungen ad libitum zu produzieren.“ S.107)? Der eine Teil des Apparats jagt unliebsam gewordene Angehörige desselben, wenn es sein muss, rund um die Welt.
Und denen, die heute daran erinnern, dass Mitbürger ausgegrenzt, stigmatisiert, enteignet, dehumanisiert und letztlich vernichtet wurden, bleibt denen nicht jeder Bissen ihres Zigeunerschnitzels im Halse stecken angesichts des Parasiten– und Sozialschmarotzer-Gewäschs, was ständig in unzähligen Kommentarspalten abgesondert wird?
Wie ich drauf komme? Ich war einfach wahnsinnig begeistert vom Einstiegssatz zu Georg Seeßlens Essay „Weitere Notizen zum Sterben der Demokratie“:
Demokratie, im Idealfall, ist die zivilisierteste, freundlichste und vielleicht auch „kreativste“ Form des Bürgerkriegs. Sie bedeutet unentwegten Streit, und wenn es gut geht, dann ist es „offener Streit“. Die Gesellschaft, die sich Demokratie leisten will, muss gelernt haben, mit dauerndem, offenen Streit zu leben, und in gewisser Weise auch Gefallen und Nutzen davon zu tragen, auch und gerade eingedenk der Tatsache, dass dieser Streit weder garantiert, immer zu den besten Ergebnissen zu führen, noch eines Tages wirklich „beigelegt“ zu werden.
Vor zwanzig Minuten hatte ich noch eine Idee, wie ich diesen Splitter mit einem leichtfüssigen Beispiel etwas aufheiternd abschliessen kann, damit er nicht so schwer im Magen liegt. Ist mir leider zwischenzeitlich entfallen.
Ich drück mich grad ein wenig vor dem langen Text, der immer länger wird. Unter anderem deshalb hab ich mir jetzt endlich „Sonneborn rettet die Welt“ angeschaut. Zu Martin Sonneborn hab ich ein eher ambivalentes Verhältnis: Irgendwie ist er mir als Mensch nicht besonders sympathisch. Andererseits: Ich kenne ihn ja gar nicht persönlich, also ist das, was ich da unsympathisch finde – abgesehen davon, dass es sich sowieso nur um ein unbestimmtes Bauchgefühl handelt – auch nur ein durch Medien vermitteltes Bild.
Sonneborns Arbeit allerdings, soweit ich diese verfolgt habe, hat mir fast immer uneingeschränkten Respekt und Zustimmung abgenötigt, sowohl bei der Titanic, seinen Fernsehbeiträgen als auch mit der PARTEI – unsere Kneipenrunde überlegt derzeit ernsthaft, eine Schankwirtschaftsortsgruppe zu gründen. Endgültig überzeugt von seinem Schaffen hat mich Sonneborn mit dem Film „Heimatkunde“ – die unbestimmte Antipathie war hier fast völlig verschwunden.
Nun versucht sich der vielbeschäftigte Journalist und PARTEI-GröVaZ also auch noch als Weltenretter. Er lässt die Leute reden, und das ist nicht immer zu ihrem Vorteil, die Methode Dennis Mascarenas sozusagen. Der ehrwürdige Club of Rome schickt einen Professor vor`s Mikro, immerhin Ko-Autor vom vielbeachteten „Grenzen des Wachstums“, der ernsthaft vorschlägt, Unmassen von Geld zu drucken und an die Armen zu verteilen, damit der Kapitalismus was zu tun bekommt und seine eigene Krise überwindet. Münchausen, der sich am Schopfe aus dem Sumpf zieht. Keine Rede vom Systemfehler, das erwähnt der Professor nicht, aber selbst die auf den ersten Blick vielleicht etwas skurril anmutenden Gestalten vom Friedrichshainer Schenkladen (eine der nächsten Stationen Sonneborns) haben das verstanden und sich über die Türe gepinselt. Das ist so einfach zu verstehen, da gibt es sogar ein Kinderlied drüber: Wenn der Topp aber nun ein Loch hat… dann kann man, um den Wasserstand zu halten, immer weiter nachkippen. Oder, wie in dem Lied, verzweifelte Flickversuche starten – letztendlich beisst sich die Katze in den Schwanz und man braucht, um den Topf zu flicken, einen Topf zum Wasserholen: Systemfehler.
Bemerkenswert – und wohl in dem „reden lassen“-Konzept begründet – ist, dass Sonneborns Gespräch mit Gysi eher farblos bleibt: die beiden Profis passen hier nicht. Was nicht heisst, dass mit dieser Besetzung keine Unterhaltung zu machen ist, im Gegenteil. Das Bloßstellen des gestellten Interviews mit dem Banker passt da schon eher, ganz zu Schweigen von der parallel geführten Strassenumfrage in Charlottenburg und Neukölln: Für mich der Höhepunkt der ganzen Sendung.
Nicht nur wegen der Schonungslosigkeit und der Schamlosigkeit, die einige Antworten entlarven. Sondern auch wegen der Szene ab 23:15: Erst das grandiose „Wat für`n Ding?“ – und dann der Ata-Moment: Die sukzessive Entblößung der Verzweiflung und Hilflosigkeit einer (gerade noch die perfekte „Dreieinhalb“-Armani-kostümierte Charaktermaske darstellenden) Zehlendorferin (vermute ich jetzt mal), und das nur wegen der einfachen Frage nach dem aktuell verwendeten Putzmittel. Soweit wäre sogar alles noch im Klischee, aber was folgt ist der wirkliche Schlüsselmoment: Irgendwann sagt die Dame „Ata“ – das kennt sie noch, und beide, Reporter und vermeintliches Opfer, wissen um die Komik und die Verschrobenheit, die dieser Antwort inneliegt. Weder die Charaktermaske „Sonneborn als kritischer Journalist“ noch die der reichen Dame aus der Villensiedlung, die putzen lässt, sind jetzt präsent, sondern zwei Menschen, die sich an Zeiten erinnern können, als es Ata noch gab, und viele, viele Annehmlichkeiten eben noch nicht. So sind beide ganz kurz in einem herzhaften Lachen vereint, der klassische Comic Relief, mit dem der spannungsgeladenen Situation plötzlich komplett die Luft rausgelassen wird.
Sicher, da ist noch viel Luft nach oben für „Sonneborn rettet die Welt“. Es scheint trotzdem eines der guten Projekte zu werden und der Abspann offenbarte, dass der schon für „Heimatkunde“ verantwortliche Regisseur Andreas Coerper hier ebenfalls dabei war. Leider ist „Sonneborn rettet die Welt“aber auch eines der vielen guten Projekte, die samt und sonders in die Belanglosigkeit der öffentlich-rechtlichen Digitalkanäle verbannt werden. Nun ja, wenn diese durch Politik ferngesteuerten Programmdirektoren das so wollen, lassen wir sie doch in ihrer Zwanzigsten-Jahrhundert-Ecke ihr Spielchen weiter spielen, solange wir uns das Zeug im Netz anschauen können. Natürlich nicht.
Irgendwann werde ich mir also bestimmt auch die nächsten Weltrettungsversuche anschauen, jetzt jedoch erst mal die Sonne geniessen und vielleicht später ja sogar noch ein, zwei Seiten weiter schreiben. Übermorgen gehts nämlich schon wieder Richtung Sonnborner Kreuz und darüber hinaus, dann werde ich da nämlich nicht zu kommen … 🙂 Ein nettes Detail am Rande: Eingestellt wurde das Video auf Youtube von Max Utthoff. Einer, der den Abschied Georg Schramms etwas leichter macht, wo Olaf und ich grad beim Thema waren…
Wer für das Wochenende Thrill braucht, sollte sich diesen krassen, guten Text durchlesen (gefunden bei reportagen.fm). Aber dann nicht sagen, ich hätte niemanden gewarnt.
Jegliches hat seine Zeit: Kürzlich schrieb ich über Günther Wallfraff, dass er wohl nicht mehr in diese passt. Jetzt bin ich durch Fefe auf einen Videoschnipsel mit Noam Chomsky gestossen. Chomsky ist ein Grosser, keine Frage. Auch wenn seine lingustischen Theoreme – das ist schliesslich sein Fachgebiet – inzwischen überholt oder falsifiziert wurden, hat er doch, ähnlich wie Wallraff, wertvolle Beiträge für den gesellschaftlichen Diskurs beigesteuert. Die Berufsbezeichnung für beide wäre mit „Kritischer Geist“ wohl am besten erfüllt.
Fefe schreibt nun, mit dem Hinweis auf einen Artikel, der sich auf ein nicht mal 4-minütiges Youtube-Video bezieht:
Noam Chomsky erklärt das Internet.
In an interview uploaded to YouTube, Noam Chomsky answers the question “[d]oes the generative potential of the internet help to form new kinds of social or cultural associations” by saying that he knows of “actual cases” of “adolescents who think they have 500 friends, because they have 500 friends on Facebook, but these are the kinds of friends who, if you say, ‘I had a sandwich,’ they ask ‘Did it taste good?’”
Mir persönlich fehlen da noch Katzenbilder, aber ansonsten ist das doch eine akkurate Zusammenfassung der Lage, meint ihr nicht?
Soooo falsch ist das alles gar nicht, was der Herr Chomsky da erzählt. Früher war alles besser, vor acht Wochen zB war noch Sommer. Allerdings möchte ich hinzufügen: Wenn im Internet jemand – speziell „adolescents“ – erzählt, er hätte ein Sandwich gehabt, würde ich als Nachfrage erwarten „Who were the guys?“. Oder, um Chomskys Bemühungen um die englische Sprache zu würdigen, „With whom?“.
… ich bin noch da, auch wenn die dank des Kiezneurotikers hier Gelandeten einen gewissen Stillstand verspüren mögen. Es ist sogar ein etwas längerer Beitrag in Arbeit, der in der nächsten Zeit wohl seinen Weg auf diese Seite finden wird. Ein Hauptgrund für meinen Blog-Neustart war, dass ich nicht mehr so wütend gegen dieses charaktermaskendurchsetzte Polittheater anschreiben wollte, weil mich (und viele andere scheinbar auch, das lese ich in letzter Zeit oft) das nur noch frustierte. Sondern eher wieder persönlichere Geschichten, natürlich voll aus der Deckung der Anonymität heraus und mit bedeutungsschwangerem Anspruch an das Große Ganze. Hat bisher super geklappt, schon klar.
Genau deswegen verkneife ich mir zur aktuellpolitischen Gesamtsituation sämtliches „Hab ich doch schon tausendmal geschrieben und schreib’s halt jetzt nochmal“-Rumgeheule, nur soviel sei mir gestattet: Albrecht Müller von den Nachdenkseiten stellt mit einer bravourös gewählten Überschrift eine Frage, die als Artikel eigentlich nur zwei Buchstaben mit einem darauf folgenden Ausrufezeichen benötigt: Sind wir schon so verblödet, dass wir uns erst dann aufregen, wenn Frau Merkel von den US-Diensten abgehört wird? Auch Fefe dreht angesichts der Absurdität der ganzen Veranstaltung frei, Stichwort Spezialdemokraten:
Schmerz lass nach! Das bescheuertste Statement des Tages kommt von der Verräterpartei. Achtung, festhalten:
„Wer die Kanzlerin abhört, der hört auch die Bürger ab“
IHR PFEIFEN! Wir WISSEN schon, dass die uns alle abhören! Nur dass sie auch die Merkel mit ihrem angeblichen Hochsicherheitstelefon abhören, das wussten wir noch nicht. Mann Mann Mann. DAS IST DOCH GERADE DIE IRONIE AN DER SITUATION JETZT!
Wird es irgendetwas nützen? Nein. Es wird sich schon ein Krieg, ein spektakulärer Bruch der Koalitionsverhandlungen oder eine Wirtschaftskrise finden, und plötzlich haben alle die ganze Sache ganz schnell wieder vergessen bzw. zu den Akten gelegt. Zur Not werden halt ein paar riots gegen Minderheiten inszeniert, da haben vor allem die Geheimdienstler Erfahrung drin, und die haben ja einiges gutzumachen.
Wie das mit dem Vergessen funktioniert, sieht man gut an Thomas de Maiziere. Der durfte im Morgenmagazin die übliche Bundeswehrpropaganda verkünden und seinen Senf zum abgehörten Merkelhandy dazu geben, ohne sich peinlichen Fragen zu Panzer-, Drohnen- oder Sturmgewehrpannen stellen zu müssen. Dabei hatte Merkel dem schon vor 5 Monaten ihr Vertrauen ausgesprochen, der hält sich richtig gut. Was er im Interview nochmal unterstrich mit dem dezenten Hinweis, er sei ja auch schon Kanzleramtsminister und Innenminister gewesen, also Top-Ziel, um abgehört zu werden. Und eben immer noch im Amt, wohl auch demnächst wieder, egal in welchem.
Günter Wallraff ist ein tragischer Held. Nicht als Hauptfigur seiner Bücher, sondern in dem, was reales Leben genannt wird. Stellt man sich die Frage, ob es seit Kriegsende einen Journalisten in Deutschland gegeben hat, der mehr bewirkte als er, kommt man ins Grübeln. Stellt man sich die Frage, ob Günter Wallraff ein Journalist ist, ebenfalls.
Mit seinen Reportagen von den Rändern der bundesdeutschen Gesellschaft schrieb er Geschichte, keine Frage. Immerhin – und dieser Umstand wird beim Thema Wallraff mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit stets zur Sprache gebracht – wurde in Schweden ihm und seinem Arbeitsstil zu Ehren ein neues Wort kreiert: wallraffa.
Im Wikipedia-Artikel zu seiner Person wird einem nochmal klar, was diesem Mann alles zu verdanken ist: Aufdeckung bzw. Aufklärung über Portugal- und Griechenlandfaschistenputsche, das Elend des Industriearbeiters, speziell des zugewanderten, und das Böse in persona – die Bild-Zeitung und der Springer-Konzern. So kann man Wallraff ohne Bedenken in eine Traditionslinie mit Kisch und Lania stellen. Hat der Mann eigentlich ein Bundesverdienstkreuz? Nein? Aber die hier alle schon?
Allerdings findet sich bei Wikipedia auch die dunkle, tragische Seite des Günter Wallraff dokumentiert: Skandale und Skandälchen, von Vorwürfen zum Thema Sozialbetrug über Urheberrechtsstreitigkeiten, Ghostwriter, Stasi bis zum Anti-Islamismus. Nicht zu vergessen das Blackfacing – mit „Schwarz auf Weiß“ bewies Wallraff, dass er längst nicht mehr auf der Höhe der Zeit war, was die aktuellen intellektuellen Diskurse betraf. (OT: Ich habe gerade vor kurzem erst gelernt, dass die populäre Sitcom „The Big Bang Theory“ nichts als „Nerd-Blackface“ sei – bis jemand kommt und auf reddit verkündet, dass mit dieser unbeholfenen Analogie das Blackfacing relativiert würde).
Wallraff kann, rein biologisch bedingt, nicht mehr das machen, was er vor Jahrzehnten tat: abtauchen, undercover recherchieren, sich als Mittdreissiger ausgeben, der beim Stahlkocher im Pott die Knochenarbeit macht. Sein letzter großer Wurf könnte eine Reportage über die Missstände in Altersheimen werden, dieses Thema drängt sich auf so vielen Ebenen geradezu auf.
Stattdessen hat Günther Wallraff letzte Woche scheinbar der dpa ein Interview gegeben. Von wem die Initiative dazu ausging, ist nicht klar, auch das Interview selbst habe ich bisher nirgends gefunden. Allerdings wurde die Hauptaussage in mehreren Medien zitiert, und das war wohl auch der einzige Sinn und Zweck der Aktion (neben dem Umstand, dass Wallraff mal wieder in der medialen Öffentlichkeit auftaucht): Im Koalitionsvertrag, egal ob es den geben wird und wer ihn schliesst, muss laut Wallraff festgeschrieben werden, dass Edward Snowden in Deutschland politsches Asyl zu gewähren sei.
Warum? Also nicht, warum Snowden Zuflucht in der Bundesrepublik geboten werden soll, sondern: Warum kommt Günther Wallraff jetzt mit dieser Wortmeldung? Es ist richtig und nötig, auf die Brisanz des Themas hinzuweisen, es weiter am Köcheln zu halten, so schwer das auch sein mag. Wie schwer es ist, kann man daran erkennen, dass Wallraffs Forderung kaum Widerhall gefunden hat. Doch auch die schon angesprochene Gestrigkeit der Autorenlegende zeigt sich hier: Mit dem festen sozialliberalen Moral-Kompass der 70er-Jahre-Bundesrepublik ausgestattet mal einfach eine naive Bedingung für den Koalitionsvertrag aufstellen. Mit dem Namen wird man dann wenigstens kurz in der Presse zitiert, auch wenn es viele besser geeignete und informiertere Experten zum Thema gibt.
Die zum Beispiel wissen, dass man Edward Snowden dringend davon abraten müsste, in Deutschland Asyl zu beantragen. Selbst wenn es ihm – von mir aus auch per Koalitionsvertrag – zugesichert werden würde [Süddeutsche-Interview mit Prof. Joseph Foschepoth]:
Der NSA-Whistleblower Edward Snowden hat unter anderem in Deutschland um Asyl gebeten. Manche Politiker wollen ihn gerne als Zeugen vorladen. Wäre Snowden gut beraten, in die Bundesrepublik zu kommen?
Auf keinen Fall. Aufgrund des Zusatzvertrags zum Truppenstatut und einer weiteren geheimen Vereinbarung von 1955 hat die Bundesregierung den alliierten Mächten sogar den Eingriff in das System der Strafverfolgung gestattet. Wenn eine relevante Information im Rahmen eines Strafverfahrens an die Öffentlichkeit gelangen könnte, heißt es in Artikel 38, „so holt das Gericht oder die Behörde vorher die schriftliche Einwilligung der zuständigen Behörde dazu ein, dass das Amtsgeheimnis oder die Information preisgegeben werden darf“. Gemäß der geheimen Vereinbarung wurde sogar der Strafverfolgungszwang der westdeutschen Polizei bei Personen aufgehoben, die für den amerikanischen Geheimdienst von Interesse waren. Stattdessen musste die Polizei den Verfassungsschutz und dieser umgehend den amerikanischen Geheimdienst informieren. Dann hatten die Amerikaner mindestens 21 Tage lang Zeit, die betreffende Person zu verhören und gegebenenfalls außer Landes zu schaffen. Was nicht selten geschah. Im Übrigen hat natürlich die Bundesregierung keinerlei Interesse, sich auf einen neuen Kalten Krieg, dieses Mal mit den Vereinigten Staaten, einzulassen.
Was also bleibt übrig von Wallraffs Forderung? Hat er nicht genügend recherchiert, bevor er den Mund aufgemacht hat? Oder wurde auch hier die Wahrheit wieder nur verkürzt per dpa-Schnipsel wiedergegeben? Leider ergibt sich daraus auch, dass die eigentlichen Probleme – Geheimverträge etc. – gar nicht erst thematisiert werden. Der Wallraff hat da ja schon so was schön griffiges zu gesagt.
PS. Da heute schon wieder Wochenende ist, gibt es als Bonus-Track einen Text, den ich vor über zehn Jahren (2002) schrieb. Er kam mir durch das Thema wieder in den Sinn, ich kramte ihn hervor und stell ihn jetzt hier rein, kommentarlos, roh und ungeschliffen, wie ich ihn fand:
Die letzte Fahrt des Hans Esser
„Ich möchte mich nicht in Köpfen befinden, zusammen mit Gedanken, die unter Einfluss vom Axel-Springer-Verlag enstanden!“ Jan Delay
( Eine fiktive Annäherung)
Es war sowieso alles egal. Sein ganzes Leben. Sollen sie doch kommen, die Wellen. Alle Tsunamis dieser Welt konnten ihm nichts mehr anhaben. Zerstört hatten ihn ganz andere Sachen, sehr viel früher.
Dieser alte graue Mann befand sich auf seiner letzten Tour. Er wusste es irgendwie, doch nicht bewusst. Berühmt war er, berüchtigt und streitbar. In seinem Haus in Köln steht eine Tischtennisplatte, die mehr erzählen könnte als der Teppich vor dem Schloss Bellevue.
Damals hatte er an dieser Tischtennisplatte Wolf Biermann so was von in den Boden gespielt. Der wohnte nach seiner Ausbürgerung kurzzeitig hier und die Welt schien so klein, dass man sie in einem Tag erobern könnte. Sie wollten es jeden Tag auf`s neue probieren, aber irgendwie blieben sie immer an der Tischtennisplatte oder einem neuen Buch oder einer Marihuana-Zigarette hängen. Härtere Drogen nahmen sie nicht. Nicht wegen irgendeiner Moral, sondern aus Protest. Kurz zuvor hatten sie die verschriftlichten Rauschberichte von Ernst Jünger gelesen, und mit diesem Kriegsverherrlicher wollten sie nun gar nichts gemein haben.
Aber nicht nur Wolf Biermann bespielte diese Tischtennisplatte, auch Salman Rushdie und andere wirklich bedeutende Menschen des letzten Jahrhunderts.
Doch Köln war wirklich weit, weit weg. Der alte Mann befand sich mitten auf dem Mittelmeer. Er war oft hier. Nicht genau an diesen Koordinaten, genau genommen wusste er überhaupt nicht, wo er war. Das Mittelmeer brachte ihm immer irgendwie eine Art Entspannung. In Deutschland war er schließlich ein bunter Hund. Die Menschen erkannten ihn, obwohl er dadurch berühmt wurde, sich zu tarnen und zu verkleiden. Er war die letzte Ikone der Sechziger Jahre, die noch nicht in der Regierung saß.
Wenn heute in Berliner Parlamenten über die Integration von so genannten türkischstämmigen Jugendlichen debattiert wird, dann kann er nur müde lächeln. Das konnte er schon immer gut. Müde, wissend und bedauernd lächeln. Man hat ihn noch nie lauthals lachen sehen. Der „Journalist“ Tiedje behauptet sogar, dass der alte Mann nicht lachen könne, zumindest aber dafür in den Keller gehe.
Dabei war er es doch, der die umgekehrte Integration an sich selbst testweise vollzog. Und dies dann journalistisch dokumentierte, dass dem deutschen Volk (gemeint ist natürlich, historisch korrekt, das westdeutsche Volk) hören und sehen vergingen. Denn er führte ihnen vor, dass sie wegsahen und weghörten, wenn es um ihre ausländischen Mitbürger ging. Dieser arme Türke Ali, der rackte und schaffte und seinen Körper verkaufte, er wurde ausgebeutet. Bei ihm schien der alte Marx doch recht gehabt zu haben. Wie schlimm und unmenschlich doch selbst die soziale Marktwirtschaft sein konnte!
Dann kam ein tiefes Loch voller stürmischer Begeisterung für ihn, der ein neues Genre im deutschen Journalismus geschaffen hat. Er war schon immer Extremsportler. Da ist dieser junge Spund von dem irischen Hausboot-Familienclan gar nichts gegen. Er kletterte aus dem tiefen Loch locker heraus, und das was danach kam, war zu vergleichen mit der anschließenden Besteigung des Mount Everest. Schließlich war er es, der alte Mann, der sich mit der mächtigsten Kraft anlegte, die es damals gab. Gegen wen richteten sich denn die Studentenproteste der sechziger Jahre? Wer wurde für den Mordanschlag auf seinen alten Freund, den größten Studentenführer den Deutschland je hatte, verantwortlich gemacht? Und war es auch? Genau! Und er wagte sich damals in die Höhle des Löwen. Es war Krieg in Deutschland, so kalt, dass es heißer nicht ging. Und er stieg direkt hinab in die Hölle. Natürlich hatte jeder einen gewissen inneren Groll gegen diese gigantische Meinungsmachereimaschinerie, aber er war es, der die Beweise lieferte. Er war Teil des Systems. Einer, der vorgab sich in das Borg-Bewusstsein zu integrieren, aber eigentlich ein verdeckter Ermittler in eigener Sache war. Und danach wieder – Begeisterung, Bewunderung, Erstaunen und eine Prozesslawine. „Viel Feind, viel Ehr“ – er konnte sich nie für die militaristischen Parolen seiner Elterngeneration erwärmen, aber hier stimmte es.
Doch das Loch was sich dann auftat, war zu tief, um wieder herauszukommen. Es passierte zu viel, und leider war er nicht am Geschehen beteiligt. Sein Land veränderte sich. Doch er wollte sich nicht verändern. Er hat den Absprung verpasst. Alle anderen Intellektuellen aus seiner Generation standen auf der Jublerliste für die SPD, waren tot oder im Untergrund. Die „Antje-das-Walross-Lookalikes-Gang“, die er mal zusammen mit Wolf Biermann und Günther Grass gebildet hatte, war auseinandergebrochen. Von ihm wurde erwartet, so weiter zu machen wie bisher. Er hatte sich in irgendeinen verdeckten Job hineinzubegeben, abzutauchen und ein halbes Jahr später wieder mit sensationellen Meldungen aufzutauchen. Sowohl seine Freunde als auch sein Verlag und Stefan Aust, der für den Spiegel die Vorabdrucksrechte gesichert hatte, erwarteten das von ihm. Doch er wollte und konnte nicht mehr. Er spielte Tischtennis und fuhr Kajak.
Der Wassersport entwickelte sich immer mehr zu einer Leidenschaft. Sein letztes Experiment scheiterte. Er wollte er selbst sein. Doch in seinem täglichen Leben stellten sich immer wieder die detektivischen Momente ein. Er beobachtete sich selbst und versuchte, die passenden Formulierungen für sein Handeln zu finden. Nicht zu drastisch, aber auch nicht zu harmlos. Doch dann bemerkte er, dass sich wohl keiner dafür interessieren würde, wie seine Tochter morgens ihr Müsli zubereitete. Das Projekt „Leben als Günther W.“ war gescheitert.
Er fing an, noch mehr Sport zu treiben. Und, was viel schlimmer war, Steine zu sammeln. Sein ganzes Haus war vollgestapelt damit. Seine Frau hasste ihn dafür. Von überall her brachte er sie mit. Egal ob klein wie ein Stecknadelkopf oder groß wie ein Wagenrad, er musste sie haben. Er hatte von seinen Eltern ein Haus in Köln geerbt und durch Honorare und weitere Erbschaften genug Geld, um weitere Häuser zu kaufen. Eine Ruine erstand durch seine Hand zu neuem Leben, um eine Steinsammlung zu beherbergen. „NaturSkulpturen“ – das war seine neue Berufung. Er verehrte Hans Arp, doch dachte er, dass er mit seinen Steinen den alten Meister übertreffen, ja vollenden würde. Schließlich ist diese Kunst Jahrmillionen alt, von der Natur, der Schöpferin, selbst modelliert.
Der alte Mann bekam vor zwei Wochen zwei Anrufe kurz hintereinander. Der erste Anruf kam aus einer französischen Kneipe. Man hörte im Hintergrund das Gemurmel alter Fischer und das des Meeres. Die Stimme am anderen Ende der Leitung schien mehr als dubios, und außerdem nicht mehr ganz nüchtern. Es war ein scheinbar etwas verwirrter Mann, der ihm mal so nebenbei vom perfekten Stein erzählte. Der alte Mann wusste schon lange, dass es den perfekten Stein geben musste. Und sein Gefühl sagte ihm auch stets, dass er irgendwo im Mittelmeer liegen würde. Nicht umsonst zog es ihn seit Jahren hierher. Die weintrunkene Stimme am anderen Ende beschrieb im schweren, fischertypischen Proletenfranzösisch eine Insel, nur beschwerlich vom Festland zu erreichen, an deren Strand der Stein liegen sollte. Dann wurde das Gespräch unterbrochen.
Der zweite Anruf war von seinem alten Freund Rüdiger. Der gelernte Bäcker aus Hamburg ist durch waghalsige Aktionen berühmt geworden. Rüdiger fragte, ob der alte Mann gewillt sei, ein wenig Geld zu verdienen. Ein Fernsehsender plane eine Serie, in der „normale Menschen“ vier Wochen lang unerkannt durch Deutschland reisen sollten. Rüdiger, Survival-Spezialist von Südamerikanischen-Indianer-Götter-Gnaden, hatte den Vertrag schon unterschrieben. Er sollte den „Kandidaten“ das Überleben in der mitteleuropäischen Wildnis inklusive Verzehr heimischer Insekten beibringen. Und den alten Mann wollten sie für das unerkannte Überleben in der Großstadt haben. Von der RAF wollte keiner mitmachen, deswegen sind sie auf ihn gekommen.
Der alte Mann packte seine Sachen zusammen und flüchtete ans Mittelmeer. Er schnappte sich sein Kajak und paddelte auf`s Meer hinaus. Er wusste, dass er sterben würde, aber er wusste auch, dass er den Stein sehen würde. Und er wollte lieber den Stein sehen und sterben, als auch nur einen Fuß auf vermeintlich journalistisches Gebiet setzten, das auch nur irgendwie nach Endemol roch.
Als die große Welle gegen den Bug seines Bootes schlug, verwandelte er sich ein letztes Mal. Er wurde wieder zu dem egoistischen, energiegeladenen und menschenverachtendem Arschloch Hans Esser, der alles tat, um weiter zu kommen. Doch diesmal half es nichts.
So schlecht lag ich mit meiner realistischen Prognose also gar nicht: CDU über 40%, SPD hat sich kaum gesteigert, Grüne und Linke gleichauf und einstellig, AfD knapp nicht drin, FDP nicht ganz so knapp nicht drin. So weit, so schlecht.
Da es für eine absolute Mehrheit bei der Union auch knapp nicht reicht, stellt sich die Frage, wer die Umfaller-Rolle der FDP übernimmt, ich tippe auf die SPD. Dass die versprengte Truppe von Rösler und Brüderle achtkantig rausgeflogen ist, ist die einzige positive Botschaft dieser Wahl. Trotzdem schliesse ich mich der Meinung von Michael Schmalenstroer und Stefan Niggemeier an, dass es nun an der Zeit ist, über die Fünf-Prozent-Hürde nachzudenken (wenn einem der Sinn nach Reförmchen steht statt nach grundlegenden Veränderungen).
Die Stimmen der Liberalen – was früher ja einmal für eine ernstzunehmende politische Strömung stand, denen es nicht nur um den freien Markt, sondern auch um Bürgerrechte ging – haben sich auf FDP, AfD und Piraten verteilt (ein wenig wohl auch an die Grünen, CDU und SPD). Die AfD erlebte ihren Piraten-Abgeordnetenhauswahl-Moment, die Piraten ein Desaster. Dieses wird auch der AfD nicht erspart bleiben, aber mit dem beachtlichen (wenn auch vorhersehbaren)Wahlergebnis von knapp unter 5 % ist die Bundesrepublik in der kontinentaleuropäischen Normalität mit populistischen nationalliberalen Kleinparteien angekommen.
Wer auch immer mit Merkel regiert, wird verlieren. Die Sozen werden nicht den Arsch in der Hose haben, die Koalition zu verweigern und statt dessen eine Opposition zusammen mit Links gegen Schwarz-Grün auf die Beine zu stellen. Ist schliesslich – um schon mal eine Floskel vorwegzunehmen – ein ernster Auftrag in diesen Zeiten, da braucht man eine stabile Regierung, gerade als so starker Faktor in Europa, Dienst am Vaterland, da kennt man keine Parteien mehr usw.
Und all die progressiven Netzvollschreiber, Vordenker und hippen Berufsjugendlichen mit apple-Vollausstattung haben es gerade mal geschafft, die Piraten nicht ganz untergehen zu lassen. Trotzdem sind deren 2,2 % eine Katastrophe für all jene, die meinten, dass ihre Filterblase irgendeine Relevanz in der realen Welt hätte. Schirrmachers Feuilleton-Brigade, um es mal so auszudrücken, ist eben nur eine possierliche Marginalie für den Sonntagsnachmittagstee, regiert wird weiterhin mit (und durch) Bild und BamS.
Also eine weitere grosse Koalition. Das lässt wenigstens auf eine wachsende APO hoffen, ein klitzekleines Bisschen.
Übrigens: Cajus Julius Caesar (natürlich CDU) wurde auch in den Bundestag gewählt und kann dort ohne den Umweg über Nachrückerplätze einmarschieren. O tempora…
Der Steinbrück-Erpresser, falls sich wer erinnert, stellte sich ja als Ex-Postvorstand heraus. Schon allein das ist natürlich ein Brüller: Ein ehemaliger McKinseyaner und als Vorstand eines der größten deutschen Unternehmen praktizierender Kapitalist erpresst den Finanz-Zampano der SPD, und zwar mit angeblicher Schwarzarbeit aka Steuer- und Abgabenhinterziehung. Allerdings: Das Sahnehäubchen ist sein Rechtfertigungsversuch. Er hatte sich geärgert über Steinbrück, hat sich die Wut vom Herzen geschrieben und wollte es dabei bewenden lassen. Dann ist der Brief aber irgendwie, vollkommen zufällig und unabsichtlich, in die Post geraten. Sagt der ehemalige Postvorstand. Glaub ich sofort, keine Fragen mehr.
Wovon man ja auch viel zu wenig hört – das bemerkte irgendwer aus meinem rss-feed heute morge zu recht – ist dieser zugedröhnte Typ, der mit sich und seinen Halluzinationen vier Stunden lang im Regierungsflieger ungestört Party machen konnte. Das ist doch der Terrormann [(c) flatter] schlechthin. Ich meine, das war nicht nur ein Flugzeug, sondern auch noch eins der Regierung! Wieso fordert da keiner mehr Videoüberwachung in Luftbereitschaftsmaschinen? Lückenlose Telefonüberwachung und Vorratsdatenspeicherung anyone? Nicht? Na gut…
Nach langem Zögern und dem Fehlen einer besseren Alternative habe ich mich also entschlossen, doch wieder ein Blog aufzumachen. Und dann, beim Aufarbeiten der als Lesezeichen abgelegten Artikel, beim Suchen nach verlinkenswerten Texten, kommt mir das hier über den Weg gelaufen. Gut, im Juli hatte ich ganz andere Sorgen, aber jetzt ärgere ich mich doch ein wenig, diesen Beitrag nicht früher entdeckt zu haben.
Wie viele Blogger würden sich sofort eine Software des Verfassungsschutzes, der NSA oder des Geheimen Weltamtes für totale Unterdrückung installieren, wenn man ihnen nur erzählte, dass diese Software Besucher auf ihr Blog bringt; Besucher, die Werbeeinnahmen und gefühlte Bedeutung mit sich bringen? Wie viele Blogger dokumentieren im Moment nur ihre dumme Gleichgültigkeit, wenn sie ihr Blog zu einem Vehikel für die Reklameklickgroschen machen und diesem Zweck das Erfordernis weniger erfreulicher und weniger leicht verdaulicher Mitteilungen unterordnen.
Genau das. Ebenso interessant wie der Artikel selbst sind die sich anschliessenden Kommentare – es sind nur 20, während jeder Hirnfurz des Herrn Lobo ein Zehnfaches an Kommentaren bringt, aber das nur nebenbei. Jedenfalls drehen sich die Wortmeldungen hauptsächlich um technische Sachverhalte, es sind Vorschläge, wie die „Großen“ unter den Social-Media-Anbietern umgangen werden können. Und genau das ist charakteristisch für viele ähnliche Diskussionen in der „Netzgemeinde“: Es wird an den Symptomen rumgedoktert, technische Alternativen werden diskutiert, aber die Ursachen werden nicht oder kaum angegangen.
Das Problem hat einen Namen: Kapitalismus. So einfach ist das, und dann doch wieder nicht. Ich bin weit davon entfernt, zu glauben, dass mit der Abschaffung dieser menschenverachtenden Wirtschaftsordnung das Paradies auf Erden erschaffen werden würde. Im Gegenteil: Inzwischen bin ich desillusioniert genug, um den Menschen und sein Geltungsbedürfnis, seinen Drang nach Wettbewerb und das „Sich mit anderen messen müssen“ als Grund allen Übels ausgemacht zu haben, wobei der Kapitalismus einfach nur die passende zeitgemäße Hülle ist. Früher waren das halt Kriegszüge gen Russland oder Karthago. Der Pessismismus des Verstandes ist bei mir also klar vorhanden, mit dem Optimismus des Willens hapert es allerdings noch etwas.
Bevor ich zu sehr abschweife: Es geht auch anders. Facebook beispielsweise, gern herangezogen als Inkarnation des Bösen (Pflichtzitat hierbei ist das nur zur Hälfte wahre „If you’re not paying for the product, you are the product“), als das kaptialistische Vorzeige-Unternehmen im digitalen Zeitalter schlechthin, und seinen nicht minder hässlichen Geschwistern Google und Apple kann – selbst im Rahmen des real existierenden Kapitalismus – das Beispiel Wikipedia entgegen gestellt werden. Das könnte fast Hoffnung geben, wären da nicht die Eitelkeiten der beteiligten Menschen, die diese Hoffnung wieder zunichte machen.
Würde man objektiv (haha, schon klar) versuchen, die 80er-Jahre-BRD mit der heutigen zu vergleichen, wäre letztere dann nicht der DDR mit ihrer Gesinnungsdiktatur und Überwachungsmaschinerie viel ähnlicher als dem Mutterland des Grundgesetzes? Aber das sind Äpfel und Birnen, noch dazu in unterschiedlichen Reifezuständen. Ganz zu schweigen von dem gewaltigen Dreck, den sich auch der gesamte freiheitliche Westen im Kalten Krieg an den Stecken gepappt hat: Ulbrichts „Es muss demokratisch aussehen….“ passt hier genauso gut, nur halt unter umgekehrten Vorzeichen – es wurde alles getan, damit die Kommunisten nicht an die Macht kommen, egal ob demokratisch oder nicht.
Was also werden wir unseren Enkeln erzählen? Wie rechtfertigen wir oder unsere Apologeten uns in der Zukunft, wenn in dieser eine Star-Trek-ähnliche Utopie ohne Geld und kapitalistischer Verwertungslogik verwirklicht wäre? Nun, man kann Trekkie sein und trotzdem böse, wie der NSA-Chef mit seiner Kommandozentrale beweist (natürlich gibt es „böse“ genausowenig wie „gut“). Star Trek kann – wie alles – nicht nur in eine Richtung gedeutet werden: Als gutwillige Meritokratie, wie Fefe es unlängst tat, oder als Verschwörung des Kommunisten Roddenberry zur Aushöhlung der Grundfesten der US-Gesellschaft, ob man das jetzt gut findet oder nicht.
Werden die kritischen Stimmen von Ingo Schulze, Konstantin Wecker oder Georg Schramm inzwischen besser gehört? Müssten es nicht viel mehr Stimmen sein? Sind es nicht eigentlich auch viel mehr Stimmen, die einfach nur im Rauschen untergehen? Keine Ahnung.
Um noch auf den zweiten Teil der Überschrift einzugehen: Ich schrieb, dass ich mich in der Gesellschaft der Blogroll wohlfühle. Natürlich ist auch das nur ein Kompromiss, nichts und niemand deckt sich zu hundert Prozent mit meinen Ansichten. Ich schliesse mich zum Beispiel dieser Kritik am Kiezneurotiker an – und lese ihn trotzdem gern. Ebenso kann ich – unter anderem wegen den weiter oben angeführten Kapitalismuskritik-Versatzstücken – nichts mit dem sich dem Antikapitalismus (vorerst) verweigernden Text von mspr0 anfangen, trotzdem folge ich gerne seinen Gedanken, um selbst auf welche zu kommen. Und deswegen hab ich die Blogroll noch etwas erweitert: Um den Radwechsel, um den Duderich und um das Narrenschiff. Weitere werden folgen, hoffentlich.
…aber wir haben nur die Wahl zwischen mehr als einem Dutzend alberner Parteien. „Was du auch wählst, es kommt immer >Deutschland< dabei raus“ heisst eine Veranstaltung, die der Stressfaktor für heute abend vorschlägt. Und genau so isses.
Der unsäglich-unfassbare Prolog, den die gestrige Bayernwahl geliefert hat, beweist doch den Unsinn dieser ganzen Veranstaltung. Von hundert Wahlberechtigten gingen 64 wählen. Von den 64 waren knapp unter die Hälfte, also sagen wir mal 31 30, so dämlich, die CSU zu wählen. Und 30 von Hundert – mal ganz abgesehen von denen, die nicht wählen dürfen, obwohl sie Jahrzehnte hier leben, egal ob wegen ihrer Herkunft oder ihres derzeitigen Aufenthaltsortes, Psychiatrie oder Knast beispielsweise – also 30 von Hundert wird jetzt von diesen Dobrindts und Seehofers und Aigners als Rückgewinnung der absolute Mehrheit gefeiert. Passt scho, wenigstens die FDP seid’s losgeworden. Der fällt grad eh nix G’scheites ein ausser „Künast sieht scheisse aus und will uns alles verbieten, rot-rot-grün, buhu!“ Tolle Demokratie!
Da hilft es auch nicht, dem ganzen ein politikwissenschaftlich-avantgardistisches „Post“ voranzustellen, das wirkte schon bei der Moderne und dem Strukturalismus allenfalls hilflos. Es ist mit der Verfasstheit unserer Verfassung in etwa so wie mit der Werbung – dem anderen (eigentlichen?) Übel dieser Zeit: Die Lasagne sieht nicht im entferntesten so aus wie das Bild auf der Packung, jeder weiss das, niemand regt sich auf. Und egal ob da jetzt Pferdefleisch drin ist oder NSA, war doch eh klar, hat doch jeder gewusst, irgendwie.
Wozu also bei diesem Theater mitmachen? Wenn jemand ernsthaft erwägen würde, diese ganze Geheimdienstgeschichte mal aufzulösen, im doppelten Sinne. Wenn dabei all der kranke Mist, der sich zwischen den gut gemeinten Fugen des Grundgesetzes festgesetzt hat, entsorgt werden würde. Wenn die Entscheidungsbefugnisse und die Systemrelevanz wieder dem eigentlichen Souverän zugestanden werden würde statt den Aufsichtsräten, Klüngelnetzwerken und kapitalistischen Verwertungsmaschinerien – dann vielleicht.
Aber solange die Staatsräson dadurch geschützt wird, dass von der Allgemeinheit bezahlte Verfassungsschützer ihre schützende Hand über all unsere Kommunikationskanäle halten, die sie sicherheitshalber stets im Blick haben, Grenzen hin oder her;
solange sie zu unser aller Sicherheit Nazi-Vereine wie den KKK, Nazimusiklabels und Naziterrorgruppen aufbauen, um sie bei Bedarf hochgehen zu lassen (gerade sind Nazis halt in, das ging und geht auch in die andere Richtung);
solange ein staatstragendes Gewese um Nationalitäten gemacht wird, anstatt sich endlich mal ernsthaft um einen Ausweichplaneten zu kümmern;
und solange „unsere“ Regierungen uns unsere Drogen verbieten, nur um ihr lukratives Schwarzmarktmonopol auf diesem Gebiet nicht auch noch an die menschenhandelnden Mafiarocker zu verlieren, die sich über ihre verbeamteten Handlanger sowieso schon kaputtlachen –
solange macht wählen gehen doch nun wirklich keinen Sinn, oder?
Wenn man also aufgrund dieser ganzen verlogenen Wahlmotivationswerbung in die Versuchung kommt, am nächsten Sonntag ein Kreuz zu machen, dann bitte wenigstens ein ganz großes, quer über den Wahlzettel, er ist groß genug. Und danach kann man sich dann mal ernsthaft Gedanken über eine neue APO machen, Zeit wird’s.
PS. Der ARD-Deutschland-Trend (sic!, siehe oben) sagt:
CDU 40%
SPD 28 %
Grüne 10 %
Linke 8%
FDP 5 %
Piraten 2,5%
AFD 2,5%
Ich sag – realistische Variante-
CDU 41%
SPD 27%
Grüne 8%
Linke 8%
FDP 4,9%
AfD 4,9%
Piraten 4,9 %
-wenigstens halbwegs spannende Variante, wenn auch unwahrscheinlich
CDU 38 %
SPD 26%
Grüne 10%
Linke 11%
FDP 2,9%
AfD 5 %
Piraten 5 %
Top, die Wette gilt! Oder es fällt vorher noch ein ordentlicher Meteorit vom Himmel und beendet dieses ganze irdische Trauerspiel. Wär mir lieber.
Ein paar Worte, um Verfasser und Blog kurz vorzustellen:
Studierte mal. Jetzt nicht mehr.
Schrieb mal ein semi-erfolgreiches Blog voll. Jetzt nicht mehr.
War mal verliebt und verlobt. Jetzt nicht mehr.
Wohnte mal woanders als in Berlin. Jetzt nicht mehr.
Hatte mal Illusionen und Hoffnung. Jetzt nicht mehr.
Ansonsten: Blogroll anschauen, das ist die Nachbarschaft, in der ich mich wohlfühle.